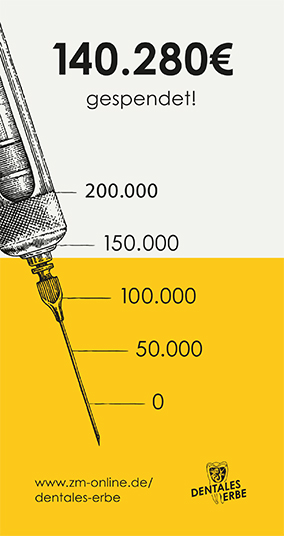Der Vorwurf: zu viel Röntgen, zu teuer, zu wenig Wirkung
„Bei den kieferorthopädischen Behandlungen von Kindern und Jugendlichen gibt es zahlreiche Missstände“, lautet das Ergebnis der im Auftrag der hkk erstellten Studie „Kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Spiegel von Routinedaten (2012–2017)“ unter der Leitung von Dr. Bernard Braun vom Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG) und Dr. Alexander Spassov, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Demnach würden „zahlreiche diagnostische Untersuchungen und therapeutische Maßnahmen ohne Notwendigkeit routinemäßig erbracht“. Außerdem würden „fast alle Versicherten, unabhängig vom Alter und ohne Prüfung der kieferorthopädischen Erfordernis, mit Röntgenstrahlen untersucht“. Dies, betont Braun, sei jedoch ein klarer Verstoß gegen nationale und internationale Röntgenverordnungen zum Schutz der Gesundheit junger Menschen.
Auch die Behandlungsdauer sei mit bis zu drei Jahren „zu lang und in den meisten Fällen nicht mit einem gesundheitlichen Bedarf begründbar“. Gründe für die „unnötige Ausdehnung der Behandlungszeit“ sieht Braun vielmehr in der „formalen Vergütungsdauer von zwölf Quartalen“ und in der „Aneinanderreihung der Behandlung mit losen und festen Spangen“. Zwei Drittel der Versicherten erhalten laut hkk-Studie vor einer festen Spange eine herausnehmbare Apparatur. „In den meisten Fällen wäre jedoch die ausschließliche Behandlung mit einer festsitzenden Apparatur zweckmäßig und wirtschaftlich“, ergänzt Spassov. „Eine feste Spange kommt zudem dem Wunsch der meisten Kinder und Jugendlichen nach einer möglichst kurzen Behandlung entgegen. Außerdem wirkt sie sich positiv auf Lebensqualität und Behandlungstreue aus.“ Ziel sollte daher eine Behandlungsdauer von maximal 24 Monaten sein.
In der Summe: Zu wenig Wirkung, zu viel Röntgen, zu lange und damit zu teuer – das sind die Hauptkritikpunkte, die Braun und Spassov in der hkk-Studie herausstellen.
Methodik der Studie:
Die Untersuchung basiert zum einen auf einem Datensatz von 3.222 hkk-Mitgliedern, denen die Krankenkasse – oder bei einem Wechsel die vorherige gesetzliche Krankenversicherung – auf Basis der KIG-Einstufungen 2016 eine KFO-Behandlung genehmigt hat und die seitdem in Behandlung sind. Auf diese 3.222 Versicherten kamen 19.404 Behandlungen, dabei entfielen 9.300 (47,9 Prozent) auf Regelbehandlungen, 7.261 (37,4 Prozent) auf Diagnoseleistungen und 2.666 (13,7 Prozent) auf die Frühbehandlung.
Kritik der Studienautoren: Keine Evidenz
Ein zweiter zugrunde gelegter Datensatz umfasst in den Jahren 2012 bis 2017 kieferorthopädisch behandelte, die gesamte Zeit in der hkk versicherte Personen (5.535 Kinder und Jugendliche), die in diesem Zeitraum entweder die Behandlung abgeschlossen haben oder noch behandelt werden. „Die Konzentration auf diese Gruppe gewährleistet, dass alle erbrachten und bei der hkk abgerechneten Leistungen untersucht werden können und ein vollständiges Bild der Art und Menge von Leistungen für die gesamte Behandlungsdauer erstellt werden kann“, heißt es im Methodenpapier der Studie. Für diese Patienten gibt es allerdings keine detaillierten Angaben zur KIG-Einstufung und damit zum spezifischen Behandlungsbedarf – hier liegen lediglich die diagnostischen und therapeutischen Behandlungsmaßnahmen und die dadurch angefallenen Behandlungskosten vor.
Was wurde untersucht?
Der Report konzentriert sich auf patienten- oder patientengruppenbezogene Aussagen zu folgenden Aspekten der zahnärztlich-kieferorthopädischen Behandlung:
Häufigkeit der Behandlungsarten nach Inanspruchnahmeart: Regelbehandlung, Frühbehandlung, Verlängerungsbehandlung
Zahl der laufenden, abgebrochenen und abgeschlossenen Fälle
Prävalenzen kieferorthopädischer Indikationsgruppen (KIG)
Häufigkeit diagnostischer Leistungen wie Röntgenaufnahmen, Gebissmodelle und Fotografien
Häufigkeit der Art erbrachter Behandlungsmaßnahmen (etwa festsitzende und/oder herausnehmbare Apparaturen)
Behandlungsdauer
Kosten der Behandlung nach Kostenarten
Bereits in der hkk-Studie „Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 2012“ beanstandeten die Autoren, dass im Rahmen der KFO-Behandlung von Kindern und Jugendlichen Referenzmaßstäbe und evidenzbasierte Behandlungsleitlinien fehlen. In der aktuellen Studie wird dieser Kritikpunkt erneut aufgegriffen: „Anspruch auf eine Behandlung besteht dann, wenn die Fehlstellung eine funktionelle Beeinträchtigung zum Beispiel des Kauens, Beißens oder Atmens verursacht. In der Praxis werden jedoch Fehlstellungen lediglich anhand der sogenannten KIG-Einstufungen identifiziert und funktionale Beeinträchtigungen nicht weiter berücksichtigt.“
Der Bundesrechnungshof teilt diese Einschätzung: Anfang April hatte er die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von jährlich 1,1 Milliarden Euro für KFO-Behandlungen gerügt. Diese Summen hätten sich zwischen 2008 und 2016 ungefähr verdoppelt, heißt es im Prüfbericht. Außerdem fehlten gesicherte Erkenntnisse zum Nutzen der KFO-Behandlungen. Die Zahnärzteschaft reagierte prompt auf die Kritik.
Zahnärzte widersprechen: Nutzen ist erkennbar!
Die Kritik sei „partiell nachvollziehbar, weitgehend jedoch unverständlich“, äußerte sich der Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) in einer Stellungnahme. „Wir sind schon sehr überrascht davon, mit welcher Leichtigkeit der Bundesrechnungshof einem seit Langem etablierten Fachgebiet der Zahnheilkunde die Existenzberechtigung abspricht“, sagte Dr. Hans-Jürgen Köning, Bundesvorsitzender des BDK. Im Grunde nachvollziehbar sei für ihn der Aspekt, im Bereich der Kieferorthopädie existiere zu wenig Versorgungsforschung. „Aber“, sagt Köning, „der medizinische Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen steht nach unserer Auffassung keinesfalls infrage!“ Sehr wohl würden ausreichend Studien existieren, die diesen Nutzen wissenschaftlich belegen.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) versteht die Forderung nach mehr Versorgungsforschung in der Kieferorthopädie, widerspricht jedoch ebenfalls der pauschalen Behauptung, dass der Nutzen der kieferorthopädischen Therapie nicht gesichert sei. „Publikationen auf höchstem Evidenzniveau belegen beispielsweise, dass Fehlstellungen – vergrößerte sagittale Frontzahnstufen – unbehandelt derzeit weltweit für über 200 Millionen Verletzungen pro Jahr mit entsprechenden Folgekosten verantwortlich sind. Ebenso belegen Untersuchungen, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Frontzahntraumas bei dieser Form der Fehlstellung verdoppelt.“
Laut Braun und Spassov bedarf es dagegen „eines ganzen Maßnahmenkatalogs“, um „diese Entwicklung korrigieren zu können“. Sie plädieren dafür, dass Behandlungsbedarf und Indikationsstellung „zuverlässiger erfasst und ausgewertet werden“. Und im Anschluss müssten zudem Wirksamkeit und Nutzen der Behandlung objektiv bewertet werden. „Als Basis dafür muss das Behandlungsergebnis analog zum Behandlungsbedarf objektiviert werden“, fordern die Autoren. Ein geeignetes Instrument sei beispielsweise der PAR-Index.
Und das empfehlen die Studienautoren:
Eine weitere Empfehlung lautet, die Anzahl der Frühbehandlungen auf maximal zwei bis vier Prozent zu senken, da diese generell weniger wirksam seien als alleinige Behandlungen im bleibenden Gebiss. „Werte oberhalb von 2 bis 4 Prozent bedeuten höchstwahrscheinlich unnötige Frühbehandlungen und damit Überversorgung“, meinen Braun und Spassov. Auch müsse in Zukunft zuverlässig erfasst werden, wie viele Patienten mit Frühbehandlung direkt im Anschluss eine Regelbehandlung erhalten. Ebenso sollten Behandlungsabbrüche durch die Vergabe einer Gebührennummer nachvollziehbar erfasst werden – und einen Anteil von fünf bis zehn Prozent nicht überschreiten, denn diese seien in den meisten Fällen vermeidbar, „weil sie beispielsweise auf mangelnder Aufklärung [...] beruhen“. Aufgrund der hohen Zahlen an Abbrüchen sollten daher obligatorisch deren Ursachen geprüft und Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Des Weiteren sollte die Behandlungsdauer von bis zu 36 Monaten auf maximal 24 Monate begrenzt werden. Zudem seien die Qualität der Beratung und die Aufklärung der Patienten zu verbessern – beispielsweise durch die obligatorische Aushändigung eines verständlich verfassten Behandlungsplans an die Patienten beziehungsweise Eltern. „Durch dessen Aushändigung vor Behandlungsbeginn könnte mehr Transparenz für die Eltern [...] entstehen“, glauben die Autoren. Außerdem sollten einheitliche Grundinformationen zur kieferorthopädischen Behandlung verwendet werden, deren Inhalte sich am Patientenrechtegesetz und an den internationalen Standards für Patienteninformationen und Entscheidungshilfen orientieren. „Genutzt werden könnte das Methodenpapier von KZBV und BZÄK für die Anforderungen an Gesundheitsinformationen“, regen die Autoren an.
Braun und Spassov plädieren außerdem dafür, die Einzelleistungsvergütung durch ein System objektiv gemessener Diagnosen (KIG-Einstufungen) und objektiver Ergebnisindikatoren (PAR-Index) zu ersetzen. Denn: „Die derzeitige Einzelleistungsvergütung kieferorthopädischer Leistungen in der GKV reizt oft, unabhängig vom gesundheitlichen Bedarf, zur Mengenexpansion und trägt zu dem hohen Verwaltungsaufwand für Praxen und Krankenkassen bei.“ Unterstützend sollte die Forschung über die KFO-Versorgung auf- und ausgebaut werden.