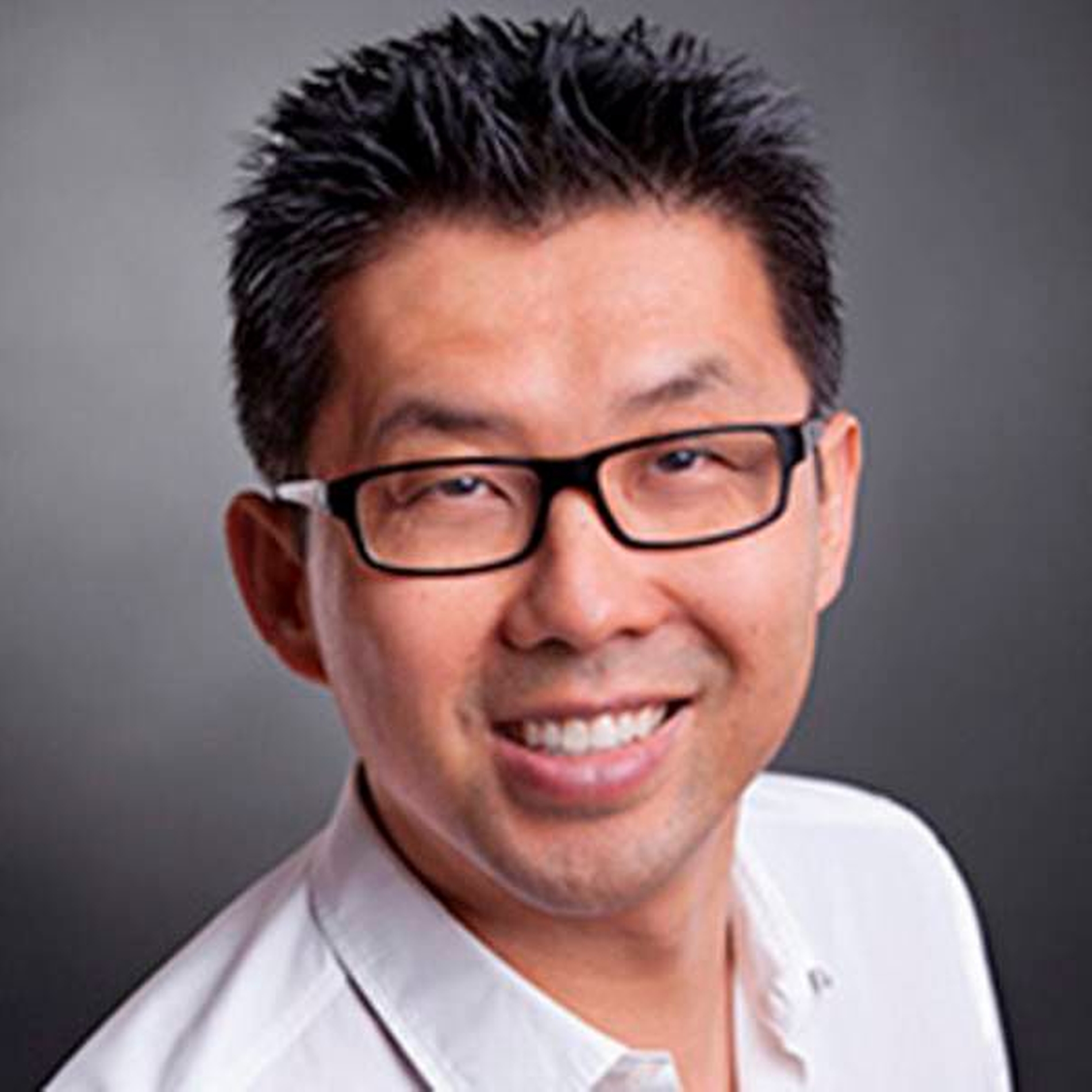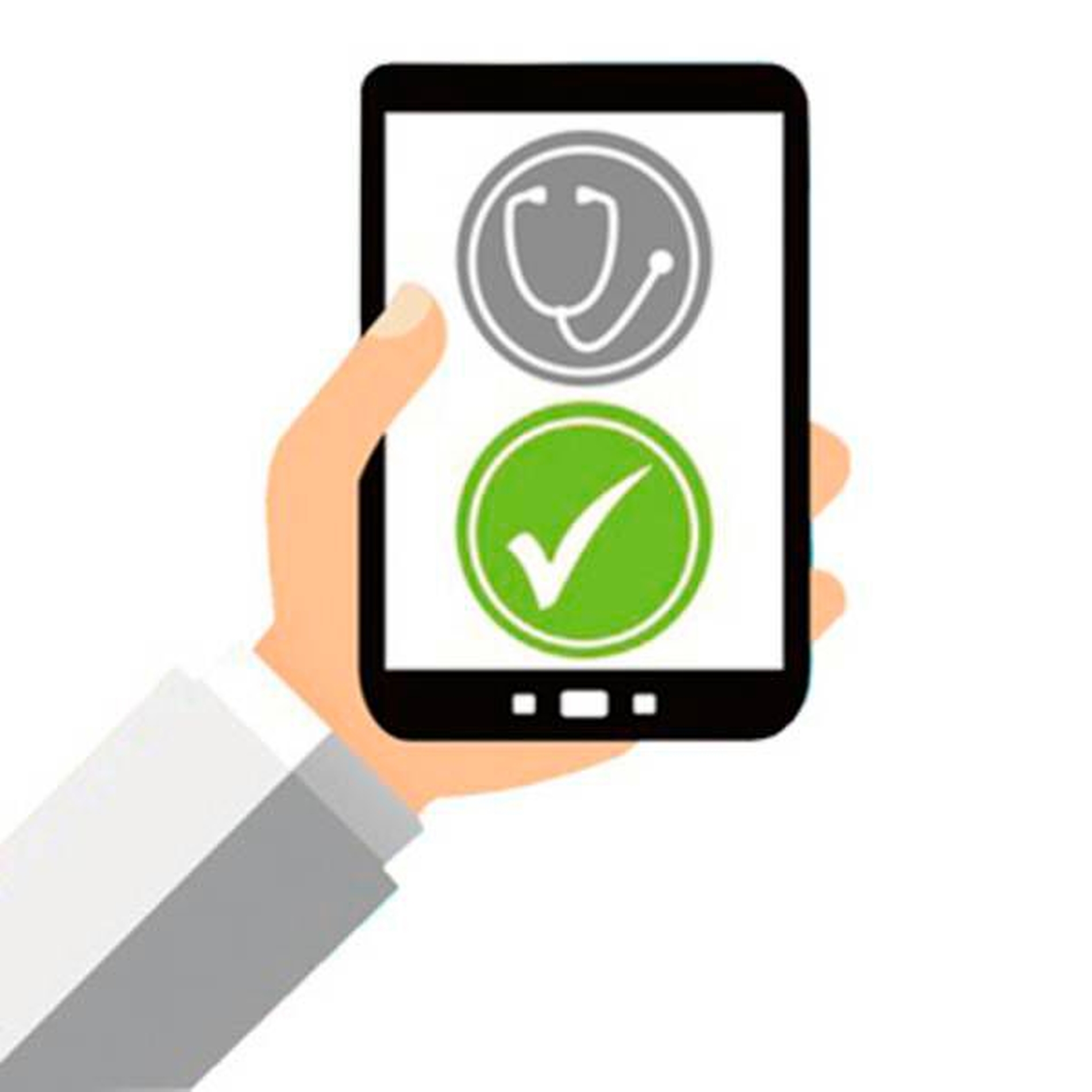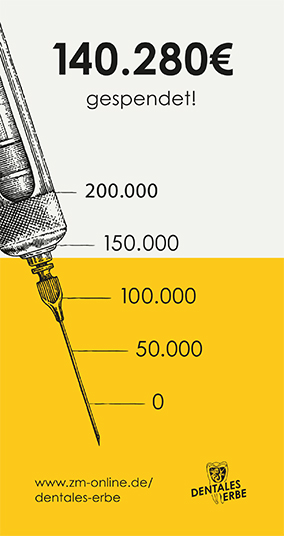Wir sind der Motor!
„Die Zahnärzteschaft begreift die Digitalisierung im Gesundheitswesen als Chance“, stellte der Vorsitzende des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Dr. Wolfgang Eßer, direkt zu Beginn der Klausurtagung klar. „Wir brauchen dieses – sichere! – Netz zur Gegestaltung unserer Zukunft. Und deshalb werden wir die nächsten drei Tage offen und kreativ überlegen, wie wir mithilfe digitaler Prozesse die Versorgung verbessern, die Gesundheitskompetenz stärken, einen gleichberechtigten Zugang sicherstellen, eine sichere Kommunikation schaffen und die Bürokratielast senken können.“
Die Technik-Nerds der Heilberufe
Im November 2017 hatte die Vertreterversammlung der KZBV ein 10-Punkte-Papier zur Digitalisierung herausgegeben – jetzt erfolge die Umsetzung. Eßer: „Innerhalb der Heilberufe gelten wir als die Technik-Nerds. Das stimmt: Die Zahnmedizin ist längst digital. Für mich ein Grund mehr, die Digitalisierung aktiv zu gestalten statt von ihr beherrscht zu werden und am Ende die Lufthoheit abzugeben. Fakt ist auch: Mit Jens Spahn kommen neue Impulse, er promotet das Thema – und er teilt unsere Ansicht, dass das digitale Bonusheft ein Leuchtturmprojekt darstellt. Wir werden die Lufthoheit über unser Berufsfeld auch im Zeitalter 4.0 verteidigen! “
Spiegel-Redakteur Martin U. Müller arbeitet bereits in einer komplett durchdigitalisierten Branche: „Mit der Etablierung des Smartphones am 29. Juni 2007 wurde im Journalismus der Point of no Return überschritten“, erinnerte er sich. „Machen wir uns nichts vor: Die Entwicklung, die die Musik- und die Medienbranche durchlaufen haben, steht nun der Medizin bevor.“ Ein Beispiel: Ähnlich wie die Plattformen Spotify und Netflix Musik und Filme anbieten, stelle neuerdings auch Philips über Lumify die Geräte zur Verfügung – denkbar sei, für die Software-Nutzung Geld zu verlangen. Und auch die großen Vier – Google, Apple, Facebook und Amazon – erschließen sich laut Müller strategisch die Felder der Medizin. „Selbst Automobilhersteller wie Audi investieren in die Sparte: In dem Projekt ‚my audi cares for me‘ arbeiten Forscher an einem selbstfahrenden Auto als genuinem Raum, in dem während der Fahrt Patienten behandelt werden.“ Wohin diese Entwicklungen führen? Müller: „Etwa dazu, dass die Mehrheit der jüngeren Patienten einer TK-Umfrage zufolge bereits lieber von einem Smartphone als von einem Arzt behandelt werden will.“
„Der Mediziner der Zukunft muss nicht zwangsläufig Arzt sein, vielleicht ist er Tele Surgeon oder Medizin-Applikationstechnischer Assistent“, prophezeite der Journalist.
Medizin ist nicht unique
„Fest steht nur: Medizinische Versorgungsangebote müssen heute dort sein, wo der Patient ist.“ Es werde zu einer Entbündelung der Leistungen und zu B2C-Kundenbeziehungen kommen – siehe Philips –, wobei sich dann einige Anbieter die lukrativen Angebote gezielt herauspickten. „Medizin ist nicht unique“, warnte Müller. „Medizin ist allein in Deutschland ein 350-Milliarden-Euro-Markt.“
„Moderne Software darf den Arzt nicht ersetzen, sondern muss ihn ergänzen“, forderte Dr. Dominik Pförringer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Mitglied der AG Versorgungsforschung und Digitalisierung am Klinikum rechts der Isar München. Eine US-Studie lässt hoffen: Danach liegt das Risiko, dass Mediziner ‚wegdigitalisiert‘ werden, bei 10 Prozent. „Wer Digitaliserung schlau einsetzt, hat am Ende mehr Zeit für die Patienen und vergeudet weniger Energie für Bürokratisierung und Dokumentation“, prognostizierte Pförringer.
„Doch spricht die IT nicht mit den Ärzten und vice versa, dann baut man einander vorbei.“ Der Input komme oft aus ganz artfremden Branchen – wie dem Theater. In dem Fall hätten sich die Entwickler von OP-Leuchten (Optimus) die Technik vom Broadway abgeschaut: So wie kein Schatten auf das Gesicht der Schauspieler fallen darf, leuchtet die Lampe im OP dorthin, wo der Operateur gerade tätig ist, das OP-Feld bleibt schattenfrei. Pförringer benennt drei Ebenen der Digitalisierung: 1. die Makro-Ebene (elektronische Gesundheitskarte, (eGK)), 2. die Health Care Professional-Ebene (elektronische Patientenakte (ePA), Telemedizin), 3. die Patientenebene (Wearables, Apps, Portale).
Auf den Driver‘s Seat!
Entscheidend sei: „Jedes System muss ein ‚Mental Override‘ haben, das heißt, wenn es hart auf hart kommt, entscheidet der Mensch und schaltet die Technologie gegebenenfalls ab.“ Pförringers Rat: sich einerseits mit den Kostenträgern gegen die übermächtigen Großinvestoren stellen und andererseits frühzeitig auf junge Start-ups und Hacker zugehen. „Wir müssen auf den Driver‘s Seat, damit nicht Google, Apple, Facebook und Amazon – die sogenannte GAFA – alle Daten bekommen und das Kapital irgendwohin abziehen“, appellierte Pförringer an das Auditorium. „Deren Geschäftsmodell lautet in der Regel: ‚Learning by earning‘!“
Den Workflow in einer digitalisierten Zahnarztpraxis beschrieb Dr. Xaver Wack. Der Münchner Zahnarzt mit Niederlassung in Bogenhausen und Gründer der Gesellschaft für digitale Zahnheilkunde WEEFEX hat 2012 seine Praxis voll digitalisiert. KFO und Implantologie werden seitdem komplett, die Prothetik teilweise digital abgebildet. „Der größte Hemmschuh auf dem Weg zur digitalisierten Praxis ist, dass die Dentalfirmen Schnittstellen-interne Produkte präferieren, keine übergreifenden Lösungen – und dadurch diktieren, wohin es gehen soll“, schilderte Wack seine Erfahrungen. „Die Industrie entwickelt schlichtweg keine Produkte, die mit denen der Konkurrenz korrespondieren.“ Für die Zukunft sei es gleichwohl unerlässlich, die Zahnmedizin weiterhin mit funktioneller analoger Kompetenz zu versehen: „Nur wer analog gelernt hat, kann digital verstehen. Wir dürfen unseren Nachwuchs nicht zu Bedienern von Buttons machen!“
Analog lernen, digital verstehen
Woo-Ttum Bittner, Inhaber und Geschäftsführer von „Adentics – die Kieferorthopäden“ in Berlin, stellte ebenfalls den digitalen Alltag in seiner – kieferorthopädischen – Praxis vor. „Wir versuchen, so viel wie möglich – herausnehmbare und feste Spangen, Aligner sowie die Lingualtechnik – zu scannen, um diese Daten dann digital zu verarbeiten und in gedruckte Module zu überführen“, umriss Bittner den Workflow in seiner Praxis. „Die Basis ist ein intra-oraler Scan.“ Bittner, der die erste KFO-ÜBAG Deutschlands gründete und mittlerweile mit seinen Kollegen über fünf Standorte und ein Labor verfügt – als GbR, nicht als MVZ! – hat auch das gesamte Prozessmangement (Anleitungen und Termine) sowie das QM (Erstberatungs- und Feedback-Umfragen, Apps, Checkliste-Manager, Verbandsbuch, Notfallmanagement) digital aufgesetzt. „Insgesamt 35 Wochenstunden wendet eine Praxismitarbeiterin bei uns allein dafür auf, um die Mitarbeiter im Prozessmanagement auszubilden und zu schulen. Das ist ein Vollzeit-Job!“, betonte er. „Rund 4.500 SOS-Termine fallen in der Praxis im Jahr an, eine erste Einschätzung machen wir anhand von Selfies.“ Seine Bilanz: „Digitale Prozesse haben immer auch einen Haken, und das ist der Mensch. Wir benötigen auch den Menschen 4.0, um digital zu sein.“
Ist die digitale Praxis auch die bessere Praxis? „Man kommt an der Optimierung der Prozessketten nicht vorbei. Und hier wird die digitalisierte Praxis die effizientere sein, weil sie am Ende mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung stellt“, urteilte Martin Hendges, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der KZBV. „Nur müssen wir die Anwendungen proaktiv aus der Praxis heraus entwickeln, denn nur dann ergeben sie am Ende einen Sinn. Wir sind der Motor!“
###more### ###title### Das Smartphone – keine Lösung für alles ###title### ###more###
Das Smartphone – keine Lösung für alles

Bernhard Riedmann_Der Spiegel
Ob die Gesundheitskompetenz des Patienten wirklich steigt, wenn er Einsicht in seine medizinischen Unterlagen hat? Wünscht er wirklich größeren Einfluss? „Beim Datenschutz sollte der Patient auf jeden Fall aktiv der Zweitverwertung seiner Daten zustimmen müssen“, hob Dr. Mario Bolte, Datenschutzexperte der KZBV, hervor. „Das automatische Abfließen halte ich für sehr gefährlich.“ Was die Anwendungen angeht, sollten ihre angeblichen Vorteile auch nachgewiesen werden (müssen). Bolte: „Dass Qualität und Wirtschaftlichkeit erhöht werden, ist eine ständig gehörte, aber nicht belegte Floskel. Die eigentliche Frage ist: Werden die Anwendungen überhaupt genutzt?“ Gefördert werden müssten daher in erster Linie die Kernkompetenzen der Patienten und Ärzte. „Das Smartphone als Lösung für alles ist zu kurz gesprungen“, resümierte er. „Mitgestalten heißt natürlich auch mitarbeiten, und das bedeutet: mehr Kosten, mehr Aufwand, mehr Mitarbeiter!“
Aus ärztlicher Sicht bewertete Dr. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, die Entwicklung. „Telemedizin ist gar nicht so neu“, machte sie klar: „In der maritimen Versorgung wird sie seit 1931auf Schiffen eingesetzt, und zwar nicht ergänzend, sondern als reguläre Behandlung.“ Beispielhaft für aktuelle Erfolgsmodelle stellte sie das Konsiliarsystem zur Schlaganfallversorgung in Sachsen und Bayern vor, das die Mortalität um 10 Prozent verbessert habe. Auch die Videosprechstunde hält sie für eine praktikable und vor allem zukunftsorientierte Lösung: „Mit einem Honorar von 4,21 Euro ist sie für Ärzte allerdings sehr unattraktiv ausgestaltet!“ Wie Anwendungen im Gesundheitswesen als Instrument eingesetzt werden können, etwa, um eine Verhaltensänderung zu bewirken, veranschaulichte sie anhand der Apps: „Fitness-Apps funktionieren bislang als Bonussysteme, können aber auch problemlos zu Malussystemen ausgestaltet werden.“ Empfehlen würde sie daher nur Applikationen, die auch als Medizinprodukt zugelassen sind. „Bei Apps mit Werbung sowie mit Diagnosen und Medikamentenverordnungen beziehungsweise -empfehlungen rate ich zur Vorsicht!“
Die Krankenkassen vertrat Christian Klose vom digitalen Innovationsmanagement der AOK Nordost aus Berlin. „Die AOK hat 26,32 Millionen Kunden“, führte er aus. „Es geht nicht darum, ob wir die Digitalisierung gut finden oder schlecht, sondern, dass wir sie gestalten. Das Gesundheitswesen ist zurzeit noch ein gallisches Dorf, doch die Digitalisierung wird auch diesen Bereich radikal verändern.“
Bislang ein gallisches Dorf
Interessant werden nach seiner Einschätzung die Anwenderszenarien: „Der Kunde möchte alles, von jedem Ort, zu jeder Zeit und aus einer Hand.“ Was aber bedeutet das für die AOK? „Die derzeitige Zerklüftung von Gesundheitsinformationen in Form der Sektorengrenzen sowie der Trennung in allgemeine und Fachärzte hemmt die Versorgung“, deutete Klose das Problem aus Kassensicht. „Eine Plattform auf Basis neuer Standards könnte die Situation verbessern.“ Diese Plattform gibt es Klose zufolge schon: in Form – Überraschung – des digitalen Gesundheitsnetzwerks der AOK. „Wir lehnen eine Insellösung ab, geplant ist eine Interoperabilität mit anderen Lösungen, also ein Anschluss an die TI“, erklärte Klose den AOK-Vorstoß. „Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der die Vernetzung aller Leistungserbringer zum Ziel hat und als offene Plattform, auch für andere Krankenkassen, gedacht ist.“ Die Datenschutz-Standards? Selbstverständlich gewährleistet. „Wir setzen auf die dezentrale Datenhaltung, das heißt, es gibt keine Datenwolke, sondern die Daten bleiben bei den Leistungserbringern“, beschrieb Klose das Projekt und wies nochmals darauf hin, dass die Daten ins Arztnetz gepiegelt würden und ihr Abruf per Link erfolge. Im Rahmen der dezentralen Datenspeicherung halte die AOK drei Server vor, über diese dreifache Kaskadierung – laut Klose die höchste Sicherheitsstufe– sei keine Rückführung der verschlüsselten Daten möglich. Zentral sei nur die Registry, Abfragen könnten nur die Mediziner und der Patient einsehen, die Daten blieben in der Hoheit der Ärzte. In einem Pilotprojekt in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern prüfe die AOK gerade vier Anwendungen: die eMedikation, den eImpfpass, den eNotfallpass sowie das Aufnahme- und Entlassmanagement. Klose: „Wir setzen einen starken Fokus auf die Einbindung der Leistungserbringer, um Anwendungsfälle zu entwickeln. Im Zentrum steht der Patient.“
Ein Poesiealbum für Patienten
Kloses beteuerte freilich, die AOK sehe ihr Modell als Ergänzung, nicht als Konkurrenz zur gematik, überzeugen konnte er die Teilnehmer nicht. „Nicht jedes Angebot ist sinnvoll“, wandte beispielsweise der Vorsitzende der KZV Westfalen-Lippe, Dr. Holger Seib, ein. „Mit der AOK-Akte schaffen Sie eine Parallelstruktur zur TI.“ Auch KZBV-Chef Eßer äußerte Zweifel: „Für mich ist nicht klar, was die AOK-Akte genau darstellt: eine Patientenakte oder ein Patientenfach? Das sieht mir nach einem Poesiealbum für Patienten aus.“
Der AOK-Partnerzahnarzt?
Er frage sich, welche Interessen die Krankenkasse mit diesem Produkt verfolge. Die AOK-Akte biete je nach Nutzer unterschiedliche Ansichten, erwiderte Klose: Für den Arzt sei es eine Patientenakte, für den Patienten die Gesundheitsakte, aber auch – siehe TK-Safe – ein Patientenfach: „Unser Ansatz ist, dass wir alle Anwendungen je nach Zielgruppe bedienen.
Der Mutmaßung Eßers, die AOK wolle die Daten nutzen, um den Patienten zu lenken – etwa mit der Empfehlung zur Zahnbehandlung in Polen – und die freie Arztwahl auszuhöhlen – etwa mit dem Hinweis auf den „AOK-Partnerzahnarzt“ –, widersprach Klose energisch: „Der Datenschutz legt fest, dass der Patient entscheidet, was mit seinen Daten passiert.“
Die Folgen aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umriss schließlich der Mediziner und Jurist Prof. Christian Dierks. Bei der DSGVO als unmittelbar geltendem Recht handele es sich um den größten Gesetzgebungsprozess in der Geschichte der EU. Es gebe zwischen 50 und 60 Öffnungsklauseln für die einzelnen Länder, in denen Ausnahmen und Erleichterungen im nationalen Recht – für Deutschland im neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – zu beschließen seien. „Die Pflichten, die die DSGVO beschreibt, sind nicht neu“, stellte Dierks fest. „Neu ist, dass diese Prozesse jetzt auch dokumentiert werden müssen, das heißt, es reicht nicht aus, die Inhalte einfach nur umzusetzen.“ Mit der Anpassung des Strafrechts 2017 wurde bei der Auftragsdatenverarbeitung der strafrechtliche Schutz auf externe Dienstleister ausgeweitet, erklärte er. Was das für die Praxis bedeutet? „Werden externe Software-Anbieteter die Verarbeitung von Gesundheitsdaten eingebunden, müssen die Beschäftigten zur Verschwiegenheit verpflichtet werden, was in einem Vertrag als Passus festgehalten werden muss.“ Indem die Daten heute mithilfe von Algorhythmen versandt und ausgewertet, werden, entstehen für Dierks neue Bedrohungsszenarien. Das Risiko, das Gesundheitsprofile aus öffentlichen Quellen erstellt werden können, sei indes längst gegeben. „Das heißt, wenn wir im Bemühen, Datenschutzrechtsverletzungen zu begrenzen, die Verfügbarkeit von Daten beschränken, begehen wir nach dem Fehler erster Art den Fehler zweiter Art.“ Der Daten-Storage beim Patienten, beim Endverbraucher sozusagen, sei dagegen vielversprechend – ob zentral in der Cloud oder dezentral spiele keine Rolle: „Maßgeblich ist, dass die Formate definiert werden, damit die Interoperabilität gewährleistet ist“, machte Dierks klar.
Digital Freedom für den Patienten
Die Daten der Patienten würden de facto mittlerweile an vielen Orten gespeichert – was fehlt, ist laut Dierks die Bündelung. „Und wer könnte das besser als der Patient selbst – Stichwort Digital Freedom“, fasste Dierks zusammen. „Patienten müssen in die Lage versetzt werden, über ihre Gesundheitsdaten – Gesundheitsdaten sind heute der wichtigste Rohstoff im Gesundheitswesen – zu verfügen und zu entscheiden, wem sie diese geben.“ Voraussetzung dafür: eine zentrale EU-Datenspeicherstelle.
Die Geschichte des World Wide Web skizzierte Dr. Sebastian Gerling vom Center for IT-Security, Privacy and Accountability (CISPA) der Universität des Saarlandes in Saarbrücken: „1990 hatten wir das langsame Internet, 2000 B2B-Internet und seit 2015 ein nutzerzentriertes Internet mit einer massiv vergrößerten Angriffsfläche, wenig Kontrolle und ohne Überblick.“ Was in der digitalen Welt fehle, sei ein grundlegendes Verständnis von Privacy. „Es mangelt auch an Methoden, um ein nutzerfreundliches Anwenderverhalten zu entwickeln“, zeigte er zudem auf. „Datensicherheit und Digitalisierung bedingen aber einander.“
Ohne IT-Sicherheit werde es seiner Meinung nach nicht weitergehen: „Die Risiken werden zu groß. Das ist wie beim autonomen Fahren: Wenn Sie dreimal trotz Werkstatt-Check mit dem Auto gegen die Wand gefahren sind, lassen Sie den Wagen stehen.“ Fakt sei aber auch: „Eine gute Infrastruktur kostet Geld!“
Der stellvertretende Vorsitzende der KZBV, Dr. Karl-Georg Pochhammer, verglich in dem Zusammenhang die Telematik-Infrastruktur der eGK mit einer Autobahn: „Sie ist die Basis. Raststätten,Tankstellen und Parkplätze – also die Anwendungen – sind variabel. Die Einführung der TI im Gesundheitswesen wird auf jeden Fall kommen, und sie ist auch sinnvoll. Wichtig ist, dass die Straße – das Netzwerk – sicher ist!“
###more### ###title### Noch fehlt die Tankstelle ###title### ###more###
Noch fehlt die Tankstelle
Hendges ergänzte: „Und deshalb bin ich skeptisch, was die Angebote der Krankenkassen angeht, personenbezogene Gesundheitsdaten vorzuhalten.“ Für Eßer bleibt ein immanenter Widerspruch bestehen: „Wir Ärzte denken Datenschutz ja analog: Der Patient vertraut uns, weil er seine Daten bei uns für absolut sicher wähnt. Und jetzt beginnt ein neues Zeitalter: Wir machen Medizin und haben Schnittstellen zu Systemen, denen wir nicht vertrauen können.“ Der mündige Patient ist für ihn bislang ein eher theoretisches Konstrukt: „20 Prozent der Menschen verstehen Gesundheitsinformationen selbst in in einfacher Sprache nicht“, erinnerte Eßer und fügte hinzu: „Und 60.000 Zahnärzte verschicken Patientendaten per E-Mail. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft so eine große Lücke! Vielleicht bedarf es ethischer Grundsätze in der digitalen Gesundheitswelt, damit die Menschen wissen, dass ihre Daten sicher sind!“ ck
Die Gesundheitsakte „Vivy“
Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung in das Thema „elektronische Patientenakte“. Im März hatte die AOK in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ärztenetzwerk Haffnet eine vorerst noch lokale und auf das Entlassmanagement beschränkte digitale Patientenakte vorgestellt. Im April folgte die TK mit ihrer mit IBM entwickelten Gesundheitsakte „TK-Safe“, die bereits vom Start weg weit umfangreichere Funktionen als die AOK-Lösung mitbringt. Jetzt zieht eine Gruppe aus über 90 gesetzlichen Betriebs-, Ersatz- und Innungskrankenkassen plus einiger privaten Krankenversicherungen nach: An der neuen Gesundheitsakte „Vivy“, die am 5. Juni in Berlin präsentiert wurde, beteiligen sich von privater Seite unter anderem die Allianz PKV, die Barmenia, die Gothaer und die Süddeutsche Krankenversicherung.
Dabei wird Vivy nicht von den Kassen selbst betrieben, sondern von der Vivy GmbH mit dem Gründer-Geschäftsführer Christian Rebernik an der Spitze. Gesellschafter der Vivy GmbH sind Rebernik (30 Prozent) und die Allianz SE als Finanzinvestor (70 Prozent). Teilnehmende Kassen zahlen an Vivy pro Mitglied und stellen ihren Versicherten die Vivy-App bereit.
Mit der App können medizinische Daten und Dokumente gespeichert und verwaltet – etwa der Medikationsplan gescannt und gelesen – werden. Medikamente lassen sich hinzufügen, indem man den Barcode der Packung scannt – die App prüft dann das gescannte Mittel auf mögliche Wechselwirkungen mit bereits im Medikationsplan vorhandenen Präparaten. Viele Funktionen sind aus anderen Apps bekannt – zum Beispiel das Erstellen und Verwalten eines Impfplans und der Recall für Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Außerdem können nicht nur zwei-, sondern auch dreidimensionale Röntgenaufnahmen importiert werden – die App beherrscht das DICOM-Format.
Die Vivy-App soll nach dem Willen der Betreiber aber nicht nur eine eGesundheitsakte, sondern auch eine „digitale Assistentin“ in der patienteneigenen „Gesundheitswelt“ sein: Sie kann Trackingdaten von Fitness-Apps einspielen und gibt auch ein Feedback zum Lebensstil. Wer einen „wissenschaftlich fundierten Gesundheitscheck“ durchführt, erhält eine persönliche Auswertung für die Bereiche „Körper, Ernährung, Bewegung und Geist“, versichern die Vivy-Macher. Zudem wird basierend auf den Blutwerten das biologische Alter berechnet.
In puncto Datensicherheit arbeitet die App mit einem System aus öffentlichem und privatem Schlüssel – ohne den privaten Schlüssel des Versicherten lassen sich die Daten nicht lesen. Das stellt sicher, dass die Daten nur vom Nutzer am Endgerät gelesen werden können. Hinzu kommt noch eine zusätzliche Zwei-Faktor-Authentifizierung durch eine Gerätekopplung. Vivy wurde vom TÜV Rheinland und dem Unternehmen ePrivacy als sichere Plattform zertifiziert. Die verschlüsselten Daten des Versicherten werden in einem deutschen Rechenzentrum gespeichert. Geht das Endgerät verloren, können die Daten nur noch mit dem privaten Schlüssel des Nutzers durch Kopieren vom Server auf einem neuen Gerät wiederhergestellt werden. Hat der Nutzer den Schlüssel nicht, sind die Daten unwiederbringlich verloren.
Wie auch schon TK-Safe setzt auch Vivy auf den Patienten als Herrn seiner Daten. Allein er soll bestimmen, ob und inwieweit er die Gesundheitsakte nutzen will. Diese Philosophie unterscheidet sich deutlich von zentralistisch organisierten „fürsorgenden“ Systemen – wie das dänische Gesundheitsportal Sunhed.dk) – die gelegentlich als Vorbild für Deutschland diskutiert werden und ohne Zustimmung des Patienten Daten zusammenführen und den Heilberuflern zur Verfügung stellen.
Kommmentar
gematik unter Druck
Die Vorstellung der von Kassenseite initiierten Gesundheitsakten-Projekte setzt nun die gematik unter Handlungsdruck. Am 4. Juni berichtete die Ärztezeitung, dass gematik-intern der erste Entwurf einer elektronischen Patientenakte vorliege. Anders als es sich AOK und TK gewünscht hatten, seien deren Akten aber nicht mit der gematik-Akte kompatibel, was auch auf die neue Vivy-Akte zutrifft. Aus Sicherheitsgründen lehne die gematik die Anbindung der Kassenakten ab, berichtete die Ärztezeitung. Bleibt es bei dieser Haltung, sind Konflikte vorprogrammiert.
Hier tut sich die grundsätzliche Frage auf, ob es der gematik gelingen wird, der drohenden Fragmentierung von Gesundheitsaktenangeboten ein überzeugendes, übergreifendes Konzept entgegenzustellen. Aus Sicht der Ärzte und Zahnärzte ist das zweifellos wünschenswert, denn es wäre alles andere als effizient, wenn die Heilberufler ihre Dokumente je nach Patient in immer neue Gesundheitsakten auf jeweils unterschiedlichen Wegen samt Authentifikations- und Anmeldeprozeduren übertragen sollen. Die Selbstverwaltung von Ärzten, Zahnärzten und Apothekern hat sich daher im Januar 2018 in einer gemeinsamen Absichtserklärung „für deutschlandweit einheitliche Standards und Schnittstellen“ bei der elektronischen Patientenakte ausgesprochen.
Benn Roolf
Glossar
Elektronische Gesundheitskarte (eGK)
Die eGK hat die Krankenversichertenkarte abgelöst (§ 68 SGB V). Bisher wurde als neue Funktion lediglich das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) eingeführt, das online die Aktualität der Versichertenstammdaten wie beispielsweise Adressdaten auf der Karte abgleicht und automatisch aktualisiert, ohne dass die Karte ausgetauscht werden muss. Als weitere Anwendungen sind der elektronische Medikationsplan (eMP) und die elektronische Patientenakte (ePA) geplant.
Elektronische Patientenakte (ePA)
Auf der eGK soll es künftig möglich sein, eine ePA einzurichten (§ 291a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 5 c), in der wichtige medizinische Daten abgelegt sind. Wichtig ist, dass der Patient selbst darüber bestimmen soll, welche Daten gespeichert beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden dürfen und welche nicht. Zurzeit spezifiziert die gematik die Ausgestaltung gemäß E-Health-Gesetz: Die Frage ist: Wird ein Datenzugriff nur erlaubt sein, wenn der elektronische Arztausweis und die eGK in das Lesegerät gesteckt werden, oder kann der Zugriff auch unabhängig erfolgen?
Elektronische Gesundheitsakte (eGA)
Krankenkassen können selber die Nutzung einer von Dritten angebotenen eGA gegenüber ihren Mitgliedern finanziell fördern (§ 68 SGB V). Voraussetzung ist, dass die eGA das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten über Befunde, Diagnosen, Therapien, Behandlungsberichte sowie Impfungen für eine fall- und einrichtungsübergreifende Dokumentation über den Patienten unterstützt.
Elektronisches Patientenfach (eFA)
Ziel ist, dass Patienten ab 2019 auf ihren Wunsch auch eigenständig auf ihre medizinischen Daten zugreifen können (§ 291 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 SGB V). Dazu werden Daten der ePA als freiwillig nutzbare Anwendung auf der eGK in das Patientenfach gespiegelt. Patienten sollen aber auch eigene Daten und Dokumente, wie ein Patiententagebuch, Blutzuckermessungen oder rezeptfreie Arzneimittel einstellen können.
Die gematik
Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) in Berlin wurde 2005 von den Spitzenorganisationen im Gesundheitswesen gegründet. Ihre Aufgabe ist die sichere, sektorenübergreifende, digitale Vernetzung des Gesundheitswesens. Sie trägt die Verantwortung für die Telematikinfrastruktur (TI). Bis 2019 soll sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Patientendaten in einer einrichtungsübergreifenden ePA bereitgestellt werden können.