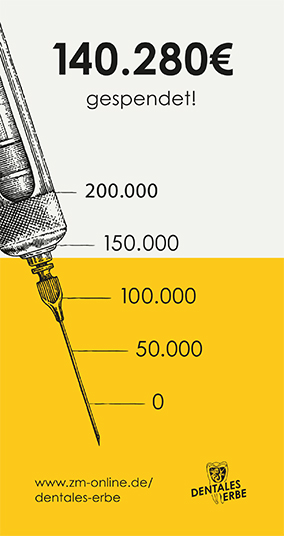„Gesunde Apps auf Rezept!“
Im Juli hat das Bundeskabinett den von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegten Entwurf für ein „Digitale Versorgung-Gesetz“ (DVG) beschlossen: Ab 2020 dürfen – und sollen – Ärzte ihren Patienten Gesundheits-Apps verschreiben. Wichtig ist Spahn dabei, dass die digitalen Angebote schnell und sicher in die Versorgung kommen und sich dort – im Realitätscheck – beweisen. „Gesunde Apps auf Rezept“, wie er knackig formulierte.
Ein Sammelsurium von Produkten
„Die“ Gesundheits-App ist ein bunter Strauß verschiedener Produkte. Was sie verbindet ist nur, dass es sich um Software-Programme handelt, die üblicherweise auf dem Smartphone installiert werden, einen Zugang zum Internet benötigen und das Ziel haben, Menschen bei der Erkennung und Behandlung von Krankheiten zu unterstützen oder ihnen eine gesundheitsförderliche Lebensführung zu vermitteln.
Dementsprechend bieten sie dem Nutzer unterschiedlich viel. Die einfacheren informieren – vergleichbar mit einer Broschüre – über gesunde Lebensweise oder chronische Krankheiten. Viele Apps für chronisch Kranke bieten Module zur Verlaufskontrolle. Patienten, die bisher Papier-Vordrucke zum Eintragen ihrer Werte benutzen, können dies in Zukunft mit dem Smartphone erledigen. Für Diabetiker gibt es zum Beispiel „DiabetoLog“, für Migräne-Patienten „Kopfschmerztagebuch“ und für Hochdruck-Patienten „Cora Health“. Per Handy kann man Daten mit einem Klick an den behandelnden Arzt schicken oder aktuelle Verläufe und Durchschnittswerte ermitteln. Die Apps geben selbst auch Feedback: Man erhält bunte Smileys, wenn die Werte gut sind. Anders als Print-Materialien werden Apps auf Wunsch auch aktiv, etwa indem sie Anwender an die Medikamenteneinnahme (zum Beispiel „mediteo“: Tablettenerinnerung), an Impfungen oder an den nächsten Check-up erinnern (zum Beispiel „AOK Vorsorge“). Gesunde und Kranke können sich mit der App „Runtastic“ zum Joggen oder durch „Freeletics Nutrition“ zur gesunden Ernährung motivieren lassen. Wer unter Rückenschmerzen leidet, lässt sich digital an die Pause vom Bildschirm erinnern, etwa mit „Büro Yoga“, über den aktuellen Pollenflug informiert „Pollenflug-Gefahrenindex“.
Komplexe Entwicklungsarbeit steckt in Apps, die Symptome erfragen und Antworten auf Grundlage von validiertem medizinischem Wissen geben, in der Regel also Vorschläge für Diagnosen generieren: Bei „Ada“, „Babylon“ oder den geplanten Triage-Apps von Klinikketten ist Künstliche Intelligenz (KI) am Werk. Hier stellen Chatbots („textbasierte Dialogsysteme“ (Wikipedia)) dem Anwender gezielt Fragen und werten die Antworten aus. Sie können – je nach hinterlegtem Wissenshintergrund – tatsächlich hochwertige Ergebnisse liefern. Längst wird der Einsatz solcher Apps in Notaufnahmen diskutiert, damit Patienten ohne Hilfe von Ärzten eine Vor-Anamnese erstellen können, idealerweise in ihrer Muttersprache. Auf Basis des Ergebnisses entscheiden dann Mitarbeiter der Notaufnahme über die Dringlichkeit des Arzt-Kontakts.
Auch Ärzte können vom digitalen Kollegen profitieren: Eine Studie zeigte kürzlich, dass die KI in der Diagnostik von Vorhofflimmern erfahrenen Kardiologen überlegen war – und es gibt weitere Beispiele, etwa aus der Radiologie.
Welche Apps gehören zu den guten?
Am Beispiel der „Gesundheitshelferin Ada“ lässt sich das Potenzial guter Gesundheits-Apps erahnen. Die App der Ada Health GmbH ist bereits weltweit im Einsatz: Der Anwender beschreibt sein gesundheitliches Problem und Ada fragt gezielt nach. Anschließend stellt die App zwar keine Diagnose, informiert aber über wahrscheinliche Ursachen für die Beschwerden. So kann der besorgte Nutzer besser einschätzen, ob seine Beschwerden tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme sind.
Ada wurde in Kooperation mit medizinischen Hochschulen entwickelt und basiert auf einer Datenbank mit Medizin-Wissen, das Milliarden von Symptomkombinationen abdeckt. Die diagnostische Treffsicherheit ist hoch. Die Software wurde nach Firmenangaben bisher weltweit über acht Millionen Mal heruntergeladen, in Deutschland knapp eine Million Mal. Das Start-up mit Büros in Berlin, München, London und New York hat inzwischen mehr als 200 Mitarbeiter und Finanzmittel in Höhe von 60 Millionen Dollar. Ada steht in über 130 Ländern bei den medizinischen Apps an erster Stelle und hat bereits Verträge mit Krankenversicherungen. Die Firma hat verschiedene Preise erhalten, etwa 2018 den Health-i-Award, ein Preis für Innovationen im Gesundheitswesen, der von der Techniker Krankenkasse (TK) und dem Handelsblatt unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers verliehen wird.
GKV-Leistungskatalog: Der Preis spielt keine Rolle
Gesundheits-Apps gibt es zwar schon seit Jahren, aber mit dem DVG wird die Gesetzliche Krankenversicherung die Kosten dafür übernehmen. Über die Zulassung entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das als selbstständige Bundesoberbehörde zum Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) gehört. Die Apps gelangen damit in den Leistungskatalog der Krankenkassen – ohne dass deren Preis eine Rolle spielt. Ob „Mondpreise“ die Folge sind, wie etwa der Linken-Gesundheitspolitiker Achim Kessler fürchtet?
Für die Abgabe sind zwei Wege vorgesehen: Entweder der behandelnde Arzt verschreibt die Gesundheits-App oder die Krankenkasse genehmigt sie dem Versicherten. Und die Kassen sind in aller Regel sehr engagiert: So ist etwa die TK vom Nutzen digitaler Gesundheitsanwendungen überzeugt, positive Ergebnisse ließen sich bereits feststellen: „Eine Studie zur TK-Migräne-App hat gezeigt, dass die Nutzung der App Kopfschmerztage reduziert. Wer die App nutzt, leidet durchschnittlich rund drei Tage im Monat weniger unter Kopfschmerzen als ohne App-Nutzung“, teilt die TK mit.
Gesundheits-Apps sind oft Teil eines Pakets, das auch individuelle Coaching-Ansätze beinhaltet. So stehen im Diabetesprogramm „mySugr“ aus der Roche-Familie ausgebildete und zertifizierte Diabetesberater für ein digitales Coaching zur Verfügung. Ein anderes Beispiel ist die preisgekrönte App „Tinnitracks“, die im Rahmen von Selektivverträgen mit HNO-Ärzten von vielen Krankenkassen angeboten wird und eine Videosprechstunde enthält.
Auf der Überholspur in den Markt
Der Arzt darf nicht irgendeine Software verordnen. Laut DVG soll das BfArM die Spreu vom Weizen trennen. Auf Antrag des Herstellers prüft das Bundesinstitut Gesundheits-Apps auf Sicherheit, Funktion und Qualität, Datenschutz und Datensicherheit. Für die Hersteller wurde im Gesetz ein zügiger Zulassungsweg geschaffen, der „Fast Track“: Ein Jahr lang können digitale Gesundheitsanwendungen auch ohne Nutzennachweis in die Versorgung aufgenommen werden. So gelangen sie quasi auf der Überholspur in den Markt. Erst danach müssen die Softwareschmieden Belege für eine verbesserte Versorgung durch ihre Apps liefern. Ein Weg, um die Apps schnell in den Markt zu schieben und um digitale Innovationen aus Deutschland anzukurbeln.
Eine großes Thema bei der Anwendung von Apps ist der Datenschutz. Die meisten Apps für Menschen mit chronischen Krankheiten geben nicht nur Verhaltensempfehlungen, sie sammeln auch Patientendaten. Und das müssen sie sogar, wenn sie den Nachweis erbringen sollen, dass sie die Versorgung verbessern. Der Anwender wird normalerweise aufgefordert, aktuelle Daten einzugeben: Namen, E-Mail-Adresse und regelmäßig individuelle Messwerte wie Blutzucker, Blutdruck oder Migräne-Häufigkeit, eventuell in Kombination mit Schlaf, Ernährung oder Stress. Juristisch betrachtet sind die gesammelten Gesundheitsdaten personenbezogene Daten mit besonderer Sensibilität. Das Sammeln, Verarbeiten und Nutzen ist nur zulässig, wenn die Betroffenen nach entsprechender Information eingewilligt haben.
Der Datenschutz fängt vor der Cloud an
IT-Experten diskutieren nicht nur die Frage, ob und wie sich die gesammelten Daten in einer Cloud gegen Eindringlinge schützen lassen. Der Datenschutz fängt für sie schon früher an. So lassen sich bereits aus dem Download einer Gesundheits-App Schlüsse auf den Anwender ziehen. „Gerade im medizinischen Bereich ist es besonders wichtig, dass sensible persönliche Daten nicht in falsche Hände geraten oder manipulierbar sind, weil sie vereinzelt zu schwach oder unverschlüsselt übertragen werden“, erklärt Prof. Dr. Christoph Friedrich. Er hat am Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund ein studentisches Forschungsprojekt zur Sicherheit von medizinischen Apps begleitet. Anwendern rät er, einen genauen Blick in die Datenschutzbedingungen zu werfen und zu prüfen, welche Rechte dem Nutzer eingeräumt werden. „Wir haben festgestellt, dass die meisten Apps mit einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Server von unterschiedlichen Betreibern kommunizieren“, sagt Friedrich und warnt vor Trackingdiensten, die zu Werbezwecken Dritte über die Installation informieren.
Die Softwarefirmen können übrigens nicht nur die persönlichen Daten von Patienten sammeln. Auch die Verordner geben ja schließlich ihre eigenen Daten ein. Auch sie müssen sich fragen, wohin diese gelangen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab, dass 79 Prozent von 24 untersuchten Mediziner-Apps die Daten der Nutzer nicht für sich behielten, sondern diese mit bis zu vier weiteren Teilnehmerkreisen teilten.
Ärzte, die künftig eine Gesundheits-App verordnen, müssen sich darauf verlassen können, dass bei der Verschreibung Datenschutz und Datensicherheit – wie im Gesetz beschrieben – durch das BfArM geprüft und gewährleistet sind. Aber wie sieht die Situation aus, wenn der Hersteller seine Software per Update aktualisiert? Ist der Arzt verantwortlich für die Datensicherheit der von ihm verordneten Produkte? Aus dem BMG heißt es zu dieser Frage: „Die Regelung des § 139e Abs. 6 SGB V sieht vor, dass die Hersteller digitaler Gesundheitsanwendungen wesentliche Änderungen am Produkt unaufgefordert gegenüber dem BfArM anzeigen müssen. Das BfArM prüft dann, ob eine Streichung der digitalen Gesundheitsanwendung aus dem Verzeichnis oder eine Anpassung der Informationen im Verzeichnis zu erfolgen hat.“
Vorgesehen ist, dass das BfArM ein Verzeichnis aller erstattungsfähigen digitalen Gesundheitsanwendungen führt. Dieses DiGA-Verzeichnis soll im Bundesanzeiger bekannt gemacht und im Internet veröffentlicht werden – eine Positivliste, die die Beratung von Patienten erleichtern dürfte. „Darüber hinaus“, so eine BMG-Sprecherin auf Nachfrage, „können die gesetzlichen Krankenkassen ihre Versicherten über die Versorgung mit digitalen Angeboten informieren. Das betrifft nicht nur Anwendungen, die über das BfArM erstattungsfähig werden, sondern auch kassenindividuelle Angebote von Herstellern, mit denen die jeweilige Krankenkasse Einzelverträge abgeschlossen hat.“ Auch die Kassen können also in die Entwicklung von Gesundheits-Apps einsteigen und – in den Grenzen des Heilmittelwerberechts – für ihre Produkte werben.
Nicht ohne Risiko und Nebenwirkungen
Wie es bei der Verschreibung von Apps konkret weitergehen soll und welche Apps überhaupt in die Positivliste aufgenommen werden, ist noch offen. Fest steht: Auch die Apps sind nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen.
Ruth Auschra
Freie Journalistin, Berlin
Das Digitale Versorgung-Gesetz
Das Bundeskabinett hat am 10. Juli 2019 den Entwurf für ein Digitale Versorgung-Gesetz (DVG) beschlossen. Unter anderem sollen Ärzte künftig digitale Anwendungen wie Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck verschreiben dürfen. Damit Patienten die Apps schnell nutzen können, soll für die Hersteller ein zügiger Zulassungsweg geschaffen werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) prüft in einer ersten Stufe Sicherheit, Funktion, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit der Produkte. Die Apps werden dann ein Jahr lang von der Krankenkasse erstattet. In dieser Zeit muss der Hersteller nachweisen, dass die App die Versorgung verbessert. Das Gesetz soll ab Herbst im Bundestag beraten werden und Anfang 2020 in Kraft treten.
Der „Health Innovation Hub“
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Digitalisierung mit viel Energie vorantreiben. Das zeigt sich zum Beispiel an der Arbeit des „Health Innovation Hub“. Diese im April vom BMG aufgestellte Expertengruppe berät Start-ups auf dem Weg von der Entwicklung bis in die Versorgung. Sie informieren Softwarefirmen zum Beispiel im Rahmen von Roadshows oder führen sogenannte Hackathons durch, Programmier-Wettkämpfe für Software-Entwickler.
Gesundheits-Apps in der Zahnmedizin
In der Zahnmedizin werden vor allem Apps für Kinder entwickelt: Sie sollen mithilfe von Apps zum richtigen und regelmäßigen Zähneputzen motiviert werden, Stichwort „Gamifikation“, so dass aus der Routine ein Spiel, ja ein Event wird.
So hat etwa das Start-up Playbrush Apps entwickelt, mit denen Kinder beim Zähneputzen Monster besiegen oder Bilder malen können. Die Kinder sollen dabei die Anwendung der KAI-Methode lernen. Nur wer richtig putzt, hat Erfolg bei der Monsterjagd. Im Hintergrund werden die Bewegungen detailliert ausgewertet, so dass Eltern „den Putz-Fortschritt des Nachwuchses nachvollziehen und gegebenenfalls unterstützen können“. Das Unternehmen wirbt auch mit einem Bonusprogramm, bei dem man Punkte für jede Putzeinheit sammelt, die später ausgezahlt oder gutgeschrieben werden können.