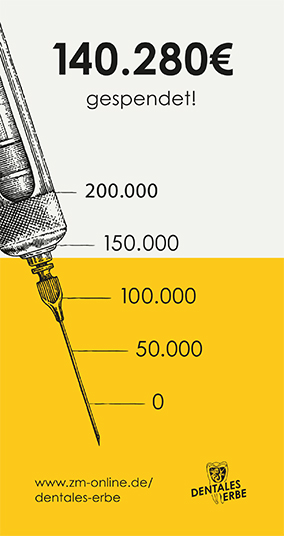Von den „Trümmergesichtern“ zum Fachzahnarzt
Der österreichische Publizist Karl Kraus (1874–1936) schrieb 1916 folgenden Satz in seiner satirischen Zeitschrift „Die Fakel“ nieder: „Ja, das Gesicht dieser Welt wird eine Prothese sein!“ [Fackel, 1916:120]. Und er sollte Recht behalten. Die erschreckende Bilanz des Krieges lautete: Abermillionen Opfer, die unter der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ [Ilken, 2018; Eckhart/ Gradmann, 2003] entweder ihr Leben verloren hatten oder als psychisch Zerrüttete und physisch Versehrte ein Leben lang unter den Folgen eines erbarmungslosen Krieges zu leiden hatten. Die große gesellschaftliche und vor allem medizinische Herausforderung der Nachkriegszeit bestand darin, die ein- oder mehrfach Amputierten, die Kriegsblinden und Gesichtsversehrten, die Gelähmten oder die sogenannten „Kriegszitterer“ einer entsprechenden sozialpolitischen und medizinischen Versorgung zuzuführen [Eckhart/Gradmann, 2003; Ilken, 2018].
Während und nach dem „Großen Krieg“ kam es zu einer Politisierung und Polarisierung der körperlich Traumatisierten. Vor allem die entstellten Gesichter – oder um es mit den Worten der Zeit zu sagen: die „zerzausten Visagen“ – avancierten bald zum absoluten Negativsymbol eines aus deutscher Sicht schmachvoll verlorenen Krieges. Oder wie es der US-amerikanische Kulturwissenschaftler Daniel McNeill (1947–2017) formulierte: Unser Gesicht verleiht uns eine Identität – eine gesellschaftliche Identität. Diese Identität ist dabei übersituativ konstruiert und entscheidet über unsere soziale Existenz; unser Dasein als Mensch, als Gesellschaft. Die „Trümmergesichter“ [Mohi-von Känel, 2018:118] des Ersten Weltkriegs wirkten als Bild eines in „die Heimat zurückgekehrte[n] Schlachtfelde[s]“ [ebd.].
Aus Scham oder Entsetzen über das eigene Aussehen verbargen sich viele Gesichtsversehrte vor dem Blick der Öffentlichkeit in den zahlreichen Lazaretten für Gesichtsversehrte. Was einem beim Anblick eines im Ersten Weltkrieg Gesichtsversehrten wiederfuhr, versuchte der Journalist Erich Kuttner (1887–1942) im Jahr 1920 bei einem Besuch in einem Berliner Lazarett für Gesichtsversehrte in Worte zu fassen:
„[I]ch starre in ein kreisförmiges Loch von der Größe eines Handtellers, das von der Nasenwurzel bis zum Unterkiefer reicht. Das rechte Auge ist zerstört, das linke halb geschlossen. Während ich mit dem Mann rede, sehe ich das ganze Innere seiner Mundhöhle offen vor mir liegen: Kehlkopf, Speiseröhre, Luftröhre, wie bei einem anatomischen Präparat [...]. Aber was ist das für ein seltsam behaarter Fleischklumpen, der lose an ein paar Sehnen und Bändern wie ein Glockenklöppel in dem Hohlraum pendelt? Man erklärt es mir: eine verunglückte Nase [...]“ [Kuttner, 1920].
Nach Angaben des „Sanitätsberichts über das Deutsche Heer (Deutsches Feld- und Besatzungsheer) im Weltkriege 1914/1918“ (1935) erlitten alleine auf deutscher Seite 48.836 Soldaten Kiefer- und Gesichtsverletzungen. Damit handelte es sich also nicht um Einzelfälle [Angerstein, 1932; Ruff, 2015:38]. Aber worauf ging dieses neue Verletzungsbild zurück? Und wie gestaltete sich die medizinische Spezialversorgung?
Neue Waffen führten zu neuen Verletzungen
Die Verwendung neuer Waffentechnologien führte zu neuen Verletzungsmustern. Dazu gehörten Maschinengewehre und mit Schrapnell gefüllte Artilleriegranaten. Diese verursachten im „Grabenkrieg“ des Ersten Weltkriegs verheerende Verwundungen [Ruff, 2015, 37; Vollmuth/Zielinski, 2014; Thoss, 2009; Zabecki, 2014]. So lagen die primären Verletzungsmuster der Soldaten in den Schützengräben im Bereich der Brust, der oberen Extremitäten und im Kopf- und Halsbereich. Folgt man den Angaben des „Sanitätsbericht über das Deutsche Heer“ verstarb fast die Hälfte aller gefallenen Soldaten an ihren Kopfverletzungen. Von den „behandelten Verwundeten“ erlitten 14,4 Prozent Kopfverletzungen [Vollmuth/Zielinski, 2014; Sanitätsbericht, 1934].
Der Stahlhelm brachte nur bedingt Vorteile
Auch die Entwicklung und Einführung des Stahlhelms durch den Berliner Ordinarius für Chirurgie August Bier (1861–1949) und den Ingenieur Friedrich Schwerd (1872–1953) im Jahr 1916 führte nur bedingt zu einer Verbesserung: So konnte der Stahlhelm in vielen Fällen eine tödliche Hirnschädel- oder Gehirnverletzung verhindern, gleichzeitig stieg aber der Anteil der Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen. Das heißt „die zuvor durch die Vergesellschaftung mit letalen Verletzungen klinisch irrelevanten[en]“ [Vollmuth, Zielinski, 2014] Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen traten nun erst in Erscheinung.
Auch einige medizinisch-naturwissenschaftliche Innovationen der Zeit, wie die Implementierung der Konzepte von Asepsis und Antisepsis, die Einführung von (Lokal-)Anästhesieverfahren und die Entwicklung erster antibakterieller Therapien trugen dazu bei, dass einige Soldaten mit verheerenden Gesichtsverletzungen überlebten [Ilken, 2018; Krischel/Nebe, 2022]. In der Folge stieg der spezifische Versorgungsbedarf. Die Mehrzahl der Verletzungen bildeten Schussverletzungen des Kiefers. Um eine auf dem Stand der Zeit bestmögliche Versorgung der Gesichtsversehrten zu erzielen, kooperierten im Krieg Chirurgen und Zahnärzte [Schröder, 1920].
Düsseldorfer Lazarett für kieferverletzte Soldaten
Während die Versorgung der Verwundeten im Ersten Weltkrieg durch Feldlazarette und die nachgelagerten Kriegslazarette erfolgte, benötigte man im Fall der gesichts- und kieferverletzten Soldaten entsprechende Sonderlazarette, die mit einer kieferchirurgischen Station ausgestattet waren [Ganzer, 1943; Müllerschön, 2014:37–40; Vollmuth/Zielinski, 2014]. In Düsseldorf bestand ein solches Kieferlazarett in der Sternstraße 29–33 in der Privatpraxis des Zahnarztes Christian Bruhn (1868–1942). 1908 hatte der nicht promovierte Bruhn eine Dozentur für Zahnmedizin an der neu gegründeten Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin erhalten, 1911 erhielt er dort eine Professur [Halling, 2017:46].
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte Bruhn nicht nur seine Praxisräume und die angrenzenden Wohneinheiten kostenlos zur Verfügung, sondern ebenfalls seine fachliche Expertise, die vor allem im Bereich der durch betriebliche Arbeitsunfälle erworbenen Gesichts- und Kieferverletzungen lag [Geister, 2004: 48–49,65]. Aufgrund des wachsenden Platzbedarfs musste das Lazarett sukzessive erweitert werden [Bruhn, 1916:8–20; Geister, 2004:64–73; Ruff, 2015:37]. So avancierte das Düsseldorfer Kieferlazarett, neben dem von dem Zahnmediziner Hugo Ganzer (1879–1960) zwischen 1915 und 1923 geleiteten Berliner Speziallazarett für Gesichtsverletzte an der Kunsthochschule Charlottenburg, zu einem der reichsweit bedeutendsten Standorte zur Behandlung von kieferversehrten Soldaten [Gohritz et al., 2004,; Hoffmann-Axthelm, 1995:100]. Es umfasste schließlich fünf Abteilungen mit 650 Betten, ein 28-köpfiges interdisziplinäres Team aus Zahnärzten, Chirurgen, Internisten, Neurologen, Ophthalmologen und Otorhinolaryngologen sowie zahlreiche Pflegende. Bis Kriegsende behandelte man im Düsseldorfer Lazarett über 5.000 Patienten [Jonczyk, 1999:10–11]. Zu den häufigsten durchgeführten zahnärztlichen Maßnahmen zählten die Wiederaufrichtung des zertrümmerten Kiefergerüsts, die Festhaltung der richtiggestellten Kieferbrüche, die Bekämpfung der Kieferklemme, gesichtsorthopädische Maßnahmen sowie das Einsetzen von Prothesen [Bruhn, 1916:44–46].
Was sich hier so nüchtern darstellt, gestaltete sich in der Praxis für die Ärzte- und Zahnärzteschaft oftmals als experimentelle Versuchsreihe. So bot das „neue Material“ [Joseph, 1917, zitiert nach Ruff, 2015:40] die Möglichkeit nicht nur neue Behandlungsmethoden zu erproben, sondern alte weiterzuentwickeln und zu perfektionieren [ebd.]. Für die Betroffenen aber war es eine Tortur.
Am Standort Düsseldorf wurden etwa neue Transplantationsverfahren zur therapeutischen Behandlung der Gesichtsweichteildefekte bei Kieferschussverletzungen erprobt und entwickelt [Halling, 2017:48, Jonczyk, 1999:25].
Wie Platin: Stahlgebisse der Firma Krupp
Die entsprechende Expertise für die Herstellung von Prothesen brachte Friedrich Hauptmeyer (1882–1950) ein. Hauptmeyer war seit 1904 Assistent und ab 1910 Leiter der Kruppschen Zahnklinik in Essen. Er beriet Bruhn bereits zu dieser Zeit bei schwierigen Fällen im Kontext betrieblich erworbener Gesichts- und Kieferverletzungen [Mayer, 1967:9; Witzel, 1904:22]. So oblag Hauptmeyer in der Betriebsklinik der Essener Gussstahlfabrik die zahnmedizinische Versorgung der zahnkranken Stahlarbeiter. Wurde bei einem Unfall, beispielsweise durch „mechanische Gewalt“ [Witzel, 1904, 65], ein Kiefer verletzt, so dass Teile der Knochensubstanz verloren gingen, versorgte man die Patienten mit entsprechenden Prothesen.
Während die ersten noch aus Kautschuk gefertigt wurden, ging man später dazu über – und dafür ist Hauptmeyer in die Geschichte der zahnärztlichen Prothetik eingegangen – Prothesen aus nichtrostendem Stahl (Wipla: „Wie Platin“) zu fertigen [ebd.; Schmidt, 2014:36–38]. Aufgrund seiner orthopädisch-prothetischen Fertigkeiten, wurde er 1914 ans Düsseldorfer Kieferlazarett abkommandiert [Hoffmann-Axthelm, 1995:100].
Warum das Kieferlazarett in Düsseldorf wichtig war
Am Ende des Krieges zählte man auf deutschem Reichsgebiet rund 49 Kieferlazarette. Der überwiegende Teil davon war jedoch als Übergangsraum mit einem zeitlichen Charakter konzipiert und wurde nach Kriegsende wieder aufgelöst [Ruff, 2015:39–49]. anders sollte sich das Schicksal des Düsseldorfer Lazaretts gestalten. Wohl um die Bedeutung einer stationären Abteilung am zahnärztlichen Institut wissend, initiierte Bruhn bereits 1917 die Gründung des Bürgervereins „Westdeutsche Kieferklinik“ [Hugger, 2017:23; Mayer, 1967:19]. Die zukunftsträchtige Aufgabe des Vereins war es, „die Weiterführung des Kieferlazaretts als Stätte der Krankenversorgung zu sichern sowie die Forschung und Lehre auf dem gesamten Gebiet der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und der Kiefer-/Gesichtschirurgie voranzutreiben und zu vertiefen“ [Hugger, 2017:23].
Zu Recht könnte man sagen, Bruhn war ein Visionär, der mit seinem persönlichen Engagement sich nicht nur humanitären Zielen verpflichtet fühlte – indem er den kiefer- und gesichtsversehrten Soldaten mit der Etablierung der Westdeutschen Kieferklinik auch nach dem Krieg eine suffiziente zahnmedizinische Versorgung zur Verfügung stellen wollte –, sondern auch fachlichen Weitblick besaß. Schließlich befand sich die Zahnheilkunde derzeit mitten in einem langen und mühevollen Professionalisierungsprozess [Krischel, Nebe, 2022]. Mit der Institutionalisierung des Kieferlazaretts wollte Bruhn diesen Entwicklungen einen entscheidenden Vorschub leisten und für eine Überwindung der unterschiedlichen Ausbildungsstandards bei Zahn- und Humanmedizinern sorgen:
„Die natürliche Folge dieses Unterschieds hinsichtlich der wissenschaftlichen Aus- und Durchbildung ist die Kluft, die zwischen dem Zahnarzt und der Allgemeinmedizin, und damit, insofern die Zahnheilkunde als [Spezial-]Gebiet der Medizin zu betrachten ist, zwischen dem Zahnarzte und seinem eigenen Fach besteht. Es findet sowohl in der Stellung des Zahnarztes zur Zahnheilkunde als Wissenschaft, als Forschungs- und Lehrgebiet, wie auch in den äußeren Standesverhältnissen seinen starken Ausdruck“ [Bruhn, 1918:194].
Mit der Angliederung der Westdeutschen Kieferklinik an die Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin gelang es in der Folge, die etablierten Strukturen langfristig zu sichern und somit die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie als eigenständige Spezialdisziplin zu etablieren und weiterzuführen [Halling, 2017:47]. Ein wichtiger Schritt, fungierte doch in der Vorzeit allein der Große Krieg als Lehrmeister, so wie im Fall des jüdisch-stämmigen, verfolgten Kieferchirurgen Josef Elkan (1895–1972) [Krischel/Halling, 2020]. Aufgrund Bruhns unermüdlichen Einsatzes war er bereits seit 1920 Ehrendoktor der Universität Würzburg. Gegen den Widerstand des Akademischen Rates folgte 1924 die Ernennung zum ordentlichen Professor der Kiefer- und Zahnheilkunde in Düsseldorf [Halling, 2017:47; Hoffmann-Axthelm, 1995:100]. Zum ersten außerordentlichen Professor der Kiefer- und Gesichtschirurgie, wurde hingegen der bereits zu Zeiten des Kieferlazaretts am Standort Düsseldorf wirkende und zwischenzeitlich doppelapprobierte August Lindemann (1880–1970) ernannt.
Jener übernahm 1935, nach der Emeritierung Bruhns, die Leitung der Westdeutschen Kieferklinik und erhielt den Lehrstuhl für Kiefer- und Zahnheilkunde. Mit der politischen Unterstützung durch den nationalsozialistischen Reichsärzte- und den Reichszahnärzteführer gelang es Lindemann, der selbst nicht Parteimitglied war, die Westdeutsche Kieferklinik zu einer zentralen zahnärztlichen Fortbildungsstätte der NS-Zeit zu gestalten. Lindemann leitete noch bis zu seiner Emeritierung 1950 die Westdeutsche Kieferklinik, von 1948 bis 1950 war er zudem Rektor der Medizinischen Akademie Düsseldorf [Halling, 2017:49].
Die Fachzahnarztfrage in der BRD und in der DDR
Der Trend zur Ausdifferenzierung medizinischer Spezialdisziplinen setzte im 19. Jahrhundert ein. Die technischen und naturwissenschaftlichen Innovationen der Zeit begünstigten die Spezialisierung. Im 20. Jahrhundert regten sowohl externe Faktoren, wie der Erste Weltkrieg, als auch interne Faktoren, wie die Erwägungen einzelner Fachdisziplinen, die Ausbildung neuer (zahn-)medizinischer Spezialfächer an [Eulner, 1970:1; Groß, 2019:153]. So umfasste die auf deutschem Reichsgebiet geltende „Prüfungsordnung für Aerzte“ vom 28. Mai 1901 bereits einen Fächerkanon von sieben Prüfungsfächern. Neben der chirurgischen Prüfung galt es unter anderem, in den Spezialbereichen Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie Hals- und Nasenkrankheiten entsprechende Kenntnisse nachzuweisen [Opitz, 1928:28–29,104]. Für die Zahnmedizin waren aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Professionalisierung und Akademisierung solche expliziten Prüfungsbestimmungen nicht vorgesehen [Krischel, Nebe, 2022; Opitz, 1928:171–187; Vollmuth/Zielinski, 2014].
In den 1920er-Jahren drängte die „Facharztfrage“ auf die Agenda. Auf dem 43. Deutschen Ärztetag in Bremen (1924) wurde mit der sogenannten „Bremer Richtlinie“ die erste deutsche Facharztordnung verabschiedet. Diese zählte nun 14 medizinische „Sonderfächer“, unter denen auch die „Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten“ aufgeführt war. Neben einer Doppelapprobation als Arzt und Zahnarzt wurde eine dreijährige mehrjährige Fachausbildung gefordert. Ab 1935 traten der „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“ und der „Fachzahnarzt für Kieferchirurgie“, der 1942 noch einmal in „Fachzahnarzt für Kieferkrankheiten“ umbenannt wurde, neu hinzu [Groß, 2019:154; Staehle, 2010:210–211; Vollmuth/Zielinski, 2014].
In der Bundesrepublik führte die Weiterbildungsordnung aus dem Jahr 1968 zu einer erneuten Erweiterung des Fächerkanons. Als eigenständige Spezialdisziplin zählte nun auch die 1976 in „Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie“ umbenannte „Mund- und Kieferchirurgie“ mit entsprechender Facharztbezeichnung [Vollmuth/Zielinski, 2014]. In den 1970er- und 80er-Jahren hielten in Westdeutschland zudem der „Fachzahnarzt für Oralchirurgie“, der „Fachzahnarzt für Öffentliches Gesundheitswesen“ und der „Fachzahnarzt für Parodontologie“ (Geltungsbereich; Landeszahnärztekammer Westfalen-Lippe) Einzug [Groß, 2019:154; Staehle, 2010:210–211].
Auch in der DDR existierte ein doppelapprobierter „kieferchirurgischer Facharzt“. Dieser wurde 1977 in „Fachzahnarzt für Kieferchirurgie“ umbenannt. Dort kannte man noch weitere Fachzahnärzte, wie den allgemeinzahnärztlich tätigen „Fachzahnarzt für Stomatologie“ (1961), den „Fachzahnarzt für Kinderstomatologie“ (1961) sowie die in den 1970er-Jahren eingeführten Bezeichnungen „Fachzahnarzt für orthopädische Stomatologie“ und „Fachzahnarzt für Sozialhygiene“ [Groß, 2019:154].
Im neuen Jahrtausend führte die Landeszahnärztekammer Brandenburg den Fachzahnarzt für „Allgemeine Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ (wieder) ein.
Wie geht es weiter?
Wie zu sehen war, bedingte eine Vielzahl an Faktoren die Ausdifferenzierung der (zahn-)medizinischen Spezialdisziplinen. Im Bereich der Zahnmedizin führt heutzutage vor allem die Einführung neuer Ausbildungsstandards sowie fachlicher Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu einer „Auffächerung“ [Groß, 2019:155]. Vor dem Hintergrund der historischen Bedingt- und Veränderlichkeiten der fachlichen Spezialisierung betrachten einige Protagonisten diese Entwicklung innerhalb der Zahnmedizin jedoch zunehmend kritisch:
„In den letzten 85 Jahren gab es während der NS-Zeit, der Ära der Deutschen Demokratischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland ein wechselvolles Ringen um drei Facharzt- und zwölf Fachzahnarztbezeichnungen, allerdings ohne ein fachlich plausibles Gesamtkonzept unter Einschluss aller relevanten Disziplinen zu finden“ [Staehle, 2010a:206].
Die Diskussion um die Einführung weiterer Fachzahnarztbezeichnungen beschäftigt ebenfalls die Berufspolitik. Insbesondere postgraduale Zusatzqualifikationen, wie sie im Kontext der Muster-Weiterbildungsordnung seit einigen Jahren verpflichtend sind, stehen in der Kritik, die Auffächerung der Zahnmedizin künstlich zu katalysieren [BZÄK, 2016]. Dies bedinge nicht nur standespolitische Konsequenzen wie eine „Zersplittung der Zahnärzteschaft“ [Staehle, 2010a: 212], die in letzter Konsequenz zu einer Benachteiligung der „Generalisten unter der Zahnärzteschaft“ führe [Staehle, 2010b: 678]. Des Weiteren zögen entsprechende Entwicklungen Versorgungs-, Kosten- und Kassenfragen nach sich [DAZ, 2008]. Ein Umstand, der vor allem vor dem Hintergrund geltender professionsethischer Prinzipien kritisch betrachtet werden muss.
Literaturliste
Angerstein, H. (1932). Wie und in welcher Höhe sind Kriegsdienstbeschädigte durch Kieferschussverletzung versorgungsberechtigt? (= Diss. Dr. med.). Hannover: Blumenberg.
Bruhn, Chr (1918). Die Westdeutsche Kieferklinik als Behandlungs-, Forschungs- und Lehrstätte, Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde 36: 194.
Bruhn, B (2016). Bericht über eine zweijährige Tätigkeit des Düsseldorfer Lazarettes für Kieferverletzte. 15. August 1914 bis 15. August 1916 mit einem kurzen Nachtrag bis zum 15. November 1917. Düsseldrof: A. Bagel S. 44-46.
BZÄK (2019). Muster-Weiterbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer Beschluss des Vorstandes vom 29.06.2012 geändert durch Beschluss der Bundesversammlung vom 19.11.2016 Musterweiterbildungsordnung|Bundeszahnärztekammer|November 2016 2/; online abrufbar unter: www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/mwbo.pdf
Deutscher Arbeitskreis für Zahnheilkunde (DAZ) (2008). Pressemeldung zur geplanten Änderung der Muster-Weiterbildungsordnung. München, den 17. Juni 2008.
Eulner, H-H (1970). Einleitung, in: Heinz-Hermann Eulner (Hrsg.): Die Entwicklung der Spezialfächer an den Universitäten des deutschen Sprachgebiets, Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1970, S. 1-4.
Geister, A A (2004). Zur Geschichte der westdeutschen Kieferklinik. Ihre Entstehung und Einbettung in die Düsseldorfer Krankenanstalten und die Medizinische Akademie, Düsseldorf: Selbstverlag des Stadtarchivs.
Gohritz, A / Vogt, P M / Hönig, H F (2008). Johannes Esser (1877-1946), Jacques Joseph (1865-1934) und Hugo Ganzer (1879-1960) – ein historischer plastisch-chirurgischer Spaziergang durch das Berlin zwischen 1900 und 1920, Vortrag auf dem 125. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 22. - 25.04.2008, Berlin.
Groß, D. (2019). Zahnmedizin hoch vier: Die Ausdifferenzierung der Zahnheilkunde in Spezialdisziplinen, in: Die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland. Einflussfaktoren – Begleitumstände – Aktuelle Entwicklungen. Berlin: Quintessence Publishing, S. 133-156.
Eckart, W. U./Gradmann, Chr. (2003). Die Medizin und der Erste Weltkrieg. 2. Auf. Centaurus Verlag & Media.
Frerich, J./Frey, M. (1993). Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland / Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches. De Gruyter Oldenbourg.
Ganzer, H (1934). Die Kriegsverletzungen des Gesichts und Gesichtsschädels und die plastischen Operationen zum Ersatz der verlorengegangenen Weichteile und Knochen unter besonderer Berücksichtigung der Kieferverletzungen. Nach eigenen Erfahrungen. Leipzig: Verlag Johann Ambrosius Barth.
Krankenbewegung bei dem Deutschen Feld- und Besatzungsheer im Weltkriege 1914/1918. Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
Staehle, H. J. (2010a). Die Geschichte der Fach -zahnärzte in Deutschland. History of registered dentistry specialities in Germany, in: DZZ 4:206-213.
Staehle, H. J. (2010b). Die Geschichte der Fachzahnärzte in Deutschland – Nachtrag, History of registered dentistry specialities in Germany – Addendum, in: DZZ 11/2010:675-679.
Schröder, H (1920). Die Kriegsverletzungen der Kiefer. In: Borchard A und Schmieden V (Hrsg.): Die deutsche Chirurgie im Weltkrieg 1914 bis 1918. Zugleich zweite Auflage des „Lehrbuchs der Kriegs-Chirurgie“. Leipzig: Verlag Johann Ambrosius Barth, S. 503-535.
Thoss, B (2009). Infanteriewaffen. In: Hirschfeld G, Krumeich G, Renz I, Pöhlmann M (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh, S. 575-579.
Vollmuth, R /Zielinski, St (2014). Die kriegsbedingte Entwicklung neuer medizinischer Spezialdisziplinen das Beispiel Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; online abrufbar unter: wehrmed.de/geschichte/die-kriegsbedingte-entwicklung-neuer-medizinischer-spezialdisziplinen-das-beispiel-mund-kiefer-und-gesichtschirurgie.html
Walter Hoffmann-Axthelm: Die Geschichte der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin 1995.
Witzel, Julius: Die Kruppsche Zahnklinik. Berlin: Berlinische Verlagsanstalt, 1904; Schmidt, M. Stahlprothesen. Die Anfänge des Einsatzes von nichtrostendem Stahl in der Zahnprothetik, in: Dental Dialogue (2014) 15/1: 36-39.
Zabecki, DT (2014). Waffen des Landkrieges. In: Pöhlmann M, Potempa H und Vogel T (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg 1914-1918. Der deutsche Aufmarsch in ein kriegerisches Jahrhundert. München: Bucher Verlag, S. 213-227.