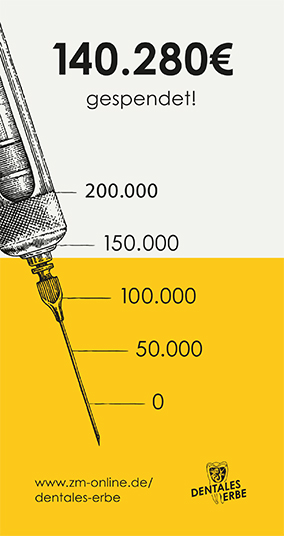Ein Leben zwischen Not und Glück
Ein Schrei wie aus einer anderen, dunklen Welt tönt durch den zartrosa gestrichenen Flur mit Blumenbildern. Ein unverständliches Wortfragment. Dann ist es wieder still. Hinter den offenen Türen einiger Zimmer liegen Pflegebedürftige auf dem Rücken in ihren Betten. An den Decken sind gebastelte Dekorationen angebracht.
Viel ist die Rede von Notstand und Mangel in der Pflege in Deutschland. Union und SPD haben eine große Reform versprochen, mehr Betreuung, mehr Hilfe für die immer zahlreicheren Demenzkranken. Was brauchen Pflegebedürftige?
In dem Flur mit den Blumenbildern nähert sich langsam eine alte Frau in einem Walker, einem Gestänge zum Festhalten auf Rollen. Sie stößt leise Laute aus. Beim Vorbeigehen streicht ihr eine Pflegerin über den Arm. Wir befinden uns auf der fünften Etage des Evangelischen Seniorenheims Albestraße in Berlin. Hier leben die Bewohner mit fortgeschrittener Demenz.
Leben auf Abstand
Das Heim hat ein gemeinschaftliches Wohnkonzept, erklärt die Geschäftsführerin Silvia Gehrmann. Die schweren Fälle seien auf einem Stock, die anderen Bewohner könnten nicht immer die nötige Toleranz aufbringen. Wer körperlich beeinträchtigt ist, leichter oder schwer dement, braucht demnach ein Stück Abstand von anderen. Gehrmann: "Das Ziel ist es, stressfrei zu leben."
Eine Etage tiefer. Elisabeth Schulze sitzt auf ihrem Bett. Unablässig putzt die 88-Jährige mit einer unbenutzten Windel die Hülle einer CD. Am Tischchen in ihrem Zimmer sitzt ihre Tochter, Dietlind Kirsch-Tietje. "Da ist eine CD drin", sagt die 65-Jährige. Die demenzkranke Mutter guckt sie fragend an. "Musik", erklärt die Tochter. Die Mutter wirkt nicht so, als hätte sie verstanden.
Wie eine Black Box
"Manchmal denke ich, man sollte einen Deckel aufmachen können und gucken, wie es ihr geht", sagt die Tochter. "Aber das kann man bei der Krankheit nicht." Vor zwei Monate ist Elisabeth Schulze hergekommen. Lange hatte sie trotz beginnender Demenz noch alleine gewohnt. "Dann ist sie gefallen und lag die ganze Nacht am Boden", erzählt die Tochter.
Für den anschließenden Krankenhausaufenthalt hat Dietlind Kirsch-Tietje nur ein Wort übrig: "Horrortrip." Richtig gekümmert habe man sich nicht um ihre Mutter. Die Demenz wurde schlimmer. Wieder daheim reichte die Betreuung von Familie, Helfern, Nachbarn bald nicht mehr. Sie brauchte einen Pflegeplatz.
Drei Heime und zwei Einrichtungen mit betreutem Wohnen hätten sie sich angesehen. Auf Pflegenoten vertraute Kirsch-Tietje nicht. "Man weiß ja, wie solche Listen gemacht werden." Die Entscheidung für das Evangelische Seniorenheim erfolgte per Bauchgefühl. Zwei Jahre Wartezeit hieß es zuerst - bis auf einmal doch ein Platz frei wurde. "Meine Mutter wollte nicht, wir haben gesagt: Es ist nur für eine Woche."
Angst vor lauten Stimmen
Und heute? Dietlind Kirsch-Tietje bereut die Wahl nicht und will niemandem im Heim Vorwürfe machen. Aber: "Wir wissen nicht, ob meine Mutter nicht unglücklich ist in ihrem Zimmer." In den Gesellschaftsraum will sie nicht gehen. "Sie hat Angst vor lauten Stimmen und zu vielen Leuten."
So resolut Kirsch-Tietje ist, blickt sie nun doch ratlos durch den Raum: "Auch hier kommen die Pfleger an ihre Grenzen." Es fehle die Zeit. Sie hat das Gefühl, dass die alten Menschen mehr Pflegekräfte bräuchten - doch dann wäre ein Platz wohl unbezahlbar, meint Kirsch-Tietje.
Der Eigenanteil ist ohnehin hoch. Die Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten, das gehört zum Prinzip. Die Einstufung in eine der drei Pflegestufen entscheidet sich nach Begutachtungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK).
Ein 24-Stunden-Job
Das gilt auch für die Pflege zu Hause. Zwei von drei Pflegebedürftigen werden in Deutschland daheim gepflegt. Anja Zellmann nimmt uns mit auf eine Tour. Die 43-Jährige arbeitet seit zwölf Jahren als Gutachterin für den MDK.
Als erstes besucht die gelernte Krankenschwester Anke K., einen erschütternden Fall. Anke K. ist erst 46 Jahre alt, sie hat Krebs im Finalstadium, wie Zellmann berichtet. Werder in Brandenburg, halb neun am Morgen. Ein Häuschen in einer aufgeräumten Eigenheimsiedlung. Es ist kalt. Zellmann klingelt. Nach einer halben Minute öffnet sich langsam die Tür. Anke K. hat den Besuch erwartet.
Sie bittet mit sanftem Lächeln herein und geht vorsichtig ins Wohnzimmer. Das sauber geputzte Heim einer Kleinfamilie, in der Ecke liegt ein Mops. Anke K. setzt sich aufs Sofa, Zellmann nimmt gegenüber Platz und klappt ihren Laptop auf den Oberschenkeln auf. Sie hat schon einige Informationen, jetzt fragt sie nach den Ärzten der Kranken und ob sie ihre Medikamente selbst vorbereiten kann.
Wenn der Mann zum Pfleger wird
"Größtenteils ja, außer die Morphiumspritzen, die bereitet mein Mann zu." Zellmann tippt in ihren Computer. Der Mops erhebt sich und wedelt leicht mit seinem Schwanz. "Wie viel Zeit wendet Ihr Mann für die Pflege auf?" Anke K.: "Eine Stunde wenigstens." Zellmann möchte wissen, wie viele Stufen die Treppe ins Obergeschoss hat. Das hat Anke K. noch nicht gezählt. "Ich gehe mit meinem Mann hoch, noch geht das. Zur Not kann ich auf allen Vieren hoch, wenn es mir schwindelig wird."
Sieben Monate vorher war die Welt von Anke K. noch in Ordnung. Dann entdeckten Ärzte ein Karzinom. Nach einer Operation schien das Schlimmste überstanden. Doch die erste Nachuntersuchung brachte eine viel schlimmere Diagnose: unheilbarer Krebs im Bauchfell. Eine Chemotherapie hätte wohl nur Leid gebracht.
Es kommt auch auf die Treppe und das Bad an
Anke K. weint. "Was wäre das für eine Zeit gewesen, die ich gewinne? Da haben wir gesagt, dass ich mich nur noch palliativ behandeln lasse." Zellmann bleibt nüchtern: Eine solche Behandlung zur Symptom-Milderung der tödlichen Krankheit zu Hause sei möglich. Es komme auch auf die Umstände im Haus an, auf die Treppe, das Bad.
Die Gutachterin fragt weiter. Anke K. frühstückt morgens noch mit Mann und Kindern. Mit brüchiger Stimme kommt sie auf den Schicksalsschlag zurück. Noch sechs bis zwölf Monate bleiben ihr laut ihren Ärzten. "Uns ist wichtig, dass wir die wenige Zeit, die wir haben, entlastet werden."
Das Gutachten wird Zellmann schnell schreiben, nach einer Woche wird die Krankenkasse die Pflegestufe mitteilen. Der Pflegebedarf ist wohl eher gering, wie die Gutachterin später sagt. Noch sei Anke K. recht selbstständig.
46 Minuten täglich
Pflegestufe 1 - monatliche Sachleistungen für einen Pflegedienst von 450 Euro etwa - erhält, wer 46 Minuten Grundpflege braucht. Es zählen Waschen, Zahnpflege, An- und Ausziehen, Treppensteigen oder Zubereiten und Aufnahme der Nahrung. "Es ist eine Rechenaufgabe", sagt Zellmann. Die Gutachterin arbeitet immer ähnlich - die Schicksale der Pflegebedürftigen sind vielfältig wie das Leben. Sie setzt sich in ihr Auto und fährt zum nächsten Fall.
Ein Plattenbau aus DDR-Zeiten, Peter G. wohnt mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung. Auch der erwachsene Sohn Matthias ist da, als Zellmann klingelt. Er lebt in einer anderen Wohnung im selben Haus. Seit fünf Jahren kümmert er sich mit um seinen Vater. Die Familie bietet Kaffee an und Gebäck.
Peter G. sitzt in einem braunen Sessel. Er ist Bluter, sein Blut gerinnt nur langsam. Er hatte einen Schlaganfall, Operationen, leidet unter Diabetes, hat einen künstlicher Darmausgang. Zellmann stellt ihre Fragen. Kann er alleine sein Gesicht waschen, den Rücken? "Da komm' ich nicht mehr hin", sagt Peter G.
Sparen für den Badewannenlift
Leise klappert die Tastatur von Zellmanns Laptop. Was könnte Peter G. gebrauchen? Einen Badewannenlift zum Beispiel. Doch der passt nicht ins kleine Badezimmer. Ein Umbau würde bis zu 7.000 Euro kosten. Die Kasse würde 2.500 Euro zahlen.
Erst allmählich wird das Ausmaß von Peter G.s Beeinträchtigungen deutlich. Zellmann fragt: "Wie alt sind Sie?" Er wiederholt: "Wie alt bin ich?" - "Sind Sie denn schon über 60?" Er bejaht. "Sind Sie denn schon über 70?" Das weiß Peter G. nicht. "Ich will Sie gar nicht länger quälen", sagt Zellmann, "ich will's Ihnen verraten: Sie sind 71." Ohne seine allerdings auch nicht mehr gesunde Frau und seinen Sohn wäre Peter G. ziemlich aufgeschmissen.
Die Gutachter müssen routiniert sein, die Zeit ist knapp. "Zum Rechts- und Linksgucken, reicht es nicht", sagt Zellmann. In schneller Fahrt geht es über kleine Straßen weiter. Ein altes Häuschen am Rand von Potsdam zwischen Bäumen, eine kleine Dachwohnung mit Kachelofen und Blick auf die Havel. Die Bewohnerin der Wohnung heißt Herta Kapust und ist 102 Jahre alt. Die hochbetagte Dame bekommt wie selbstverständlich liebevolle Betreuung von ihrem Sohn.
Blind und witzig
Sie kann kaum noch laufen, ist fast blind - aber im Kopf noch wendig und witzig. Zur Begrüßung bedankt sich Kapust bei Zellmann sofort für ihr Pflegebett: "Meine Wohnung ist jetzt das Bett."
Draußen geht das Grau des Himmels ins Blaugrau des Wassers über. Der Sohn erzählt, warum die alte Dame immer noch in der Wohnung lebt, die von einer vergangenen Zeit übriggeblieben scheint. "Als sie 80 war, da haben wir gedacht: Umziehen lohnt sich nicht mehr."
"Dass sich das so in die Länge zieht."
Er kommt jeden Tag, kocht, holt die Asche aus dem Ofen, unterhält sich mit der Mutter, macht den Toilettenstuhl sauber. Die Mutter kann ihre Gäste kaum erkennen, beim Gespräch ist sie dabei. "Na ja, ich hab's mir nicht ausgesucht", sagt sie lakonisch, "ich habe nie gedacht, dass sich das so in die Länge zieht."
Doch die steinalte Frau und ihr Sohn strahlen ein ruhiges Glück aus. Zellmann fragt, ihre Tastatur klappert. Eine Wanduhr tickt. Eine Pflegerin eines ambulanten Dienstes sitzt dabei. Bald wird die Krankenkasse mitteilen, ob es eine höhere Pflegestufe wird. Es könnte sein, dass mehr Leistungen als bisher bezahlt werden.
Kaffee zum Trinken
Zurück im Evangelischen Seniorenheim Albestraße. Die demenzkranke Seniorin Elisabeth Schulze hat eine Tasse Kaffee an ihr Bett bekommen. Auch ihre Tochter Dietlind Kirsch-Tietje hat eine Tasse vor sich stehen. Es könnte gemütlich werden. Doch die Mutter will nicht gleich trinken. Die Tochter sagt: "Kaffee, guck', das ist Kaffee zum Trinken."
Die Mutter nimmt die Tasse, blickt die Tochter fragend an und hält den Kaffee mit ausgestrecktem Arm in die Luft. Es ist ein Ausdruck von Fürsorglichkeit der demenzkranken Frau. "Sie will mir den Kaffee anbieten", erklärt Kirsch-Tietje. "Sie war ihr ganzes Leben lang so lieb, das verstärkt sich jetzt." Für Dietlind Kirsch-Tietje gehört dazu auch, dass die Großherzigkeit ihrer Mutter am Ende noch zur Geltung kommen kann - und jemand da ist, der die Gesten richtig versteht.
von Basil Wegener, dpa.