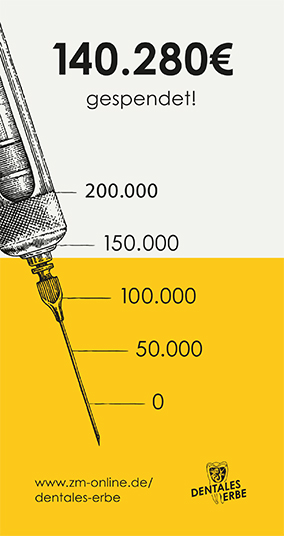Der neue DGZMK-Präsident im Interview
zm-online: Herr Prof. Walter, welche Themen haben Sie auf der Agenda für Ihre Amtszeit platziert?
Michael Walter: Die DGZMK soll die deutlich vernehmbare Stimme der Wissenschaft in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde als Ganzes sein. Diese Klammerfunktion möchte ich so erfolgreich wie bisher wahrnehmen, denn sie macht unser Fach auch nach außen stark. Natürlich werde ich alle laufenden Aktivitäten und Projekte in Kontinuität weiterführen.
Dabei sehe ich die Forschungsförderung als eine zentrale Aufgabe. Die wissenschaftliche Basis für die Zahnmedizin der Zukunft muss durch experimentelle Forschung, klinische Forschung und Versorgungsforschung weiter ausgebaut werden.
Genauso gehört aber auch der Transfer des aktuellen Wissens in die Praxis zu unseren Kernkompetenzen. Wir tragen dem mit Leitlinien und Wissenschaftlichen Mitteilungen Rechnung, aber natürlich auch durch qualitativ hochwertige Fortbildung, die wir über die Akademie Praxis und Wissenschaft anbieten. Ich möchte natürlich auf die neue Wissensplattform owidi der DGZMK hinweisen, mit der wir ein umfassendes Wissens- und Fortbildungsangebot machen wollen.
Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde als medizinische Disziplin unter Berücksichtigung unserer Eigenständigkeit und Spezifika fort zu entwickeln, ist eine weitere Herausforderung.
"Die wissenschaftliche Basis muss weiter ausgebaut werden"
Last but not least möchte ich betonen, dass ich die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit mit der Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung fortsetzen werde. Das bezieht sich auf den Deutschen Zahnärztetag als zentrale Gemeinschaftsveranstaltung der Zahnärzteschaft, aber auch auf die vielen anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten und Projekte. Epidemiologische Situation, Bedarfe und Medizin verändern sich ebenso wie Gesellschaft und nationale und internationale Rahmenbedingungen. Jede der großen zahnärztlichen Organisationen hat dabei ihre spezifische Sicht.
Die Vertretung der Wissenschaft durch die DGZMK erweist sich hier als besonders wertvoll. Wir können den stetigen Wandel umfänglich wissenschaftlich begleiten und beeinflussen. Nur wenn BZÄK, KZBV und DGZMK konstruktiv zusammenarbeiten, können wir langfristig optimale Ergebnisse für die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, die Zahnärzteschaft und natürlich Bürger und Patienten erreichen.
Wie beurteilen Sie denn den Entwurf zur Novellierung für die 60 Jahre alte Approbationsordnung?
Die DGZMK begrüßt ausdrücklich, dass das Verfahren zur Einführung einer neuen Approbationsordnung nun so zügig vorangetrieben wird. In der Grundstruktur und der geforderten Anpassung der Betreuungsrelation im klinischen Unterricht wurde weitgehend den Vorschlägen der Zahnärzte gefolgt.
Wenn man sich näher mit dem Entwurf beschäftigt, zeigt sich noch eine Reihe von Problemen, die es im weiteren Verfahren zu beheben gilt. Dabei muss ganz klar gesagt werden, dass eine kostenneutrale Umsetzung der neuen Approbationsordnung sowohl in der Übergangsphase als auch danach kaum realisierbar erscheint. Hier müssen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diesbezüglich sind wir uns mit der Vereinigung der Hochschullehrer (VHZMK) und der Bundeszahnärztekammer einig.
Sicher ist die nunmehr angestrebte Angleichung der Curricula von Medizin und Zahnmedizin in der Vorklinik grundsätzlich wünschenswert. Sie führt allerdings auch zu einer reduzierten praktischen Ausbildung in dieser Phase des Studiums. Das war bekannt. Das zentrale Problem liegt doch auf der Hand. Ein Medizinstudium dauert sechs Jahre, das Zahnmedizinstudium fünf. Wir haben also ein Jahr weniger zur Verfügung und müssen zusätzlich eine sozusagen fachärztliche Grundausbildung mit operativen Anteilen leisten.
Eine postgraduale Facharztweiterbildung gibt es bei uns nur in sehr eingeschränkter Form. Wenn man das Gesamtpaket von Aus- und Weiterbildung betrachtet, ist eigentlich klar, dass man an Grenzen stoßen und Kompromisse eingehen muss. Manchmal erinnert mich das Ganze an die Quadratur des Kreises.
###more### ###title### Approbationsordnung: praktische Ausbildung stärken ###title### ###more###
Approbationsordnung: praktische Ausbildung stärken
Nach diesem Entwurf wurde die praktische Ausbildung in den ersten vier Semestern sehr stark reduziert. Sehen gerade Sie als Prothetiker das Problem, dass ein Student dann erst im fünften Semester merkt, dass er gar nicht so manuell begabt ist, wie er es sein sollte? Früher wurden die „Unbegabten“ bereits im Propädeutik-Kurs aussortiert.
Natürlich zeigen sich manuelle Defizite erst in den zahnmedizinisch-praktischen Kursen. Somit ergibt sich aus dem Weglassen beziehungsweise einer späteren Platzierung dieser Kurse zwangsläufig, dass entsprechende Defizite dann auch erst später zu Tage treten. Das ist der Nachteil eines gemeinsamen Grundlagenstudiums von Medizin und Zahnmedizin. Jede Medaille hat eben zwei Seiten.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Studierende, die anfänglich Schwierigkeiten haben, diese Defizite später durchaus ausgleichen können. In den traditionellen vorklinischen Kursen zeigen sich häufig Vorteile bei Studierenden, die schon Vorerfahrungen haben, zum Beispiel eine zahntechnische Lehre.
Später sehen wir dort aber eine Angleichung. Studienplatzwechsel von der Zahnmedizin in die Medizin wird es auch durch Studierende geben, die von Anfang an gar nicht Zahnärztin oder Zahnarzt werden wollen, sondern nur den etwas einfacheren Zugang über das Zahnmedizinstudium nutzen. Dieser Weg wird sicher durch die gemeinsamen ersten zwei Jahre attraktiver.
Sie haben bereits vor über 15 Jahren das Projekt POL an Ihrer Fakultät eingeführt. Welche Erfahrungen haben Sie daraus gewonnen? Wie war die Resonanz der Studierenden?
Der Impuls zur Einführung des problemorientierten Lernens an unserer Fakultät ging primär von der Medizin aus. Die Zahnmedizin schloss sich dann aber relativ schnell an. Nach einer von Euphorie begleiteten Einführungsphase waren nicht alle Erfahrungen uneingeschränkt positiv. Dabei muss man sicherlich auch berücksichtigen, dass wir im zahnmedizinischen Bereich – anders als in der Medizin – durchaus schon einen sehr großen Anteil von Formaten implementieren, die denen des problemorientierten und fallbasierten Lernens ähnlich sind. Dieser Anteil nimmt durch die immer komplexeren klinischen Fälle zu, besonders in unserem interdisziplinären Kurs in den letzten beiden Semestern.
Um die Belastung der Studierenden, insbesondere in der klinischen Phase, nicht zu groß werden zu lassen, haben wir den Anteil des problemorientierten Lernens in der Zahnmedizin zwischenzeitlich wieder deutlich reduziert. Ein weiterer Grund waren auch die nicht mehr vorhandenen zusätzlichen Kapazitäten auf der Seite der Lehrenden.
###more### ###title### Akademie Praxis und Wissenschaft: eine neue Ära? ###title### ###more###
Akademie Praxis und Wissenschaft: eine neue Ära?
Mit Ihrem Amtseintritt beginnt auch eine neue Ära der Akademie Praxis und Wissenschaft (APW). Welche Ziele stecken Sie dort und inwieweit steht die APW, die früher die einzige Fort- und Weiterbildungsinstanz war, in Konkurrenz zu anderen - vor allem zu Master-Angeboten?
Eine neue Ära würde ich nicht sagen. Aber natürlich wird ein neuer APW-Vorsitzender auch seine eigenen Akzente setzen wollen. Das ist auch gut so. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass Herr Dr. Dr. Tröltzsch die sehr erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Dr. Grosse fortsetzen wird. Gemeinsame Ziele des APW-Vorsitzenden, des Geschäftsführenden Vorstandes und des Präsidenten sind eine kontinuierliche Anpassung des Angebots der APW an die sich wandelnden Bedarfe.
Chancen bieten neue Kurs- und Unterrichtsformate und die Nutzung der immer größeren Möglichkeiten der digitalen Welt. Ich verweise hier erneut auf unsere Plattform owidi, die für die Kursorganisation, aber auch die Einrichtung von Kursräumen und für die Vermittlung von Inhalten für die APW-Kurse genutzt wird.
Natürlich besteht die Konkurrenz zu den vielfältigen Masterangeboten. Das ist Ausdruck eines umkämpften Marktes. Die Aufgabe der APW wird es sein, attraktive alternative Angebote vor allem jenseits der Masterebene zu machen. Verlässliche hohe Qualität und wissenschaftliche Seriosität sind uns dabei wichtig und sollen unser Markenzeichen sein.
Stichwort „Privat-Universität“ - Krems besteht schon länger, nun gibt es auch in Nürnberg eine „Privatschmiede“, in der demnächst die Zahnmediziner an den Start gehen. Auch aus dem Ausland werden Angebote unterbreitet, Zahnmedizinstudenten für Deutschland auszubilden. Wie sehen Sie das?
Wir leben in einer freien Gesellschaft und in einer Europäischen Union. Das hat zur Folge, dass sich auch private Anbieter etablieren können, sofern ein entsprechender Bedarf besteht und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies hergeben. Das deutsche Zahnmedizinstudium und der Zugang dazu sind seit Jahrzehnten stark reguliert. Dass eine große Nachfrage nach Studienplätzen vorhanden ist, steht außer Frage.Studienmöglichkeiten in internationalen Studiengängen im Ausland bestehen seit langer Zeit und werden rege in Anspruch genommen. Konkrete Einflussmöglichkeiten sehe ich hier nicht.
Die Privatuniversität in Nürnberg ist eine österreichische Universität mit einem Standort in Nürnberg und bietet zurzeit einen Medizinstudiengang an. Man erwirbt einen Abschluss nach österreichischem Recht. Dass dort nun auch Zahnmediziner ausgebildet werden sollen, war mir noch nicht bekannt.
Aus meiner Sicht ist die Qualität eines Studienganges entscheidend. Staatliche Hochschulen und Wissenschaft sollten die Situation an privaten Universitäten in Deutschland und die Akkreditierung von Studiengängen genau im Auge behalten, um die Politik gegebenenfalls auf Fehlentwicklungen hinweisen zu können.
Zu Eckpunkten zur nichtstaatlichen Medizinerausbildung und Qualitätssicherung hat sich der Wissenschaftsrat Anfang des Jahres positioniert. Er hat dabei auch auf die Chancen hingewiesen, die in dieser Entwicklung liegen. Mir würde es persönlich allerdings nicht gefallen, wenn Privatanbieter in Deutschland gegen hohe Studiengebühren eines Tages attraktivere Angebote als die staatlichen Hochschulen unterbreiten könnten. Soweit sind wir aber noch nicht.
###more### ###title### Perspektiven der Universitätszahnmedizin: mehr Forschung ###title### ###more###
Perspektiven der Universitätszahnmedizin: mehr Forschung
In seinem aktuellen Programm „Perspektiven der Universitätsmedizin“ rät der Wissenschaftsrat, den Anteil des wissenschaftlichen Personals an jenen Standorten, die die Voraussetzungen zum Aufbau eines international kompetitiven Forschungsschwerpunkts in der Zahnheilkunde erfüllen, zu erhöhen, um forschungsorientierte Karrierewege in der Zahnmedizin gleichberechtigt zu etablieren. Wie bewerten Sie das hinsichtlich der Umsetzung?
Grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Initiative. Attraktive Perspektiven und Karrierewege sind eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Stärkung der Forschung. Allerdings sind angesichts der Realität an unseren Hochschulen Zweifel angebracht, ob eine Umsetzung gelingen kann.
Der Wissenschaftsrat hat strukturelle Maßnahmen benannt, die einen zusätzlichen Mitteleinsatz und einen entsprechenden politischen Willen erfordern. Die Ressourcen im Bereich der Zahnmedizin wurden hingegen in den letzten Jahrzehnten immer weiter verknappt. Sie erkennen das an Zusammenlegungen von Abteilungen, einer rückläufigen Zahl der Professuren und an den fast schon reflexartigen Diskussionen über mögliche Einsparpotenziale bei anstehenden Nachbesetzungen.
Unsere Mitarbeiter stehen unter einem zunehmenden Druck, Erlöse zu erwirtschaften und die studentischen Kurse noch in angemessener Weise zu betreuen. Trotz aller Arithmetik bei den Personalanteilen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung bleibt da nicht mehr viel Platz für wissenschaftliche Tätigkeiten. Insofern ist leider vielen Standorten schon von vornherein die Möglichkeit genommen, sich für ein solches Programm zu qualifizieren.
Eigentlich ist es erstaunlich, wie groß und qualitativ hochwertig der wissenschaftliche Output der deutschen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde immer noch ist, angesichts ungünstiger Rahmenbedingungen, Unterfinanzierung und einer teilweise demotivierenden Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Apropos. Studierende der Zahnmedizin zeigen eine geringe Forschungsaffinität, als die Kommilitonen aus der Humanmedizin. Wo liegen aus Ihrer Sicht die Gründe?
Man muss festhalten, dass sich Studierende der Zahnmedizin und der Medizin in ihren Einstellungen und Zielen unterscheiden. Die meisten Zahnmedizinstudenten sind von Anfang an auf klinisch-praktische Tätigkeit ausgerichtet und werden zu einem großen Prozentsatz später kurativ zahnärztlich tätig werden.
Das ist in der Medizin so nicht der Fall. Wir haben hier ein sehr breites Fächerspektrum und dies bildet sich auch in einer unterschiedlichen Interessenlage bei den Studierenden ab. Unter Ihnen ist auch immer ein substanzieller Anteil mit Forschungsinteressen. Traditionell hat die medizinische Forschung einen guten Namen, eine hohe Attraktivität und wird auch erheblich besser gefördert als die Forschung in der Zahnmedizin.
Wir müssen versuchen, die Forschung in der Zahnmedizin attraktiver zu machen und den jungen Absolventen auch attraktive Karrierewege aufzeigen. Die Feminisierung der Zahnmedizin mit über 70 Prozent weiblichen Studierenden verstärkt das Problem des Nachwuchsmangels in der zahnmedizinischen Forschung noch zusätzlich. Die aktuellen Formate einer Forschungslaufbahn sind nämlich mit den Lebensmodellen vieler junger Frauen immer noch nicht kompatibel.
###more### ###title### Frauenquote: was macht Sinn? ###title### ###more###
Frauenquote: was macht Sinn?
Würde denn eine Quote Sinn machen, um den Frauenanteil unter den Professoren in der Zahnmedizin zu erhöhen?
Ich möchte mich klar gegen eine Frauenquote aussprechen, da sie der Problemlage nicht gerecht wird. Unsere weiblichen Studierenden sehen zu einem erheblichen Anteil die Attraktivität des zahnärztlichen Berufes in einer relativ hohen Flexibilität bei der Arbeitszeit und Lebensplanung. Diesbezüglich hat die Zahnmedizin Vorteile gegenüber der Medizin.
Wichtig wäre es, Frauen in der Qualifikationsphase vor der Berufung noch besser zu unterstützen, um eine Hochschulkarriere attraktiver zu machen. (zm-online:100.000 Euro Fördergeld für Jenaer Zahnärztin)Benachteiligungen von Frauen im Berufungsverfahren selbst konnte ich in den vergangenen Jahren nicht ausmachen. Wir sehen einfach zu wenige Frauen, die Professuren anstreben, folglich auch zu wenige Bewerberinnen. Eine Frauenquote ist deshalb nicht zielführend und packt das Problem nicht an der Wurzel.
Das IQWiG erstellt HTA-Berichte zu zahnmedizinischen wissenschaftlichen Fragestellungen. Ist die Methodik aus Ihrer Sicht sinnhaft?
Das ist differenziert zu betrachten. Auf der einen Seite ist es durchaus sinnvoll, beispielsweise medizinische Verfahren hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Grundlage zu beleuchten. (zm:Evidenz um jeden Preis?)Bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen nur hochrangige Studien auf hohem Evidenzniveau heranzuziehen, erscheint ebenfalls angezeigt. Andernfalls liefe man Gefahr, erheblich verzerrte und vielleicht sogar falsche Ergebnisse zu produzieren.
Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass in der Zahnmedizin derartige Studien nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Das führt häufig zu dem Ergebnis, dass evidenzbasierte Aussagen nicht möglich sind. Eine mögliche Verbesserung könnte vielleicht eine gewisse Lockerung der Einschlusskriterien für Studien bringen, ohne den grundsätzlichen Qualitätsanspruch aufzugeben.
Das Problem liegt aus meiner Sicht aber auch in der Interpretation der Ergebnisse von HTA-Berichten. Oft wird fehlende Evidenz für ein Verfahren dahingehend interpretiert, dass es klinisch auch nicht indiziert sei. Das ist so nicht richtig. Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass neben der externen Evidenz auch die persönliche Expertise des Arztes und die Patientenpräferenzen für die Entscheidung herangezogen werden. Würden wir diesen Ansatz nicht täglich praktizieren, wäre eine zahnmedizinische Therapie in vielen Fällen gar nicht mehr möglich.
Ich glaube auch, dass die Verwendung der HTA-Berichte und deren Stellenwert für gesundheitspolitische Entscheidungen, unter anderem im G-BA, diskussionsbedürftig sind. Im Übrigen eignen sich viele HTA-Berichte dazu, uns den Spiegel vorzuhalten und den Mangel an hochrangiger klinischer Forschung sehr deutlich zu machen. Dies sollte auch die Politik aufrütteln und zu besserer Forschungsförderung führen.
Ihr Statement zum Schluss?
Ich glaube, dass angesichts der rasanten zahnmedizinischen Fortschritte, aber auch der Herausforderungen, vor denen unser Gesundheitssystem steht, eine starke und umfassende Vertretung der wissenschaftlichen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde wichtiger denn je ist.