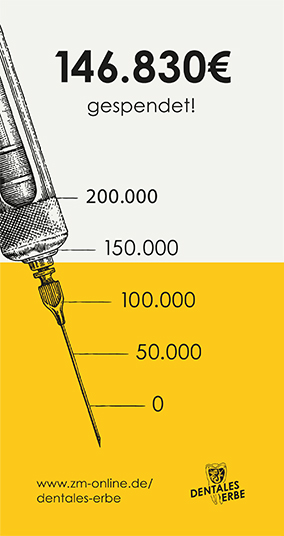Eine reicht ihnen nicht
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe machte bei der Eröffnung der conhIT gleich klar, dass er beim Thema elektronische Patientenakte (ePA) zukünftig „aufs Tempo drücken“ will. Angesichts einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft mit multimorbiden Patienten und der Notwendigkeit, in Stadt und Land eine gute Versorgung zu gewährleisten, herrsche hier Handlungsbedarf. Nachdem bereits der Notfalldatensatz und der Medikationsplan auf den Weg gebracht worden seien, stehe die ePA nun ganz oben auf der Agenda.
Und während einer Podiumsdiskussion mit Vertretern von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und dem Bundesgesundheitsministerium auf der Messe wurde deutlich: Alle Parteien wollen in der nächsten Legislaturperiode die ePA vorantreiben. Dabei wolle man aber „keine staatliche Einheitsakte“, sondern vielmehr einheitliche Rahmenbedingungen – was etwa die technische Umsetzung, die Interoperabilität und die Datenschutz- und Zugriffsfunktionen angeht. Die individuelle Ausgestaltung könne dann auch unterschiedlichen Anbietern überlassen werden, betonte der SPD-Politiker Dirk Heidenblut.
Eine Entwicklung, die die Bundesärztekammer begrüßt:. „Die elektronische Gesundheitsakte ist das zentrale Element eines erfolgreichen Digitalisierungsprozesses im Gesundheitswesen“, sagt Dr. Franz Bartmann, Vorsitzender des Telematik-Ausschusses der BÄK. „Leider ist die Diskussion in Deutschland bisher dominiert worden von der elektronischen Gesundheitskarte, die in diesem Kontext lediglich ein Verschlüsselungselement in der Hand des Versicherten darstellt. Von daher ist es zu begrüßen, wenn jetzt das eigentliche Ziel wieder mehr in den Fokus gerät.“ Das eigentliche Ziel – damit ist die Umsetzung der Telematikinfrastruktur im deutschen Gesundheitswesen gemeint, die vom Gesetzgeber gewollt ist. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Patient, der sich sozusagen mit der Karte als Schlüssel den Zugang zu seinen Daten verschafft.
Der Patient soll Herr seiner Daten werden
Aber warum will man eigentlich die ePA einführen? Dass die eAkte kommen soll, steht im E-Health-Gesetz von 2015. Dort ist festgelegt (§ 291 a SGB V), dass die Versicherten ab dem 1.1.2019 Anspruch auf eine ePA haben (siehe Kasten).
Mit der Akte rückt der Patient in den Mittelpunkt. Das unterstreicht etwa das Aktionsbündnis Patientensicherheit in einer Stellungnahme, die zusammen mit Vertretern von Ärzten, Krankenkassen, Verbraucherschützern und der Industrie entstanden ist. Der Patient müsse „Herr seiner Daten“ sein, heißt es dort. Das Bündnis begrüßt die ePA als „übergreifendes Instrument zur Überwindung der Schnittstellenproblematik im Gesundheitswesen“, wichtig sei eine „vernetzte und interoperable Informationsbereitstellung“.
E-Health-Gesetz
Im E-Health-Gesetz von 2015 ist festgelegt (§ 291a SGB V), dass die Versicherten ab dem 1.1.2019 Anspruch auf eine elektronische Patientenakte haben, in der wichtige Dokumente wie Arztbriefe, der Medikationsplan, der Notfalldatensatz, Impfausweise oder Ähnliches aufbewahrt werden können. Um auf diese Akte zugreifen zu können, wird ein E-Arztausweis benötigt. Die Akte liegt nicht beim Arzt oder im Krankenhaus, sondern in der Hand des Patienten. Diese sind dann in der Lage, ihre Behandler über ihre wichtigsten Gesundheitsdaten zu informieren.
Ebenfalls ab dem 1.1.2019 sollen dem Versicherten die Inhalte seiner Patientenakte in ein sogenanntes Patientenfach gespiegelt werden, damit der Patient auch unabhängig von einem Arztbesuch darauf zugreifen kann. Über die Daten der Akte hinaus soll der Patient hier die Möglichkeit erhalten, auch persönliche Gesundheits- oder Fitnessdaten einzutragen (etwa über Ernährung oder Bewegung).
Auch die Zahnärzteschaft ist beim Thema ePA mit im Boot. BZÄK und KZBV sind – ebenso wie die BÄK und die KBV – Gesellschafter der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik). Dipl.-Stom. Jürgen Herbert, Telematikexperte im Vorstand der Bundeszahnärztekammer, sieht die ePA als den „wichtigsten Bestandteil“ der Telematikinfrastruktur an: „Im zahnärztlichen Bereich werden jedoch nur Teilbereiche benötigt, zum Beispiel Notfalldaten oder Daten über die aktuelle Medikation (Beispiel: Antikoagulantien). Natürlich muss der Datenschutz wie auch die Sicherung der gespeicherten Information gewährleistet sein.“
Die KZBV betont, dass die ePA ein zusätzliches und für den Versicherten freiwilliges Instrument darstellt. Die ePA ersetzte nicht die Primärdokumentation des Zahnarztes oder Arztes. Für die Pflege der Befunddokumentation sei der Leistungserbringer verantwortlich, er sei Inhaber dieser Befunddaten. Die KBV sieht den Nutzen der Akte vor allem in einem verbesserten Dialog zwischen Arzt und Patient. Befunden müsse nicht mehr „hinterhertelefoniert“ werden. Zudem lasse sich eine systematische Krankengeschichte leichter dokumentieren, erklärte die Pressestelle auf Nachfrage. Soweit also Konsens – auf Patientenseite wie bei den Leistungserbringern.
Effizienzpotenziale von mehreren Milliarden Euro
Dass die Bedeutung von E-Health-Lösungen für das deutsche Gesundheitswesen auch unter finanziellen Gesichtspunkten attraktiv zu sein scheint, mag ein zusätzlicher Punkt sein, um das Thema ePA voranzutreiben. Jedenfalls verspricht das eine Studie von PwC Strategy im Auftrag der CompuGroup Medical SE und des Bundesverbands Gesundheits-IT (bvitg).
Die lange Liste der offenen Fragen
Die Experten der Studie, die im Vorfeld der conhIT veröffentlicht wurde, rechnen vor, dass durch den konsequenten Einsatz von E-Health-Lösungen im deutschen Gesundheitswesen ein Effizienzpotenzial von rund 39 Milliarden Euro stecken würde – was rund 12 Prozent der gesamten GKV-Krankheitskosten in 2014 ausmacht. Dr. Rainer Bernnat, Geschäftsführer von PwC Strategy Deutschland, kommentierte das bei der Vorstellung der Studie so: „Die Studie zeigt die Relevanz digitaler Lösungen im Versorgungsalltag des deutschen Gesundheitssystems. Die Einführung ist nur noch eine Frage des ‚Wann‘, nicht mehr des ‚Ob‘“.
Auch das klingt gut, keine Frage. Aber: Bei der Umsetzung der ePA sind zahlreiche Aspekte eben noch nicht geklärt. Das betrifft vor allem das Kompetenzgerangel unterschiedlicher Zuständigkeiten von Kassen, Ärzten, Krankenhäusern und Apothekern: Wer darf wem zu welchen Daten Zugriff verschaffen (vieles steht im Gesetz, doch die Details sind offen)? Wie läuft das Zusammenspiel mit den Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte? Bringt die ePA tatsächlich einen Mehrwert im Praxisalltag von Ärzten, Zahnärzten und für den Patienten? Soll sie zentral oder dezentral eingeführt und verwaltet werden? Welche Anbieter setzen sich durch und welche Systeme sind sinnvoll? Kann der Patient bei einem Kassenwechsel die ePA mitnehmen? Gibt es Lösungen für die Schnittstellenproblematik? Und im zahnärztlichen Bereich: Welche Informationen vom Zahnarzt sollen dort Eingang finden?
Jeder backt seinen eigenen Kuchen
Die ungelösten Fragen führen nun aber keineswegs zu Stillstand und Abwarten. Stattdessen zeigt sich derzeit ein Flickenteppich von Lösungsvorschlägen – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.
Hochschule
Ein Ansatz kommt beispielsweise aus der Wissenschaft. Im Vorfeld der conhIT veröffentlichte die Deutsche Hochschulmedizin ihre Vernetzungs-Initiative. Sie will eine elektronische Patientenakte entwickeln, die allen beteiligten Ärzten bei jedem Behandlungsschritt alle relevanten Informationen liefert und gleichzeitig das neue Forschungswissen zur Verfügung stellt.
Neu an dem Konzept sei vor allem, dass die vernetzte Akte auch „an die klinische Forschung angebunden“ sein soll, betonte Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Präsident des Medizinischen Fakultätentags bei der Vorstellung des Papiers. Mit Fördergeldern aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Medizininformatikinitiative werden derzeit durch verschiedene Arbeitsgruppen die Grundlagen für die geplante Akte geschaffen. Anschließend soll die Akte zunächst in der Universitätsmedizin und dann flächendeckend zusammen mit nicht-universitären Kliniken und niedergelassenen Ärzten umgesetzt werden.
Um das Projekt elektronische Patientenakte schneller voranzutreiben, will die Bertelsmann-Stiftung einen anderen Weg beschreiten. In einer neuen Studie schlägt sie vor, ein eigenes Bundesinstitut zu gründen. Die Einführung brauche einen klaren Fahrplan, heißt es in der Expertise. Entscheidend sei dabei eine effektive Governance-Struktur. Dazu schlagen die Experten ein „auf Dauer angelegtes ePA-Bundesinstitut unter politischer Steuerung des Bundesgesundheitsministeriums“ vor, um die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Projekts sicherstellen. Das Institut sollte Standards und Rahmenbedingungen sowie zulässige Betreibermodelle definieren, führt die Bertelsmann-Stiftung in ihrer Studie aus. Neben der Steuerung durch das Institut gehöre dazu auch ein eigener Rechtsrahmen und eine detaillierte Finanzplanung. Bis zur vollen Umsetzung rechnen die Experten mit einem Zeitraum von zehn Jahren.
Kassen
In der Zwischenzeit haben einzelne große Krankenkassen bereits Fakten geschaffen. So hat die Techniker Krankenkasse als erste große Krankenkasse eine Patientenakte europaweit ausgeschrieben und vor Kurzem das Unternehmen IBM beauftragt, eine solche Akte für ihre rund zehn Millionen Versicherten zu entwickeln. Die für alle TK-Mitglieder kostenfreie Online- Akte soll in einem Rechenzentrum von IBM auf deutschem Boden gehostet werden. In einem ersten Schritt soll die Akte mit jenen Daten der Versicherten gespeist werden, über die die TK ohnehin verfügt. So könnte etwa ein elektronischer Impfpass umgesetzt werden. Zeitlich verzögert könnten dann Verordnungsdaten sowie auch ambulante Diagnosen und Leistungen eingespeist werden. In weiteren Ausbauschritten sollen dann Versicherte ihre eigene Daten einstellen können. Die Akte soll auch – neben dem Webportal – über eine App zugänglich gemacht werden, um einen mobilen Zugriff zu ermöglichen. Schnittstellen zu medizinischen IT-Systemen sind geplant.
Die Vergabe der TK-Akte war an die Umsetzung sogenannter IHE-Profile gekoppelt (siehe Kasten), um Schnittstellen zu den kooperierenden Leistungserbringern zu ermöglichen. Und um den Patienten mit den Gesundheitsdaten, die der TK über ihn vorliegen, auch versorgen zu können, waren lange Abstimmungsprozesse mit dem Bundesversicherungsamt erforderlich.
Einen etwas anderen Weg hat die AOK Nordost beschritten. Während die TK eine zentrale, rechenzentrumsbasierte Online-Akte entwickelt, setzt die AOK Nordost auf eine dezentrale Datenhaltung und eine Kooperation mit Leistungserbringern. Dort wird mit dem IT-Dienstleister CISCO und in Kooperation mit einem Ärztenetz in Mecklenburg-Vorpommern, den Krankenhausketten Sana und Vivantes eine regionale Gesundheitsplattform vorangetrieben. Teil dieser Plattform soll auch eine elektronische Patientenakte werden. Bei den Schnittstellen setzt man ebenfalls auf IHE-Profile.
Kliniken
Weitere Insellösungen existieren beispielsweise im Klinikbereich. Seit Oktober 2016 ist die Rhön-Klinikum AG mit ihrer selbst entwickelten elektronischen Patientenakte „WEbEPA+“ am Start. Die Zentralklinik Bad Berka und das Klinikum Frankfurt (Oder) sind die ersten Krankenhäuser, die an das Netzwerk angeschlossen sind. Die Akte soll 2017 sukzessive an allen Rhön-Standorten ausgerollt werden. Das Universitätsklinikum Heidelberg verfolgt den Ansatz einer persönlichen einrichtungsübergreifenden Gesundheits- und Patientenakte (PEPA). Über ein Patientenportal kann der Patient seine Akte einsehen, Dokumente hinzufügen und zentral die Berechtigungen für eine detaillierte Zugriffssteuerung auf seine medizinischen Daten vergeben.
Kommt die einheitliche Lösung?
Offen ist dabei die Frage, wie sich die im Aufbau befindlichen Projekte insgesamt zu der ebenfalls im Aufbau befindlichen Telematikinfrastruktur der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen verhalten. Die gematik zeigt sich derzeit zurückhaltend. Sie begrüßt, dass verschiedene Akteure darüber nachdenken, welche Angebote man im Sinne einer optimierten Patientenversorgung zügig umsetzen kann. Sie tendiert aber zu einer einheitlichen Lösung. Doch: „Einen Auftrag zur Konsolidierung verschiedener Aktenprojekte hat die gematik indes nicht erhalten,“ heißt es dazu aus der Pressestelle. „Die Telematikinfrastruktur der gematik ist bewusst so gestaltet, dass innovative Versorgungsprojekte oder weitere Anwendungen, die über die vom Gesetzgeber bereits definierten Anwendungen hinausgehen, ebenfalls angebunden und bundesweit betrieben werden können“. Und: „Perspektivisch scheint eine umfassend integrierte Gesamtlösung von Vorteil zu sein. Möglicherweise empfiehlt es sich aber, diesen Zustand in Schritten zu erreichen“, formuliert die Organisation vorsichtig.
IHE
HE (Integrating the Healthcare Enterprise) ist eine Initiative von Fachleuten des Gesundheitswesens mit dem Ziel, die Kommunikation zwischen verschiedenen IT-Systemen und Medizingeräten zu verbessern. IHE fördert den Einsatz von etablierten internationalen Standards zur Optimierung der Prozesse innerhalb eines Krankenhauses, einer Praxis oder auch zwischen Gesundheitseinrichtungen. Dabei setzt IHE „auf die Zusammenarbeit von Anwendern, Implementierern und Entwicklern“. Mission von IHE ist es, das Gesundheitswesen zu verbessern und Spezifikationen, Tools und Dienstleistungen für die Interoperabilität anzubieten. Kliniken, Gesundheitsbehörden, Industrie und Nutzer sollen angehalten werden, standard-basierte Lösungen für bestimmte Bedürfnisse des Gesundheitswesens zu entwickeln, zu testen und umzusetzen.
Quelle: www.ihe-d.de
Die gematik beobachtet derzeit den Markt und führt Gespräche mit weiteren Lösungsanbietern. „Mit einer einheitlichen Aktenlösung gemäß E-Health-Gesetz werden die Patienten unabhängig davon, bei welcher gesetzlichen Kasse sie versichert sind, wie oft sie den Arzt wechseln oder ob sie umgezogen sind, Zugriff auf ihre persönlichen Daten erhalten oder gewähren können. Dies ist bei reinen kassen-, anbieterspezifischen oder regionalen Lösungen nicht umsetzbar und somit auf lange Sicht nicht geeignet.“
Oder sind die zahlreichen Insellösungen der richtige Weg? Eine klare Position dazu hat die KBV: „Im Interesse der Patienten und Ärzte sollte es nicht hunderte verschiedener Patientenakten geben, sondern im Idealfall einen Standard, der leicht umsetzbar ist. Eine elektronische Akte sollte für die Praxen nicht mit zusätzlicher Bürokratie verbunden sein. Natürlich kann eine elektronische Patientenakte nur dann mit Vorteilen verbunden sein, wenn der Patient auch umfassend und genau seinen Arzt informiert.“
Der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg), der die in Deutschland führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen vertritt, spricht sich in seinem neuen Positionspapier ebenfalls gegen Insellösungen aus und votiert für Aktenlösungen, die einheitlichen semantischen und technischen Standards folgen. Es müsse einen freien Markt geben, bei dem der Patient das Recht habe, zwischen konkurrierenden Aktenlösungen zu wählen. Die gematik solle die Sicherheit der Telematikinfrastruktur gewährleisten.
Die gematik muss nun die Vorbereitung zur Einführung der elektronischen Patientenakte bis Ende 2018 abgeschlossen haben. Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern führt sie derzeit die Interessen der verschiedenen Sektoren zusammen und bindet deren ärztliche und technische Expertise ein.
Das Ausland ist schon weiter
Im Ausland ist man in Sachen elektronische Patientenakte schon weiter. Das beleuchtet beispielsweise eine Ende 2016 veröffentlichte Studie der Stiftung Münch zur internationalen Vergleichbarkeit bei der Einführung einer sektorenübergreifenden elektronischen Patientenakte. Im Europavergleich von 20 Ländern liegt Deutschland mit Platz 10 im unteren Mittelfeld.
Die ELGA in Österreich
In Österreich ist zum 1.1.2013 die elektronische Gesundheitsakte namens ELGA gesetzlich eingeführt worden. In einem ersten Schritt wurden die technischen Komponenten (unter anderem ein ELGA-Zugangsportal für die Bürger, ein zentraler Patientenindex, ein Index der Gesundheitsdiensteanbieter sowie Berechtigungs- und Protokolliersysteme) errichtet. Anschließend sollen schrittweise die Gesundheitsdaten (zunächst Entlassungsbriefe, Labor- und Radiologiebefunde) für die Verwendung durch Gesundheitsorganisationen und Berufsgruppen im Gesundheitswesen bereitgestellt werden.
Die schrittweise Umsetzung (Rollout) hat im Dezember 2015 in öffentlichen Krankenhäusern in Wien und in der Steiermark begonnen und soll bis 2022 dauern. Seitdem sind die Krankenanstalten verpflichtet, an ELGA teilzunehmen und das System zu implementieren. Die Arztpraxen sollen bald folgen. Die Zahnarztpraxen sind noch nicht betroffen, eine Einführung ist laut Auskunft der Österreichischen Zahnärztekammer erst für das Jahr 2022 geplant.
Die ELGA GmbH ist für die konkrete Harmonisierungsarbeit zwischen den Institutionen im Gesundheitsbereich bei Befunden, im Entlassungsmanagement von Entlassungsbriefen und im Bereich der Medikation bei Rezepten (e-Rezept) zuständig. Eigentümer sind Bund, Länder und die Sozialversicherung.
Zugriffsmöglichkeiten auf ELGA-Dokumente sollen Ärzte, Krankenanstalten und Apotheken haben. Die Patienten verfügen über ein generelles und ein abgestuftes „opt-out“, das heißt, sie haben das Recht, Verweise auf Dokumenten ganz oder zum Teil zu unterbinden. Zugreifen können Patienten auf ELGA über den Webbrowser oder per Mobilgerät. Der Datenschutz ist im Gesundheitstelematikgesetz von 2012 geregelt.
An der Spitze liegen Dänemark, Schweden und Estland – Länder also, die ein zentral gelenktes Gesundheitswesen haben. Die Studie macht deutlich, dass dort, wo die ePA bereits erfolgreich eingeführt wurde, klare Vorgaben des Gesetzgebers die Grundlage bildeten. Auch in weiteren europäischen Ländern sind elektronische Patientenakten mittlerweile zentrales Element nationaler E-Health-Strategien. Zu nennen sind hier etwa die Schweiz oder Frankreich. Auch ein Blick auf Österreich ist aufschlussreich. Mit dem ELGA-Gesetz (ELGA = elektronische Gesundheitsakte) vom 1. Januar 2013 hat das Parlament die Rechtsgrundlage für das System geschaffen. Jetzt wird von der dortigen Sozialversicherung ELGA aufgebaut (siehe Kasten). Doch mehr als ein Jahr nach der Einführung von ELGA in den Krankenanstalten zeigt sich die Ärzteschaft in Österreich in ihrer Bilanz ernüchtert. In der derzeitigen Form bestehe mit ELGA „kein zusätzlicher Nutzen, geschweige denn eine Arbeitserleichterung“, erklärte der Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Harald Mayer, auf einem Pressegespräch Ende März in Wien. „Wir blicken auf ein Jahr ELGA im Spital zurück und müssen feststellen: Ärztinnen und Ärzte verbringen noch mehr Zeit vor dem Computer, anstatt sich ihren Patientinnen und Patienten widmen zu können.“