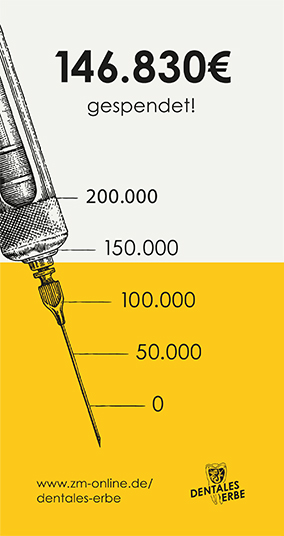Vom Nutzen der Netzwerke
Im Juli 2011 hat Facebook die Mega-Schwelle von 700 Millionen Mitgliedern überschritten. Seitdem ist einein stetig wachsender Teil der WeItbevölkerung in der Mutter aller sozialen Netzwerke digital mlteinander versbicktallein in Deutschland sind es über 20 Millionen Menschen.
Das Facebook-Profil der Heidelberger Fachschaft Zahnmedizin hat beispielsweise 294 „Freunde“, Die Studierenden nutzen das Profil zum Austausch über das Studium,für Veranstaltungs- und Fortbildungshinweise. Die Fachschaft selbst infomiert über Neuigkeiten des Berufsstands und über wichtige Termine. Das altbekannte Schwarze Brett, das mit Zetteln behängt war, hat sich also in den virtuellen Bereich verlagertnur dass der Zugriff auch von Zuhause aus möglich ist und sich so alle Studierenden online an Diskussionen beteiligen können.
Das Facebook-Profil der Heidelberger Fachschaft ist nur ein Beispiel für das rasant vollzogene Ende der „Einwegkommunikation“. Auch Mediziner verschließen sich nicht vor dieser Entwicklung, bleiben aber zurück-haltend. Laut einer Umfrage des Ärztenachrichtendienstes „änd“ kennen 95 Prozent der Mediziner Facebook, 56 Prozent wollen sich zukünftig beruflich intensiver mit Social-Media-Plattformen beschäftigen Doch nur knapp ein Viertel ist wirklich auf Facebook „unterwegs“.
Euphorische Stimmen erkennen soziale Netzwerke als kommunikative Revolution, ähnlich wie sie das Telefon vor knapp 130 Jahren auslöste. Konservativere Vertreter sehen in ihnen lediglich eine geringfügige Erweiterung der bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten. Die spannendste Frage lautet daher, welches messbare Potenzial in der virtuellen Welt steckt.
In der Literatur taucht bereits der Begriff „digitale Gesellschaft“ auf. Ihre Mitglieder werden seit mehr als einer Dekade im Hinblick auf ihre Medienkompetenz wissenschaftlich analysiert. Die Forschungsarbeiten zeichnen dabei – ähnlich wie in der realen Gesellschaft – ein heterogenes Bild von den digital aktiven Menschen. So unterscheidet die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderte und von TNS Infratest durchgeführte Studie „Die Digitale Gesellschaft“ – eine Sonderstudie des seit 2001 erscheinenden „(N)ONLINER Atlas“ –sechs verschiedene Nutzertypen innerhalb der digitalen Gesellschaft:
Digital wenig Erreichte
• digitale Außenseiter• Gelegenheitsnutzer• Berufsnutzer
Digital Souveräne
• Trendnutzer• digitale Profis• digitale Avantgarde
Laut den Ergebnissen der Studie zieht sich hinsichtlich des Nutzungsverhaltens ein tiefer Graben durch die digitale Gesellschaft, denn während knapp 80 Prozent der „Digital Souveränen“ soziale Netz werke nutzen, sind lediglich 29 Prozent der „Digital wenig Erreichten“ in Deutschland in diesen Foren unterwegs. Interessant ist, dass sich die Nutzer beider Gruppen auf wenige relevante Webseiten des sozialen Internets konzentrieren. Auf internationaler Ebene existiert seit den 90er-Jahren der Begriff „digital gap“ (deutsch „digitale Kluft“). Dahinter verbirgt sich die These, dass Chancen auf den Zugang zum Internet und zu anderen (digitalen) Informationsund Kommunikationstechniken ungleich verteilt und stark von sozialen Faktoren abhängig sind. Darüber hinaus haben diese Chancenunterschiede ihrerseits gesellschaftliche Auswirkungen. Wer Zugang zu modernen Kommunikationstechniken hat, der hat auch bessere soziale und wirtschaftliche Entwicklungschancen. Aktuelles Beispiel: Bankgeschäfte – hier können Angebote, wie die Einrichtung von Tagesgeldkonten mitunter nur online abgeschlossen werden. Aber auch bei Energieversorgern oder Versicherungen können die günstigsten Tarife meist nur als Vertrag im Internet geschlossen werden.
Post-Privacy versus Datenschutzbewegung
Während die Post-Privacy-Bewegung den Datenschutz und die Privatsphäre im Web ad acta gelegt hat – allen voran der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt und der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg – propagieren ihre Gegner, dass effektive Datenschutzregelungen entwickelt und Umgangsformen für das World Wide Web konsentiert werden müssen. Nur so könne eine vernetzte Gesellschaft auch jenseits von nationalen Grenzen funktionieren. Als Beispiel für den fragwürdigen Umgang mit Daten von Social-Media-Nutzern dient nicht zuletzt unter Politikern wie Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner die „Datenkrake“ Facebook.
Das aber selbst Staaten Signale in Richtung Post-Privacy-Bewegung setzten, zeigt das Beispiel Großbritannien. Dort will die Regierung eine Fülle interner Daten über die Leistung von Ärzten, Lehrern und Polizisten im Web veröffentlichen. Die Transparenz-Initiative soll den Service für den Bürger verbessern – und Geld sparen, berichtet der „Spiegel“ und beruft sich auf das britische Sonntagsblatt „News of the World“. Ironischerweise wurde just dieses Medium bekanntlich unlängst wegen eines Abhörskandals eingestellt. Ein Teil der Redaktion habe im großen Stil sensible Daten beschafft, darunter auch die Krankenakte des früheren britischen Premierministers Gordon Brown.
Neu aufgelegt – Der Web-Knigge
In der digitalen Gesellschaft existiert kein Grundgesetz. Für einen würdevollen Umgang hat sich jedoch der Begriff „Netiquette“ – für Netz-Etikette – etabliert. Wenn auch von vielen Netzteilnehmern als sinnvoll erachtet, hat der Web-Knigge meist keine rechtliche Relevanz. Was als guter Umgang gilt, hängt daher meist von den Teilnehmern des kommunikativen Subsystems ab – ei es ein Forum, ein Bewertungsportal, ein soziales Netzwerk oder ein Blog.
Der„Spiegel“ berichtete kürzlich über ein negatives Beispiel vom Umgang mit Kollegen im Netz. So wurde in der Facebook-Gruppe „Daimler-Kollegen gegen Stuttgart 21“ Konzernchef Dieter Zetsche als „Spitze des Lügenpacks“ beschimpft. Einige Forenmitglieder und Daimler-Angestellte klickten den „Gefällt mir“-Button und bekundeten so ihre Sympathie für den beleidigenden Kommentar. Fünf Mitarbeiter lud das Unternehmen daraufhin zum Gespräch vor und wies sie „auf die Verhaltensregeln hin, die sie bei der Einstellung unterzeichnet haben“, so ein Daimler-Sprecher.
Solche Leitlinien, Verhaltensrichtlinien oder angelsächsisch „Social Media Guidelines“ existieren bereits. Sie werden meist von Unternehmen beziehungsweise dem Urheber der Social-Media-Plattform selbst verfasst und unterscheiden sich untereinander, einige Grundsätze kommen aber in fast allen Leitlinien vor. Der Branchenverband der Informations- und Telekommunikationsbranche (Bitkom) hat in einem Leitfaden die wichtigsten Grundregeln zusammengefasst. Die wohl wichtigste Regel lautet: Jeder ist für seine Äußerungen im Web 2.0 selbst verantwortlich. Zudem sollte ersichtlich sein, ob man sich als Privatperson oder aus professionellen Motiven heraus äußert.
Eine Vermischung wirft im schlechtesten Fall ein ungünstiges Licht auf die sich äußernde Person. Zudem müssen sowohl der Datenschutz als auch Marken- und Urheberrechte beachtet werden, wenn man in sozialen Netzwerken aktiv ist. Als Best-Practice-Beispiel für solche Guide lines kann aus dem internationalen Bereich das Hospital Sant Joan de Déu in Barcelona dienen. Das Krankenhaus beachtet nicht nur die Anliegen von Patienten und Angestellten gleichermaßen, sondern ordnet die Richtlinien auch in die Philosophie des Klinikums ein. Zudem wird ausgewogen über Chancen von Social Media und über nützliche Vorsichtsmaßnahmen informiert. Darüber hinaus wird wenig mit Verboten für Mitarbeiter, sondern viel mit Angeboten zur Rücksprache gearbeitet. (www.hsjdbcn.org).
Digitale Kompetenz im eigenen Team
Ähnlich wie in der realen Arbeitswelt auch sollten sich also Arbeitnehmer wie Arbeitgeber selbst prüfen, ob sie gerade als Repräsentant einer Firma in einem Sozialen Netzwerk kommunizieren oder aber als Privatperson. Und grundsätzlich gilt: Jede preisgegebene Information über die eigene Person schmälert die Privatsphäre. Ratsam ist deshalb, Mitarbeiter anzuleiten, wie sie sich in der externen Social-Media-Kommunikation verhalten sollen. Zudem sollte festgelegt werden, ob und in welchem Umfang Plattformen wie Facebook während der Arbeitszeit auch privat genutzt werden dürfen.
Digital agieren statt digital reagieren
Die traditionelle Trennung von Informationsanbieter und Nutzer verschwimmt im Web 2.0. „Das ist eine großartige Chance, um über Grenzen hinweg (fachbezogen und räumlich) wissenschaftlich miteinander zu arbeiten, meint die Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Sylvia Sänger vom Universitätsklinikum Jena. Gegenüber den zm nannte sie konkrete Anwendungsbeispiele:
• Die Seitehttp://ginppi.wetpaint.com/der „Patient and Public Involvement Group“ des Guidelines International Network. Dort diskutieren Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern die Möglichkeiten der Patienteneinbeziehung in die Leitlinienentwicklung.
• Filme zur Patientenaufklärung können über den DienstYoutubeangeboten werden. Unter dem Schlagwort „Patientenaufklärung Zahnmedizin“ finden sich zahlreiche Beispiele.
• Fachgesellschaften und Verbände „zwitschern“ (englisch „twittern“), sprich senden in Ultrakurzform über das EchtzeitmediumTwitter Nachrichten aus. So können etwa aktuelle Informationen der Bundesärztekammer (BÄK) unterhttp://twitter.com/BAEKaktuell mitverfolgt werden. In den USA werden bereits Zwischenstände von Operationen übertragen.
• Internationale Arbeitsgruppen können zum Beispiel ihre Videokonferenzen überSkypeabhalten oder über eineWiki-Anwendung(http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnmedizin oder de.wikipedia.org wiki/Evidenzbasierte_Medizin) gemeinsam an einem Problem oder an einer Definition arbeiten.
• Mancher Wissenschaftler hat Partner zum Austausch oder Tipps für die Lösung seiner Probleme in Expertennetzwerken wie beispielsweisewww.xing.comoderwww.linkedin.comgefunden.
Das Internet, früher (Web 1.0) nur Schaufenster für präsentierte statische Informationen, sei zunehmend zweigleisig und interaktiv (Web 2.0). Sänger: „Social Media Anwendungen machen es möglich, dass man sich direkt austauschen und Web-Inhalte gemeinsam bearbeiten und fortentwickeln kann.“ Wissen zu managen, und zwar von der Recherche bis hin zum fachlichkollegialen Austausch, sei heute eine sehr große Herausforderung für Ärzte. Social-Media-Anwendungen könnten das entscheidend unterstützen.
Der Zahnarzt und die E-Patienten
„Arzt und Patient müssen beide umdenken“, ist sich Sylvia Sänger sicher. „Dieses Umdenken passiert schon eine Weile, etwas schwerfällig noch, aber es passiert.“ Während sich Patienten von der „Reparaturmentalität“ lösen und mehr Eigenverantwortung wahrnehmen sollten, müssten Ärzte ihren Paternalismus aufgeben, formuliert sie plakativ.„Gemeinsam entscheiden – erfolgreich handeln“ habe als Motto über dem langjährigen Förderprojekt „Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“ gestanden (www.patient-als-partner.de).
Und auch wenn die Anzahl der Medizinsurfer nicht eindeutig zu beziffern sei: „Das Internet ist aus dem Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wegzudenken.“ Woran es derzeit noch hapert, sei die Medienkompetenz. „Und zwar bei Patienten ebenso wie bei Ärzten“, betont die Gesundheitswissenschaftlerin. Oft konsumierten Patienten ungefiltert und unkritisch, was das Internet gerade so biete. Arzt-Patienten-Gespräche, die auf der Grundlage von ungeprüften Fehlinformationen geführt würden, müssten zwangsläufig zu Kommunikationsdesastern führen. „Ich glaube aus eigenen Erfahrungen, dass Ärzte nicht den informierten, sondern den fehlinformierten Patienten ablehnen“, folgert Sänger. Zu wenig bekannt seien den Bürgern wissenschaftlich fundierte Patienteninformationen wie www.gesundheits information.de.
Und dennoch: „Die Anforderungen an die kommunikative Qualität zwischen Zahnärzten und Patient steigen ständig“, erklärt Frank Stratmann. Er ist Gründer und Kopf des „Netzwerk praxistotal“ der Wissensgemeinschaft für Zukunftsfragen in der Gesundheitswirtschaft und Botschafter Health Care beim Business Netzwerk Xing. Zudem moderiert er die „Xpert Ambassador Community“ mit über 13 600 Mitgliedern. „Der Patient hat eine Entscheidung getroffen“, sagt Stratmann: „Der Dialog um das eigene, individuelle, teils personalisierte Gesundheitsgeschehen wird, ergänzend zu den traditionellen Schauplätzen, ins Netz verlegt, speziell in die sozialen Netzwerke“. Bisher träfen E-Patienten hier jedoch eher selten direkt auf einen Zahnarzt. „Längst geht es bei der Bewertung um das flankierende Geschehen einer Praxis. Es dreht sich nicht allein um medizinische Zusammenhänge“, so Stratmann. Die Online-Reputation eines Arztes oder Zahnarztes werde künftig zentraler Bestandteil der Entscheidung für oder gegen eine Praxis, so seine Prognose. Schon jetzt wären acht von zehn Deutschen online. Und die User würden gesundheitsbezogen immer aktiver.
Über das Internet gelinge es immer mehr Patienten, ein früher fragmentiertes, hingenommenes Gespräch mit ihrem Zahnarzt zu hinterfragen und durch eigene Recherchen zu ergänzen. Stratmann verweist hier auf eine internationale Studie: „Bereits 2009 suchten 61 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner online nach Gesundheitsinformationen.“ Eine unter Nutzern deutscher Gesundheitscommunities durchgeführte Studie im Jahr 2010 habe belegt, dass schon damals 75 Prozent der Patienten ihrem Arzt aufgrund eigener Online-Erfahrungen andere oder neue Fragen stellen würden.
Abschied von der Reparaturmentalität
„Lifestyle Social Networks“ wie Facebook und Co. seien nur die Speerspitze einer umfassenden gesellschaftlichen Entwicklung. „Der Umgang mit dem in seiner Natur asymmetrischen Wissensverhältnis zwischen Arzt und Patient bleibt die Herausforderung der nächsten Jahre im Rahmen der eigenen Praxisführung.“ Klar ist für Stratmann: Das paternalistische Vorgehen zurückliegender Epochen werde zugunsten eines Beteiligungsmodells – der partizipatorischen Medizin – abgeschafft. Konkret erwarte der Patient von seinem Zahnarzt Sensibilität. Nicht mehr nur im Rahmen der Leistungserbringung beim „Betreten“ der Mundhöhle. Das ganze Konzept müsse stimmen, damit Patienten sich für die beste medizinische Leistung entscheiden. An der überzeugenden Gesamtperformance hänge die Bereitschaft, den Geldbeutel zu öffnen. Stratmann folgert: „Deshalb wird die Meinung des Patienten zur Währung und längst haben sich Portale etabliert, die sich um die Aufbereitung der Summe subjektiver Meinungsvielfalt bemühen.“ Allerdings seien Bewertungsportale aber „weit weniger gefährlich“, als sie von Zahnärzten wahrgenommen würden. Komplizierter sei der Umgang mit den unbeobachteten Äußerungen am freien Meinungsmarkt. Denn hier verifiziere der Patient seine eigene Meinung durch Zurateziehen zusätzlicher, subjektiver Meinungen im Internet. Das Vertrauen der User in Bewertungen ist da. Laut einer Studie der Gesundheitsmarketing-Agentur „Digitas Health“ halten 67 Prozent der europäischen Verbraucher Gesundheitsinformationen, die sie in Social-Media-Netzwerken finden, für vertrauenswürdig. Vor dem Hintergrund dieser Daten sieht Bruce Grant, Vizepräsident Unternehmensstrategie bei Digitas Health, bei europäischen Verbrauchern einen starken Wunsch danach, dass sich Mediziner in Social-Media-Umgebungen einbringen.
Onlinepräsenz als Marketinginstrument
Nicht nur die Patienten, auch die Mediziner sind mehr und mehr im Netz aktiv. Viele, insbesondere niedergelassene Ärzte, haben die zunehmende Wichtigkeit der Onlinepräsenz erkannt, und auch der Wille, sich auf die digitalen Möglichkeiten einzulassen, ist durchaus vorhanden – nur die gesamte Bandbreite und das hohe Potenzial der Online-Möglichkeiten werden noch sehr selten genutzt. Immerhin mehr als die Hälfte der Mediziner in Europa glaubt laut Digitas Health, dass Social Media eine zunehmend wichtige Rolle für das Management und die Behandlung ihrer Patienten spielen wird. Zwei Drittel aller Ärzte und knapp ein Drittel aller Patienten erwarten, dass ihre Online-Kommunikation über Gesundheitsthemen in den folgenden 18 Monaten zunehmen wird.
Die aus dem Wissenschaftsbetrieb stammende Redewendung „publish or perish“ („veröffentliche oder gehe unter“) scheint mehr und mehr auch für niedergelassene Ärzte und Zahnärzte zu gelten. Wer nicht im Web präsent ist, sich also nicht professionell veröffentlicht, wird mittelfristig den Anschluss an seine Patienten verlieren. Die Mund-zu-Mund-Propaganda, die Empfehlung von Freunden wird bei der Arztwahl weiterhin eine Rolle spielen, doch Angebote wie Google Places, eine zeitgenössische Version der Gelben Seiten, werden in ihrer Bedeutung als Pull-Faktor zur Patientengewinnung weiter zunehmen.
Diese Erkenntnisse scheinen auch immer mehr Medizinern bewusst zu werden. Das zeigt die repräsentative Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2010“der „Stiftung Gesundheit“, die unter Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten durchgeführt wurde. Dabei wurden die Mediziner unter anderem über Praxismarketing und Informationstechnologie in der Praxis befragt. Demnach hält jeder zweite Befragte Marketingmaßnahmen für seine Praxis für „sehr wichtig“ beziehungsweise „eher wichtig“. Über 22 Prozent der Mediziner haben sogar ein festes Marketingbudget festgelegt.
Als wichtigstes Marketingwerkzeug werden dabei Online-Tools genannt, für knapp 69 Prozent der Befragten ist ihre Internetpräsenz das wichtigste Instrument, in das sie investiert haben – noch vor Personal und dem äußeren Erscheinungsbild der Praxis. Es ist also ein Trend hin zu digitalen Mitteln zu erkennen, bei solchen Zustimmungszahlen kann man aber auch von einem hohen Nachholbedarf ausgehen.
Welches Werkzeug man letztlich für den Webauftritt wählt, bleibt Geschmackssache. Eine klar strukturierte, individuell und ansprechend gestaltete Praxis-Homepage ist mit professioneller Hilfe relativ einfach zu erreichen.
Im Bereich der Social Media sind die Möglichkeiten weitaus vielfältiger. „Nicht alle sind für das Tagesgeschäft von Ärztinnen und Ärzten nützlich oder erforderlich“, sagt dazu Sylvia Sänger. „Das Ausmaß der Nutzung hängt sicher von jedermann selbst ab. Die Gefahr besteht darin, dass zur Nutzung dieser Netzwerke eine Anmeldung erforderlich ist. Man gibt viele persönliche Daten preis, die nicht immer ausreichend vor Missbrauch geschützt sind. So sollte sich jeder genau überlegen, welche Anwendung sinnvoll ist und wie viel an Privatsphäre man preisgeben möchte.“
Trotz der offensichtlichen Erkenntnis der Wichtigkeit von Marketingmaßnahmen scheinen Mediziner nicht gerne über ihre Online-Aktivitäten reden zu wollen. Zahlreiche Zahnärzte haben bereits ein Facebook-Profil zu ihrer Praxis, doch trotz mehrmaliger Nachfrage im Rahmen von Stichproben in Berlin wollte sich kein Zahnmediziner gegenüber den zm zu seinem Profil äußern. Hier herrschen offenbar nach wie vor Unsicherheit im Umgang mit den Social-Media-Werkzeugen und ein nur geringes Vertrauen vor. Vor allem könnte es aber auch Unschlüssigkeit sein, ob man mit so einem Profil nicht gegen das Werbeverbot der Kammer verstößt. Diese Vermutung wird auch durch die Studie der Stiftung Gesundheit bestätigt. Demnach ist für mehr als die Hälfte der Mediziner unklar, welche Marketingmaßnahmen in der Praxis erlaubt sind und welche nicht.
Recht und Ordnung für digital Aktive
Aus juristischer Sicht gibt es jedoch eindeutige Auflagen für berufliche Online-Aktivitäten. Gegenüber den zm erklärte Assessor Sven Tschoepe aus der Rechtsabteilung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK): „Obwohl ein Facebook-Account aus kommunikatorischer Sicht nicht als statische Information angelegt ist und daher eine regelmäßige Betreuung erfordert, ist er in rechtlicher Hinsicht mit einem Eintrag ins Branchenbuch vergleichbar.“ Jegliche irreführende und reißerische Beschreibung oder Anpreisung des Leistungsspektrums sei daher zu unterlassen. Abzuraten sei ferner von einer direkten Werbung mit Empfehlungen durch Patienten oder einer indirekten, indem auf Patientenempfehlungen auf anderen Webseiten oder Foren verlinkt wird. Tschoepe: „Ferner sollte bedacht werden, dass die Zustimmung der Praxismitarbeiter bei einer Abbildung im Internet eingeholt werden muss. Hierzu auch ein urheberrechtlicher Tipp: Vorsicht bei der Verwendung fremder Texte und fremder Abbildungen. Deren Übernahme ohne Einwilligung des Verfassers stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und kann zu Unterlassungs- und Schadensersatzforderungen führen.“ Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht und aus berufsethischen Gründen ist es Zahnärzten untersagt, in Foren, Blogs oder über Twitter Einzelschicksale zu schildern und sich an der Diskussion von Einzelschicksalen ausgewählter Patienten zu beteiligen. Ein Zahnarzt dürfe zwar über Fachthemen und neue Heilmethoden bloggen, er sollte sich aber vorher genau erkundigen, inwieweit die zur Verwendung kommenden Begriffe auch tatsächlich dem üblichen Sprachgebrauch entsprechen, denn nach § 11 des Gesetzes über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens dürfe „außerhalb der Fachkreise” nicht mit „fachsprachlichen Bezeichnungen” geworben werden, so der Rechtsexperte Tschoepe.
Das Bundesverfassungsgericht erlaubte zudem in einem kürzlich gefällten Urteil einem Zahnarzt eine Ausweitung seiner Werbung (AZ: 1 BvR 233/10 und 1 BvR 235/10). Damit bleibt das Gericht einem in den vergangenen Jahren in mehreren Entscheidungen erkennbaren Trend treu, die Werbemöglichkeiten für Zahnärzte auszudehnen und sie damit immer weiter in die Nähe gewerblicher Tätigkeiten zu bringen. Die BZÄK und die Landeszahnärztekammern betrachten diese Entwicklung ordnungspolitisch sehr kritisch. Denn der Zahnarzt sollte sein Handeln primär an der Gesundheit seiner Patienten und nicht in erster Linie an kommerziellen Interessen ausrichten.
Ausblick: Der Patient 2.0 und der Mediziner 2.0
Wie sieht nun aber die Zukunft des Gesundheitsbereichs aus? Eine Studie der Social-Media-Agentur MSL Germany kommt zu dem klaren Ergebnis: „Trotz des nach wie vor hohen Vertrauens haben Ärzte eindeutig ihr Informationsmonopol eingebüßt.“ Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Die „Digital wenig Erreichten“ werden weniger, der Anteil an „Digital Souveränen“ wächst. Es wird also für eine wachsende Zahl an Menschen ganz normal werden, Informationen über (zahn-) medizinische Themen im Web einzuholen. Deshalb sollten Gesundheitsportale, die anerkannte Qualitätsstandards erfüllen (zum Beispiel patienteninformation.de), unterstützt werden, damit sich der Patient nicht in dubiosen Foren unkritisch Laienmeinungen aneignet.
Die MSL-Studie konstatiert, dass Ärzte in Zukunft zwar von Patienten weiterhin als Experten und Ratgeber anerkannt werden, die Mediziner sich jedoch auf kritischere und besser informierte Patienten einstellen müssen. Zudem glauben bereits jetzt 44 Prozent der befragten Patienten, dass eine Online-Gesundheitsberatung lange Wartezeiten beim Arzt ausgleichen kann. Auch der Wunsch nach einer Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung ist bei weit über der Hälfte der Patienten vor handen.
Vor allem chronisch Kranke suchen Information und Austausch im Internet. Sie suchen viel stärker als gesunde Menschen nach Bewertungen von Ärzten und Krankenhäusern und den Kontakt mit anderen Patienten über Behandlungsmethoden und Medikamente. Wenn man bedenkt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und deshalb auch chronische Krankheiten zunehmen, kann man hierbei einen anhaltenden Trend erwarten.
Die MSL-Studie formuliert eindeutig: Das Internet ist das Gesundheitsmedium Nummer eins, es ist die wichtigste Informationsquelle. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis für Mediziner lautet jedoch: Die Mehrzahl der Patienten wünscht sich eine stärkere Onlinepräsenz ihres Arztes. Hier reichen die Möglichkeiten von der Terminvereinbarung auf der Praxis-Homepage oder per E-Mail über aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Praxisferien auf dem Facebook-Profil bis zur direkten Kontaktaufnahme via Internet mit dem Arzt. Selbst die Onlinebegleitung eines Therapieverlaufs sieht die Studie als kommenden Trend.
In ein, zwei Jahrzehnten werden die meisten Ärzte wahrscheinlich über die aktuelle Diskussion über den Nutzen von Social Media nur müde lächeln. Denn bis dahin werden die sogenannten „Digital Immigrants“ – also diejenigen, die sich digitale Kommunikationsformen erst im Erwachsenenalter (mühsam) aneignen – langsam, aber sicher in Rente gehen, während die jungen Ärzte als „Digital Natives“ mit solchen Technologien aufgewachsen sein werden. Bestehen bleibt der unmittelbare Kontakt mit dem Team und den Patienten. In Zukunft wird sich für Mediziner nicht mehr die Frage stellen, ob sie soziale Netzwerke nutzen werden, sondern wo und wie sie sich als Mitglieder der digitalen Gesellschaft beteiligen werden.
\n
Die Evolution von Web 1.0 zu Web 3.0
\n
Web 1.0
Web 2.0 Social Media
Web 3.0
\n
Ziel
Benutzer informieren
Dienste anbieten
\n
Kollaboration
inhaltszentriert
benutzerzentriert
\n
Rollen
Publisher/Konsumenten
Mitmachweb (für Mediziner)
\n
Interaktion
serverzentriert statisch Push)
Client-zentriert
\n
dynamisch (Pull)
\n
\n