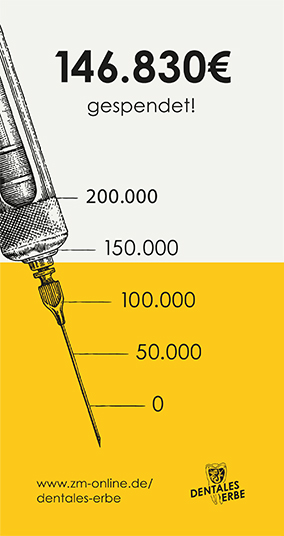Gemeinsam entscheiden
Eigentlich sind die Gegenpole bei medizinischen Behandlungen klar: Auf der einen Seite der kranke und unsichere Patient, auf der anderen Seite der Arzt als Spezialist. Doch diese Rollenverteilung und die sich daraus entstandenen Verhaltensmuster geraten immer öfter ins Wanken – im Gesundheitswesen vollzog und vollzieht sich ein Paradigmenwechsel: Der Gedanke von der gut gemeinten gesundheitlichen Fürsorge des Arztes für den Patienten weicht immer mehr einem Medizinerbild, das Kranke als Selbstbestimmte und Ärzte zunehmend in der Rolle des spezialisierten und beratenden Mentors und Lotsen in Gesundheits-, besser: in Krankheitsfragen sieht.
Verstärkte Autonomie des Patienten hilft heilen
Dieser Prozess wird getrieben etwa durch eine nie gekannte Zugänglichkeit und Allgegenwärtigkeit von (Gesundheits-)Informationen. Parallel hierzu verlief in den vergangenen drei Jahrzehnten ein bedeutender Prozess in der Patienten-Selbsthilfe. Das ist auch gut so: Unzählige Studien belegen, dass der durch Selbsthilfe aktivierte Patient einen besseren Behandlungserfolg erzielt. Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Rheuma wird der Patient oft zum Experten in eigener Sache.
Ein weiterer Aspekt ist eine allgemein zu beobachtende Entwicklung im Selbstverständnis der Bürger innerhalb einer demokratischen Verfassung hin zu mehr Selbstbestimmung und aktiver Einbindung in soziale, gesellschaftliche und politische Entscheidungen, das Stichwort „Wutbürger“ sei exemplarisch zur Veranschaulichung genannt.
Gesundheitspolitik setzt Rahmenbedingungen
In der Gesundheitspolitik findet diese Entwicklung ihren Niederschlag in zahlreichen Bestrebungen, dem ungleichen Verhältnis zwischen Experte (Arzt) und Laie (Patient) Chancen auf mehr Ausgewogenheit zu geben.
Schon 2001 hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) in einem Gutachten mehr Patientenorientierung angemahnt [SVR, 2001]. Parallel dazu wurde von der Politik der Ausbau von Patientenberatung und -information vorangetrieben, Stationen waren unter anderem die Ernennung eines Patientenbeauftragten (2003), zehn Jahre später wurde das Patientenrechtegesetz verabschiedet. Auch im Gemeinsamen Bundesausschuss, dem wichtigsten Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen, finden Patientenvertreter mittlerweile Gehör.
Alles super also mit der Patientenorientierung? Mitnichten. Prof. Doris Schaeffer vom SVR hat ihre Zweifel: „Wann immer man Patienteninterviews anschaut, zeigt sich, dass sie sich erschreckend ähneln – vor allem in ihrer Kritik am Versorgungswesen.“ Patienten fühlen sich nach wie vor unzureichend beachtet und ungenügend einbezogen. Dies unterstützt auch eine aktuelle Befragung der Bertelsmann-Stiftung und der Krankenkasse Barmer GEK. Demnach beklagten 23 Prozent der Befragten, dass ihr Facharzt vorhandene Therapieoptionen nicht zur Sprache bringt, ganze 95 Prozent vermissten ausführlichere Informationen über die Vor- und Nachteile einer Therapie.
Paradigmenwechsel im Rollenbild
Klar ist: Der zunehmende Anspruch der Patienten, von den Medizinern besser aufgeklärt und in die Behandlung einbezogen zu werden, hat auch Einfluss auf das Rollenbild und die Kommunikation beider Parteien.
Schon 2006 unterstrich etwa das Institut Deutscher Zahnärzte (IDZ) in einer Untersuchung die Interaktion zwischen Arzt und Patient als ein wesentliches Element medizinischer Behandlungen [IDZ, 2006].
Nicht nur das IDZ, auch andere wissenschaftliche Expertisen und Fachleute konstatieren bei der Beschreibung und der Einordnung der Arzt-Patienten-Bindung, dass es sich hierbei zunächst „um eine strukturell asymmetrische Beziehung handelt, da ein Experte und ein Laie aufeinander treffen“, so das IDZ. Allerdings könne man diese Asymmetrie verschärfen oder abmildern.
Ähnlich sieht das der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Aachen, gleichzeitig Vorsitzender des „Arbeitskreises Ethik“ der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Prof. Dominik Groß. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient sei schon immer durch eine strukturelle Asymmetrie geprägt gewesen. Durch seine fachliche Kompetenz, so Groß, besitze der Mediziner gegenüber dem Patienten qua Fachwissen einfach eine andere Position [Groß, 2013]. Prof. David Klemperer, Prof. Dominik Groß und Prof. Martin Härter gelten als ausgewiesene Experten beim Thema SDM. Daher soll auf hier auf sie besonders eingegangen werden.
Der Paternalismus hat ausgedient
Groß etwa führt aus, dass in der traditionellen Arzt-Patienten-Beziehung der Behandler paternalistisch Entscheidungen für „seinen“ Patienten trifft. Handlungsleitend ist hier die ärztliche Fürsorge, das charakteristische Kennzeichen dieser Beziehung ist die Rolle des Arztes als „väterlicher“ Helfer. Auch heute ist dieses Modell noch anzutreffen – etwa in akuten Notfallsituationen. In Standardsituationen sei es aber nicht mehr zeitgemäß, so Groß.
Anstelle der paternalistisch geprägten Beziehung wird daher immer mehr einer Begegnung von Arzt und Patient auf Augenhöhe das Wort gesprochen. Hierbei sucht ein mündiger Patient das Gespräch mit seinem Behandler und umgekehrt. Das Ergebnis ihres Austauschs ist nach Groß und anderen Experten auf diesem Gebiet ein „Shared Decision Making“ (SDM) – eine gemeinsame, geteilte Entscheidungsfindung von Arzt und Patient.
Das IDZ verweist auf das Missverständnis, dass das eine Interaktionsmodell besser als das andere sei [IDZ, 2006]. Vielmehr kann jede dieser Gestaltungsweisen der Arzt-Patienten-Beziehung nach Situation, Art der Gesundheitsstörung oder Patient richtig sein.
Zahnmedizin und Entscheidungsfindung
In der Zahnmedizin orientieren sich derweil bereits viele Kollegen am Leitbild des „informierten Patienten“, der am Entscheidungsfindungsprozess beteiligt ist. Laut einer Befragung von 2009 handelt bereits die große Mehrheit der Zahnbehandler danach, 24 Prozent der Befragten halten diese Maxime für „sehr wichtig“, 55 Prozent für „wichtig“ [Groß, 2013]. Ein Grund hierfür liegt sicherlich darin, dass die Zahnmedizin prädestiniert ist für gemeinsame Entscheidungsfindungen, da es in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde für einen Befund verschiedene Therapiemöglichkeiten gibt. Gerade bei den Zahnärzten hängt damit die Wahl der Therapie stark von den ästhetisch gewollten, versorgungstechnisch notwendigen und finanziell leistbaren Vorstellungen der Patienten ab.
Dass es in der Zahnmedizin bei einem Befund verschiedene Versorgungsvarianten gibt, die auch über die Regelversorgung der GKV hinausgehen können, machte 2005 auch die Etablierung des Festzuschuss- Systems deutlich. Seitdem ist für Zahnärzte die Aufgabe, dem Patienten die Therapiealternativen zu erläutern und ihn im Sinne der Patientenpräferenzen zu unterstützen, noch mehr gewachsen, als dies ohnehin schon der Fall war. In der zahnärztlichen Versorgung ist der Patient schon länger nicht nur passiver Leistungsempfänger, sondern ist aufgefordert, aus den Behandlungsoptionen auszuwählen und Entscheidungen zu treffen.
Einen Vorteil für den (Zahn-)Arzt sieht das IDZ darin, dass er die Entscheidung über die Therapie nicht alleine tragen muss und dass in der Regel die Compliance des Patienten deutlich ansteigen dürfte. Auch die Patientenzufriedenheit dürfte nach einer gemeinsam getroffenen Therapieentscheidung in der Regel größer sein „als wenn ’top down’ ärztlicherseits entschieden wird“, so das IDZ [IDZ, 2006].
Gerade vor dem Hintergrund der Informa-tionssuche via Internet, von Gesundheitsportalen, Zweitmeinungsmodellen, evidenz-basierten Patientenleitlinien und anderen Quellen könne SDM eine Möglichkeit darstellen, im Rahmen der Arzt-Patienten-Kommunikation diese Informationen aufzuarbeiten und zu gewichten.
Grundsatz-Positionen von BZÄK und KZBV
Daher begrüßen Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) Entwicklungen hin zu einer partizipativen Entscheidungsfindung als „sinnvoll und notwendig“. Dies unterstreichen beide Körperschaften explizit in einer gemeinsamen Broschüre („Patienten im Mittelpunkt – Die Patientenberatung der Zahnärzte“) aus dem Jahr 2012 [BZÄK/KZBV, 2012]. In ihr wird von den Körperschaften betont, dass die Zahnärzteschaft den mündigen Patienten, der sich informieren und an Therapieentscheidungen partizipieren will, fordert und unterstützt.
BZÄK und KZBV verweisen auch darauf, dass die zahnärztliche Selbstverwaltung schon traditionell das Informationsbedürfnis der Patienten mittels Beratungen und Unterstützungsleistungen (auch in Konfliktsituationen) unterstützen. So hätten schon ab Mitte der 90er-Jahre die (Landes-)Zahnärztekammern und die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen in Eigeninitiative eine objektive, neutrale und fachspezifische zahnärztliche Patientenberatung aufgebaut. „Sie gehörte damals zu den ersten institutionalisierten Beratungsangeboten, die Patienten zur Verfügung standen“, heißt es in der Broschüre.
Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass mit der Einführung des Festzuschuss-Systems die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Patientenberatung um ein bundesweites „Zweitmeinungsmodell“ erweitert hätten, daneben existierten ein umfangreiches und einzigartiges Gutachterwesen mit Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Die Beratung der Patienten, so die Körperschaften, sei ein Baustein der Qualitätssicherungsmaßnahmen der zahnärztlichen Selbstverwaltung und originäre Leistung des Berufsstands selbst.
Konzept der Partizipation
Generell sehen Experten gerade durch das Modell des SDM die klassische Asymmetrie mit ihren festgeschriebenen Handlungsmustern aufgebrochen: Statt mit einem die ärztlichen Anweisungen befolgenden Patienten haben Mediziner es immer mehr mit Kranken zu tun, die durch eigenständig gewonnene (und mit dem Arzt ausgetauschte) Informationen an der medizinischen Entscheidungsfindung teilhaben (wollen). Im Zentrum der Arzt-Patienten-Kommunikation steht damit nicht mehr die reine Wissensvermittlung von oben nach unten, sondern eine gemeinsame Lösungsfindung für ein gesundheitliches Anliegen.
Groß etwa sieht in der umfassenden Aufklärung des Patienten und in der hierauf basierenden ausdrücklichen Einwilligung (der sogenannte „informed consent“) in die ärztliche Behandlung sogar das moderne Charakteristikum und den „Goldstandard“ einer ethisch verantwortlichen Arzt-Patienten-Beziehung.
Zeit für Klärung der Behandlungsoption
Doch die notwendige kommunikative Interaktion zwischen Arzt und Patient stellt die Mediziner vor große Herausforderungen. Aus Sicht des Arztes bedeutet SDM zunächst, dass Mediziner dem Patienten sowohl mehr erklären als auch mehr Zeit darauf verwenden müssen, seine Vorstel-lungen und Prioritäten zu erfragen, um gemeinsam eine Behandlungsoption zu entwickeln und diese dann zu erörtern. Zeit, wohlgemerkt, die im gegenwärtigen Gesundheitssystem nirgendwo adäquat honoriert wird. Befürworter von SDM fügen hier hinzu: Zeit, die gut investiert ist, da sich SDM über gewonnenes Vertrauen der Patient auszahle – in vielerlei Form.
Kommunikation als Wesensmerkmal
Im Entscheidungsprozess zwischen Arzt und Patient kommt damit der richtigen Patientenansprache eine enorm wichtige Bedeutung zu. Damit sich Patienten trauen, ihrem Arzt selbstbewusst gegenüberzutreten, braucht es bestimmter Voraussetzungen im persönlichen Habitus und Auftreten von Ärzten. Ein – zugegebenermaßen überholtes – Selbstverständnis von Medizinern als Götter in Weiß, das eher einschüchtert als aufmuntert, ist dem sicher nicht zuträglich. „Autoritäre Ärzte verhindern Kommunikation“, formuliert etwa Prof. David Klemperer von der Hochschule Regensburg [Klemperer, 2012]. Patienten würden befürchten, den Arzt mit Fragen zu verärgern, dauerhaft als „schwieriger Patient“ abgestempelt und weniger gut behandelt zu werden.
Und so brauchen die Mediziner neben dem fachlichen Wissen immer mehr rhetorische Fähigkeiten. Kommunikationsstile und -strategien bedürfen aber einer gewissen Schulung, um eine optimale Gesprächssituation in der Arzt-Patienten-Beziehung strukturieren zu können und die entsprechende Gesprächshaltung zu bekommen. Zwar wird das Thema Kommunikation in der ärztlichen Ausbildung behandelt, doch ob die nach wie vor spärlichen Lerneinheiten ausreichen, die Wirklichkeit in Praxen und Kliniken zu spiegeln, bezweifeln viele.
Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) etwa hält in einem Bericht fest, dass immer noch viele Ärzte Schwierigkeiten hätten, sich auf das Thema einzulassen [FAS, 2014]. „Sie sind der Meinung, sie pflegen bereits eine gute Gesprächs- und Entscheidungskultur. Eine gemeinsam getroffene Entscheidung ist aber mehr als nur ein gutes Gespräch.“ Im Alltag der Mediziner klafften Wunsch und Wirklichkeit über die geeignete Patientenkommunikation immer noch weit auseinander, so die FAS.
Das IDZ sieht SDM dagegen mit „Leuchtturmfunktion“: Defizite der medizinischen Beratungs- und Entscheidungskommunikation würden mit dem Modell benannt und gleichzeitig Wege zur Verbesserung der Entscheidungsqualität aufgezeigt.
Kranke im Dschungel von Gesundheitsinformationen
Doch auch den selbstbewusster agierenden Patienten fällt im SDM-Modell eine andere Rolle zu. Zwar beanspruchen viele Kranke mittlerweile eine aktivere Rolle im Behandlungsprozess, allerdings: Diese gibt es nicht zum Nulltarif.
Generell kann SDM für den Patienten bedeuten, dass er über den Behandlungsprozess und mögliche Therapiealternativen mitentscheiden kann. Gleichzeitig heißt dies aber auch, dass Patienten sich trauen müssen, den Arzt zu befragen, und dass sie vor der Behandlung gegebenenfalls adäquate Informationen einholen und dabei lernen müssen, seriöse von unseriösen zu trennen.
Doch das ist nicht ohne Risiko, warnt etwa Dietrich Wersich, Facharzt für Allgemeinmedizin und ehemaliger Gesundheitssenator in Hamburg. Die fehlende Qualitätssicherung von medizinischen Informationen aus dem Netz macht Medizinern die Arbeit nicht leicht. Nicht selten, so Wersich, würde fachlichem Unsinn im Netz große Aufmerksamkeit zuteil. Fachleute stimmen zu: Selten sei das, was bei den Suchmaschinen an erster Stelle steht, die beste Information.
Dass die im Cyberspace zur Verfügung stehenden Informationen nutzen und anschließend Ärzte mit (mal mehr, mal weniger glaubhaften) Informationen aus dem Internet konfrontieren, ist auch dem Sachverständigenrat für sein diesjähriges Gutachten ein Schwerpunkt Wert gewesen. Gerade die mangelnde Transparenz bildet den Hintergrund dafür, dass er in seinem Papier, das im Juni in Berlin vorgestellt worden ist, die Bildung eines Instituts für Gesundheitswissen angeregt hat, das verlässliche und verständliche Informationen bereitstellen soll.
Auch SDM stößt an Grenzen
Doch auch das Modell des SDM hat seine Tücken: Der Bildungsstand, die sprachliche Artikulationsfähigkeit und die intellektuelle Verarbeitungskapazität sowie das Alter des Patienten beeinflussen die Beratung – das Konzept stößt an seine Grenzen.
Der Arzt und Psychologe Prof. Martin Härter vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zeigt sich überzeugt: Der Arzt muss sich zunächst an das Sprach- niveau des Patienten anpassen und klären, ob der Patient die Art und die Tragweite der verschiedenen Behandlungsalternativen verstanden hat. Das ist diffizil, denn: Jeder Patient ist verschieden – nicht jeder will eine gemeinsame Entscheidungsfindung (siehe Kasten Patiententypen).
Gerade ältere, schwächere, multimorbide oder sozial bedrängte Patienten hingen bisweilen einem traditionellen Rollenverständnis an und überantworten die Therapieentscheidungen gerne dem Arzt, so Härter. Zudem setze SDM einen aktiven Patienten voraus – „und längst nicht jeder Patient fühlt sich in einer solchen Rolle wohl“.
Wunsch und Wirklichkeit
Durch das Gespräch können zwar Informationsdefizite beim Patienten verringert werden, jedoch ist davon auszugehen, dass aufgrund der Ausbildung und der Erfahrung des Arztes eine Informationsasymmetrie bestehen bleibt. Trotz vordergründiger Partnerschaftlichkeit behalte der Arzt auch im SDM-Konzept sein Informationsmonopol, so auch die Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen [ZEFQ, 2010].
Die auszutauschenden Informationen seien alles andere als trivial, sondern vielmehr komplex und meist mehrdeutig. Patienten seien mit der Verarbeitung von medizinischem Fachwissen oft über- fordert, zumal sie emotional in die sie selbst betreffenden Entscheidungen involviert seien.
Ihr Urteil: SDM sei noch nicht zu einem in sich stimmigen Konzept gereift. Die Dekanin für Gesundheitswirtschaft an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen, Prof. Johanne Pundt, kommt in ihrem dieses Jahr erschienenen Buch „Patientenorientierung – Wunsch oder Wirklichkeit“ ebenfalls zu dem Schluss, dass die Informationsasymmetrie und das Machtgefälle zwischen Arzt und Patient eine gelungene Kommunikation der Beteiligten erschweren. Sie fordert spezielle Qualifizierungsangebote für Mediziner, um kommunikative Fähigkeiten aufseiten der Ärzte zu schulen, damit sie Patienten sachgerecht begegnen können [Pundt, 2014].
Diese agieren wohl tatsächlich je nach Naturell, Lebenssituation, Krankheitszustand und ärztlichem Gegenüber mal eher zurückhaltend, mal eher selbstbewusst auftretend. Insbesondere das postmoderne Bild des „steuernden Patienten“, so wirft Groß ein, treffe wohl nur für eine kleinere (allerdings wachsende) Gruppe von Mitbürgern zu, „die an Neuen Medien und Gesundheitsfragen besonders interessiert sind“ [Groß, 2013].
Unterschiedliche Ansichten akzeptieren
Ältere Patienten sind, sagen die Experten, in aller Regel noch häufig fixiert auf die traditionelle Rollenverteilung. In einer Studie der Uni Bremen und der Bertelsmann Stiftung 2005 über SDM räumt Klemperer ebenfalls ein: Patienten unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen nach Information und Kommunikation. Bei SDM handele es sich um ein „Konzept, das die Bedürfnisse vieler, aber nicht aller Patienten berücksichtigt“ [Klemperer, 2005].
Auf der anderen Seite, da sind sich die Experten ebenfalls sicher: SDM kann als probates Mittel angesehen werden, die Asymmetrie etwas besser auszutarieren. Sie verweisen darauf, dass eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwar bedeutet, dass der Arzt die Akzeptanz aufbringen muss, Entscheidungen des Patienten hinzunehmen und nicht als Niederlage des eigenen Expertentums zu begreifen. Gleichzeitig gehöre zur Akzeptanz des Patientenwillens aber auch, so Wersich, diejenigen Patienten, die „blind vertrauen“ und keine Details wissen wollten nicht mit gutgemeinter Aufklärung zu bestürmen, sondern ihre Einstellung anzunehmen.