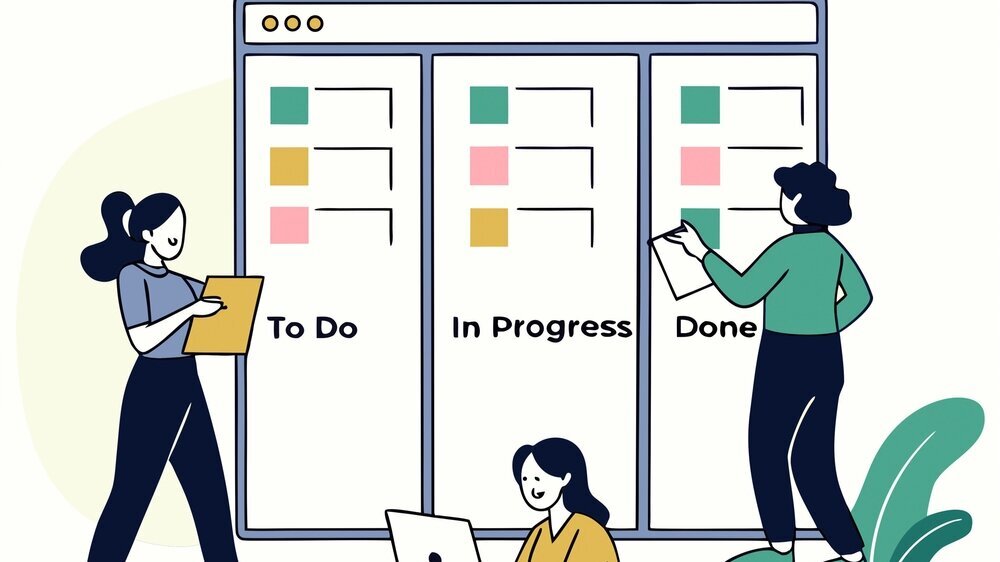Führung anders leben
Immer mehr Patientinnen und Patienten erwarten heute eine Praxis, die nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch schnell reagiert und über verschiedene Kanäle kommuniziert. Qualität allein genügt nicht mehr – gefragt ist ein nahtloses, patientenorientiertes Erlebnis. Hinzu kommt, dass viele der qualifiziertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich heute (gerade in großen Praxen) als Mitgestaltende des Praxisgeschehens verstehen. Sie wollen ihre Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen. Werden sie nicht beteiligt, gehen sie. Und das ist ein Verlust, den sich kaum eine Praxis leisten kann. Gleichzeitig verändert sich die Zusammensetzung der Teams. Immer häufiger stoßen Fachfremde oder Ungelernte dazu. Führungskräfte sollten diese Vielfalt nicht nur integrieren, sondern gezielt nutzen.
Seit der Corona-Pandemie arbeiten außerdem immer mehr Beschäftigte remote, etwa in der Verwaltung oder Abrechnung. Sie adäquat einzubinden, ihren Beitrag sichtbar zu machen und den Team-Zusammenhalt über Distanz zu sichern, ist eine neue Führungsaufgabe, die kommunikatives Geschick und Vertrauen erfordert. Parallel dazu verändert die Digitalisierung den Praxisalltag grundlegend: Neue Software-Lösungen, KI-gestützte Systeme und digitale Workflows bringen Chancen, aber eben auch Unsicherheiten. Sie verlangen ständige Anpassung und Lernbereitschaft – von den Mitarbeitenden wie auch von der Führung. Wo früher einmal getroffene Entscheidungen für Jahre Bestand hatten, müssen Abläufe heute regelmäßig überprüft, angepasst und verbessert werden.
Agilität ist nicht Chaos
Ob man möchte oder nicht – zahnärztliche Praxen müssen sich permanent an neue Gegebenheiten anpassen. Gleichzeitig bleibt aber auch heute klassische Führungsverantwortung unverzichtbar, etwa in Bereichen wie Hygiene, Qualitätsmanagement oder Abrechnung. Praxisführung bewegt sich also im Spannungsfeld zwischen klassischer Hierarchie und Selbstorganisation, zwischen Präsenz und Remote-Arbeit, zwischen Tradition und Innovation. Die zentrale Kompetenz, um dieses Spannungsfeld zu meistern, heißt aus unserer Perspektive: Agilität.
Wir verstehen Agilität als Fähigkeit, sich schnell und selbstorganisiert an neue Situationen anzupassen, ohne dabei Orientierung und Qualität zu verlieren. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Software-Entwicklung, wo klassische Planungsmethoden zu langsam für die dynamische Realität waren. Anstatt starre Pläne zu verfolgen, begann man, Projekte in kurzen Schritten („Sprints“) zu organisieren, Feedback frühzeitig einzuholen und Verantwortung in Teams zu verankern. Übertragen auf die Zahnarztpraxis bedeutet Agilität nicht Chaos oder Führungslosigkeit, sondern das komplette Gegenteil: klare Ziele, kurze Entscheidungswege, schnelle Lernzyklen und Vertrauen in die Selbstorganisationsfähigkeiten des Teams.
Agilität ist kein Rezept für alle Fälle. Es gibt Situationen, in denen sie unerlässlich ist und andere, in denen sie sogar gefährlich wäre.
Kontra-Beispiel Medizinprodukte: Bei der Aufbereitung von Instrumenten oder dem Umgang mit Medizinprodukten sind Standards zwingend. Abweichungen vom Ablaufplan gefährden Sicherheit und Qualität. Hier ist Präzision gefragt.
Pro-Beispiel KI-Nutzung: Statt lange detailliert zu planen, kann ein kleines Team die Ansätze in der Praxis erproben, Rückmeldungen sammeln und Abläufe kontinuierlich anpassen. So entsteht Schritt für Schritt ein funktionierendes System, das von allen getragen wird.
Die Faustregel ist: Wo Sicherheit, Stabilität und klare Abläufe notwendig sind, bleiben klassische Arbeitsweisen unverzichtbar. Wo Ungewissheit, Neuheit oder Komplexität herrschen, ist Agilität das wirksamere Prinzip der Zusammenarbeit.
Zu Beginn steht die richtige innere Haltung
Agilität lässt sich nicht per Anweisung „einführen“. Sie beginnt mit einer inneren Haltung – dem Mindset. Im Zentrum stehen Werte, die das tägliche Miteinander in der Praxis prägen:
Offenheit für Veränderung: Wer agil denkt, betrachtet Wandel nicht als Störung, sondern als Normalität und oft sogar als Chance, Dinge besser zu machen.
Kunden-/Patientenzentrierung: Alle Entscheidungen orientieren sich am Nutzen des jeweiligen Kunden. Das sind zuerst einmal die Patienten und die Kriterien sind Versorgungsqualität und Zufriedenheit. Man kann jedoch auch andere Stakeholder der Praxis als Kunden betrachten und deren Bedürfnisse ins Kalkül ziehen, zum Beispiel die Zahntechnik, die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen oder Banken. In diesen Fällen führen Nutzenbetrachtungen zur Optimierung der Zusammenarbeit und letztendlich zu Zeiteinsparungen auf beiden Seiten.
Eigenverantwortung: Mitarbeitende übernehmen aktiv Verantwortung, bringen Ideen ein und warten nicht auf Anweisungen.
Lernorientierung: Fehler werden als Quelle für Prozessverbesserungen verstanden. Es werden keine Schuldigen gesucht, sondern die Abweichungen werden als Optimierungspotenzial betrachtet. So entsteht eine Kultur, in der Lernen selbstverständlich ist.
Transparenz und Vertrauen: Informationen werden offen geteilt, Entscheidungen nachvollziehbar getroffen. Vertrauen ersetzt Kontrolle, wo es möglich ist.
Kollaboration: Lösungen entstehen gemeinsam durch regelmäßige Rückmeldungen, iterative Arbeitsweisen und den Mut, Dinge auszuprobieren und wieder zu verwerfen, wenn sie nicht funktionieren.
„Agile Führung“ bedeutet in diesem Sinne nicht, auf Führung zu verzichten, sondern sie anders zu leben: Führung schafft Orientierung, klärt Ziele und gestaltet Rahmenbedingungen, in denen Selbstorganisation möglich wird. Sie steuert nicht jedes Detail, sondern befähigt das Team, eigenständig zu handeln. Neben der Haltung braucht Agilität jedoch auch Methoden, die diese Denkweise im Alltag unterstützen. Bewährt haben sich kurze, regelmäßige Teamtreffen („Stand-ups“ oder „Weeklys“), klar definierte Verantwortlichkeiten, Feedbackschleifen und transparente Aufgabenlisten. Diese Werkzeuge sind einfach anzuwenden. Ihre Wirkung entfalten sie aber nur, wenn sie von der richtigen Haltung getragen werden. Ohne sie bleiben sie reine Routine.
Zwei Fallbeispiele aus der Praxis
Fall 1: Klassische Führung in turbulenten Zeiten: In der Praxis von Dr. Karin Klassisch beginnt der Tag mit zwei Krankmeldungen. Zwei ZFA fallen kurzfristig aus. Die Behandlungspläne sind eng getaktet. Die Zahnärztin reagiert schnell: Sie teilt zu Beginn des Tages die verbliebenen Mitarbeitenden den Behandlerinnen zu. Die angestellte Zahnärztin arbeitet mit der Auszubildenden im ersten Lehrjahr, der Assistenzzahnarzt soll die Schmerzsprechstunde ohne Assistenz übernehmen und die erfahrene ZFA wird Dr. Klassisch selbst bei ihrer prothetischen Behandlung unterstützen. Nach kurzer Zeit zeigt sich: Die Auszubildende ist überfordert, der Assistenzzahnarzt kommt zeitlich nicht hinterher und die Stimmung kippt. Jeder arbeitet für sich, keiner weiß so recht, wie die anderen zurechtkommen. Das Ergebnis: hoher Stress, wenig Flexibilität und ein unzufriedenes Team.
Fall 2: Agiles Vorgehen in turbulenten Zeiten: In der Praxis von Dr. Agnetha Agil beginnt der Tag ähnlich: Auch hier haben sich zwei ZFA krankgemeldet. Wie jeden Morgen trifft sich das Team zu einem kurzen Stand-up-Meeting. Gemeinsam werden die Tagesplanung und die Herausforderungen durchgesprochen. Die Beteiligten schauen gemeinsam in die Bestellliste und stellen fest, dass bei Dr. Agil eine längere Brückenpräparation für den Vormittag geplant ist. Die Assistenzzahnärztin hat erst die Schmerzsprechstunde und wird dann Füllungen legen. Die angestellte Zahnärztin hat einen Vormittag, der vornehmlich mit konservierender Zahnheilkunde und Parodontologie gefüllt ist.
Das Team legt die Abläufe gemeinsam fest und trifft auch klare Kommunikationsabsprachen. Während der Präparation wird die Auszubildende bei Frau Agil assistieren. In dieser Zeit wird die ZFA die Schmerz-Sprechstunde betreuen, damit diese so zügig wie möglich abläuft. Anschließend wird sie die Auszubildende ablösen, die dann zur angestellten Zahnärztin wechselt. Diese hatte angeboten, die ersten anderthalb Stunden allein zu arbeiten. Die Assistenzzahnärztin wird dann nach der Versorgung der Schmerzpatienten allein weiterarbeiten. Sollte es Engpässe geben, informiert die Rezeption sofort die ZFA.
Das Meeting dauert diesmal zehn statt fünf Minuten, aber danach startet das Team mit einem klaren Plan und einem guten Gefühl in den Tag. Der Vormittag verläuft nicht perfekt, aber strukturiert und relativ ruhig.
Agiles Arbeiten braucht klare Kommunikationsstrukturen und -techniken, damit die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bei den richtigen Personen ankommen. Ein Beispiel dafür ist das erwähnte morgendliche Stand-up-Meeting. Doch Agilität erschöpft sich nicht in einem kurzen Treffen. Agilität bedeutet auch nicht, mehr Zeit in Besprechungen zu verbringen, sondern andere Kommunikationswerkzeuge zu integrieren. Agilität wächst mit der Haltung, Verantwortung zu teilen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Je eigenverantwortlicher und kooperativer Teams handeln, desto besser können sie in komplexen Situationen reagieren und desto stabiler bleibt die Praxis auch in Zeiten des Wandels.
Serie „Agilität und organisationale Resilienz“
Teil 1: Was bedeutet Agilität und warum kann sie für Praxen nützlich sein? (zm 21/2025)
Teil 2: Welche Meetings machen Sinn, welche können ausfallen?
Teil 3: Wie behalte ich den Fokus und erziele messbare Ergebnisse?
Teil 4: Wie gestalte ich die Patientenkontakte effizient?
Fazit
Agilität in der Zahnarztpraxis heißt nicht, dass man bewährte Strukturen aufgibt. Sie bedeutet vielmehr, Handlungsfähigkeit in unsicheren Zeiten zu sichern. Dort, wo klare Regeln und Sicherheit zählen, bleibt klassische Führung unverzichtbar. Dort, wo Wandel und Komplexität dominieren, schafft Agilität Flexibilität, Motivation und Beteiligung. Führungskräfte, die beides beherrschen, können ihre Praxis nicht nur stabil durch den Alltag steuern, sondern auch entspannt durch den permanenten Wandel führen.