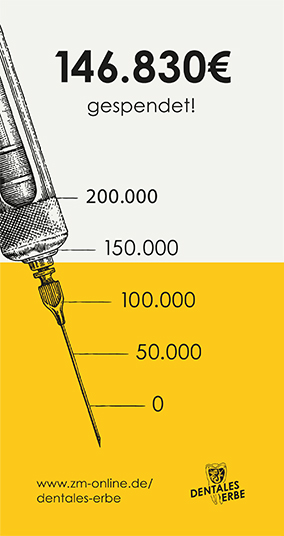Der Patient im Rampenlicht
Der Patient steht im Mittelpunkt des Gesundheitswesens und damit jedem im Weg“– ein schlechtes Bonmot, das der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Manfred Richter- Reichhelm, zitierte, um es gleich darauf durch die Diskussionen des KBV-Symposiums „Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen“ ad absurdum führen zu lassen. Patientenbeteiligung ist nicht erst wieder durch das KBV-Symposium vom 25. bis 26. Oktober 2001 in Königswinter ins Rampenlicht des öffentlichen Interesses gerückt. Viele Tagungen und Veranstaltungen haben sich in den letzten Wochen und Monaten mit dem Thema beschäftigt: Die Diskussionen häufen sich, es werden Empfehlungen ausgesprochen, Gutachten erstellt und Experten befragt. Der Patient steht im Lichtkegel der Gesundheitspolitik. Aber es wird kaum hinterfragt, ob das ein Aspekt des Zeitgeistes ist oder ob tatsächlich langfristige Konzepte dahinter stecken. Genauso offen ist es, wo der Patient eigentlich am besten aufgehoben ist: Vermeintlich geschützt durch ein Regelwerk von Überprotektionismus oder frei, souverän und eigenverantwortlich selbst entscheidend. Am Ende aller Diskussionen wird man hier Farbe bekennen müssen.
Von wem ist eigentlich die Rede? Ist es der Patient als Bürger, als souveräner Konsument, Kunde, Versicherter, oder Co-Produzent im Gesundheitswesen? Zum einen geht es um alle Bürger, die an allen sie betreffenden Fragen im Gesundheitswesen beteiligt werden sollen. Dann geht es um den kranken Menschen, der vertrauensvoll zu seinem Arzt oder Zahnarzt geht, um geheilt zu werden. Das Thema Patientenrechte (siehe auch zm-Titelstory 8/1999) und Patientenbeteiligung ist also eng verknüpft mit dem Verständnis des Arzt- Patienten-Verhältnisses. Dieses hat sich bekanntlich stark gewandelt. Statt eines paternalistischen Verhältnisses stehen Partnerschaft und Vertrauen im Zentrum des Behandlungsgeschehens. Der Patient nimmt aktiv, konstruktiv und gestaltend an seinem Genesungsprozess teil. Das Wissensgefälle zwischen dem Arzt und dem Patienten hat sich verändert, der Patient ist souverän, mündig und informiert. Aber: Er benötigt auch Beratung und solide abgesicherte Information, denn angesichts eines wachsenden medizinischen Fortschritts und hoher Spezialisierung entstehen Transparenz- und Orientierungsprobleme.
Nutzer des Wettbewerbs
Die Zahnärzteschaft hebt schon seit langem in ihrem Reformkonzept der Vertrags- und Wahlleistungen das Prinzip des souveränen Patienten hervor. Nur dieser, so unterstreichen die Zahnärzte, kenne seine individuellen Verhältnisse und könne auf Grundlage des Gesprächs mit dem Zahnarzt seines Vertrauens entscheiden, welche Behandlungen er in Anspruch nehmen will oder kann. Erst kürzlich wieder erklärte der KZBV-Vorsitzende Dr. Karl Horst Schirbort vor der Presse in Berlin, dass der Patient der Nutznießer des Wettbewerbs sein müsse, weil er den Wettbewerbsprozess entscheidend bestimme. Seine Souveränität und Eigenverantwortung müsse weiter gestärkt werden. Jedoch, so bekräftigte der stellvertretende KZBV-Vorsitzende, Dr. Peter Kuttruff, der Patient könne diese Rolle nur dann übernehmen, wenn er über mehr Informationen verfüge, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Kuttruff wörtlich: „Das System insgesamt muss transparenter für den Patienten gestaltet werden.“ Darum müsste die Kostenerstattung in Verbindung mit transparent zu gestaltenden Festzuschüssen eingeführt werden. Darüber hinaus müssten Patienten kontinuierlich über Qualitätsleitlinien in der Zahnbehandlung informiert werden.
Die bereits etablierten und sehr gut angenommenen Patientenberatungsstellen der zahnärztlichen Selbstverwaltung müssen weiter ausgebaut werden, das betont die Bundeszahnärztekammer. Der Patient müsse im Mittelpunkt stehen und sowohl seinen Zahnarzt, seine Leistung wie auch seine Krankenkasse frei wählen können, unterstrich BZÄK-Präsident Dr. Dr. Jürgen Weitkamp erst jüngst wieder auf der Bundesversammlung in Mainz. Und BZÄK-Vizepräsident Dr. Dietmar Oesterreich erklärte, dass in Punkto Patientenberatung in den Ländern bereits eine Menge geschehe, die Beratungsstellen stünden flächendeckend zur Verfügung und würden weiter ausgebaut. Es gebe gut funktionierende Kooperationsmodelle mit Verbraucherzentralen.
Von der Politik forciert
Zu den politischen Fakten: In den Koalitionsvereinbarungen von Rot-Grün 1998 wurde festgelegt, die Patientenrechte zu stärken und die Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen voran zu bringen. Ein Anliegen, das vor allem der Ex-Gesundheitsministerin Andrea Fischer wichtig war. Bei ihrem Amtsantritt betonte ihre Nachfolgerin Ulla Schmidt erneut, dass im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik der Patient stehen müsse – klare Prioritätensetzung also seitens der Politik. Mit der GKV-Gesundheitsreform 2000 sind erste Regelungen zur Stärkung der Patientenrechte ins Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgenommen worden. Zu nennen sind unter anderem folgende Schwerpunkte:
• Qualitätssicherung (§§ 135 ff SGB V): Patientenorientierung gehört zum integralen Bestandteil der Qualität medizinischer Versorgungsleistungen
• Integrierte Versorgung (§§ 140 ff SGB V): Hier soll das Patienteninteresse durch Optimierung von Behandlungsabläufen verstärkt werden
• Prävention und Selbsthilfe (§§ 20 ff SGB V): Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge des Patienten werden erheblich ausgebaut. Die Förderung von Selbsthilfeeinrichtungen wird mit 70 Millionen Mark (rund 35 Millionen Euro) von den Krankenkassen gestärkt.
Als völlig unzureichend beklagte zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP) die Förderung der Selbsthilfe. Nicht einmal ein Drittel der ihnen zustehenden Fördermittel hätten die Gruppen der gesundheitlichen Selbsthilfe von den Krankenkassen erhalten.
Gerade den Aspekt der Förderung der Prävention hat die Zahnärzteschaft stark begrüßt. So erklärte BZÄK-Präsident Dr. Dr. Weitkamp erst jüngst wieder bei Bekanntwerden der neuen Eckpunkte von Ulla Schmidt: „Prävention aller Altersgruppen ist ein Konzept, für das wir Zahnärzte uns seit langem stark machen.“ Prävention und Eigenverantwortung sind Begriffe, die auch in den Diskussionen am Runden Tisch unter maßgeblicher Beteiligung der Zahnärzteschaft eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings erteilen die Zahnärzte Plänen wie der Einführung eines Gesundheitspasses eine deutliche Absage. Quittungen seien keine Lösung, um Transparenz ins Gesundheitswesen zu bringen. Der Patient trage keinerlei Verantwortung für die Quittung und deren Begleichung, heißt es bei der KZBV.
Patientenberatung, eine Maßnahme, die der Zahnärzteschaft schon lange am Herzen liegt, wurde seit der Gesundheitsreform 2000 als ein weiteres ganz zentrales Anliegen des Gesetzgebers formuliert. Die Krankenkassen wurden deshalb verpflichtet (§ 65 b SGB V), unabhängige Einrichtungen zur Verbraucher- und Patientenberatung mit jährlich zehn Millionen Mark (rund fünf Millionen Euro) im Rahmen von Modellprojekten zu fördern. Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben ist vorgesehen.
Die Spitzenverbände haben zur Umsetzung dieser Vorschrift eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, auf die sich 291 Institutionen beworben haben.
Auch Kammern haben sich beteiligt, sind aber bedauerlicherweise nicht berücksichtigt worden. 31 Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, von Verbraucherzentralen, Sozialverbänden, Selbsthilfeorganisationen und Universitäten wurden aufgrund der Entscheidung einer unabhängigen Jury im März 2001 letztendlich einbezogen (eine Liste dieser Einrichtungen findet sich unter www.g-k-v.com/einrichtungsliste. html). Das Modellvorhaben läuft jetzt über drei Jahre.
Arbeitsgruppe eingerichtet
Doch mit Patientenberatung ist es nicht getan. Vielmehr geht es der Politik von Rot- Grün darum, eine Stärkung von Patientenrechten und Patientenschutz vorzunehmen und eine Patientenbeteiligung zu etablieren. Basierend auf einem Vorschlag der 72. Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) vom Juni 1999 in Trier hat das Bundesgesundheitsministerium Ende 1999 eine Arbeitsgruppe „Patientenrechte in Deutschland: Fortentwicklungsbedarf und Fortentwicklungsmöglichkeiten“ einberufen. Es galt, Ansatzpunkte für einen weiteren Werdeprozess der Patientenrechte aufzuzeigen, zu bewerten und Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. Der Gruppe gehören an: Bundesgesundheits- und Bundesjustizministerium, die Gesundheitsressorts der Länder, die Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen, Verbraucherund Patientenschutzverbände, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Krankenpflegepersonen, die Bundesärztekammer, die KBV sowie die Bundeszahnärztekammer. Die Arbeitsgruppe hat inzwischen ihre Tätigkeit abgeschlossen, die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet und es werden entsprechende Umsetzungsvorschläge erstellt, über die die Gesundheitsministerkonferenz in Kürze beraten wird. Zu folgenden Unterarbeitsgruppen wurden Berichte vorgelegt:
• Verbesserung der Transparenz im Gesundheitswesen
• Institutionelle Erweiterung der Patientenbeteiligung
• Arztvertragsrecht und Behandlungsfehlerhaftung
„Als großer Zwischenerfolg ist die Bereitschaft der Arbeitsgruppenteilnehmer zu bewerten, trotz ihrer unterschiedlichen Interessenlagen gemeinsam zu diskutieren, konstruktiv zusammenzuarbeiten und möglichst einverständlich Lösungsmöglichkeiten zu finden“, erklärte Dr. Erwin Smigielski, Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, auf der KBV-Tagung in Königswinter. Bei den weiteren Reformüberlegungen der Bundesregierung werde das Thema Patientenberatung und Patientenrechte im Mittelpunkt stehen. Doch von einem gesonderten Patienten-Gesetz, so seine Botschaft aus dem BMG, sei derzeit keine Rede.
„Alle Akteure im Gesundheitswesen wollen mehr Patientenbeteiligung“, subsumierte KBV-Chef Richter-Reichhelm am Ende der Königswinter-Tagung. Da sind sich auch die politischen Parteien einig: Patienteninteressen sollen gestärkt werden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Regina Schmidt-Zadel, sagte, man werde auf ein Patientenberatungsgesetz hinarbeiten. Zunächst wolle man aber die Modellprojekte auswerten. Wolfgang Lohmann, Vorsitzender der CDU/CSU-Arbeitsgruppe Gesundheit, betont, dass ein breiter gesundheitspolitischer Konsens zu dem Thema wichtig sei. Er plädiert für eine gestärkte Eigenverantwortung des Patienten. Eine Meinung, die auch Detlef Parr, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss teilt; er warnt aber vor Überregulierungstendenzen.
Offen ist, wie die Stärkung der Patienteninteressen aussehen soll. Zu unterscheiden ist zwischen:
• individuellen Patientenrechten
• kollektiver, institutionalisierter Beteiligung von Patienten im Gesundheitssystem. Individuelle Patientenrechte sind in Deutschland bereits vorhanden, eine einheitliche Kodifizierung existiert jedoch nicht. Die 72. Gesundheitsministerkonferenz hat im Juli 1999 erstmals die wesentlichen bestehenden Rechte in einem Papier „Patientenrechte in Deutschland“ erarbeiten lassen. Dabei ging es um die Aufstellung von Regelungen, die im Sozialrecht, im Haftungsrecht, im Strafrecht, in den Berufsordnungen der Kammern oder weiteren Vorschriften bereits verbrieft sind. Im Herbst 1999 legte die Bundesärztekammer eine „Charta der Patientenrechte“ vor.
Viele offene Fragen
Viele Fragen bleiben offen. Gestritten wird derzeit darüber, ob es ein einheitliches Gesetz geben soll. Erst kürzlich wieder hat der „Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv“ (in den die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände AgV übergegangen ist) mehr Transparenz und ein entschiedeneres Vorgehen gegen Missbrauch im Gesundheitswesen gefordert und sich in dem Zusammenhang energisch für einen Ausbau von Patientenrechten ausgesprochen. Am liebsten wäre ihnen ein Patientenschutzgesetz. Thomas Isenberg, Fachbereichsleiter Gesundheit und Ernährung beim vzbv: „Wenn man eine wirksame Ausgabenkontrolle darüber haben will, was wirklich mit dem Patienten medizinisch gemacht wird, dann müssen wir die Patientenrechte massiv stärken.“
Den Krankenkassen geht es um mehr Transparenz des Gesundheitsmarktes und um mehr Patientenbeteiligung. Sie wollen eine Verbesserung der Patientenrechte und Patientensouveränität, einen gesundheitlichen Verbraucherschutz auf individueller Ebene durch Kodifizierung unter Einschluss notwendiger Rechtsverbesserungen für den Patienten, erklärte Anja Mertens, Stabsbereich Recht des AOK-Bundesverbandes. Bejaht werde eine Patientencharta für Deutschland im Konsens aller Akteure. Die Ärzte- und Zahnärzteschaft spricht sich für eine Stärkung im Form einer Charta aus, lehnt hingegen eine Kodifizierung in Gesetzform ab.
Auch am Thema Arzthaftungsrecht und Behandlungsfehlerhaftung und der Patientenbeteiligung scheiden sich die Geister. Gudrun Schaich-Walch, SPD, parlamentarische Staatssekretärin im BMG, sprach sich zum Beispiel auf einer Tagung zum Thema Patientenrechte Ende September in Dresden dafür aus, eine Beweislastumkehr beim Arzthaftungsrecht verfassungsrechtlich festzuschreiben. Die Verbraucherschützer fordern ebenfalls eine Änderung der Rechtslage. Die Ärzte- und Zahnärzteschaft wehrt sich energisch gegen ein solches Vorhaben und wird darin auch vom Bundesjustizministerium gestützt. Die Forderung sei mit der Systematik des gesamten Haftungsrechts nicht vereinbar. Hingewiesen wird auf eine bereits umfassende Rechtsprechung zu Beweislast und Beweiserleichterung beim Arzthaftungsrecht. Auch das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass die Tätigkeit des Arztes eine Form der gefahrgeneigten Arbeit darstellt, bei der keine umfassende Überwälzung des Haftungsrisikos auf den Arzt möglich ist.
Aktive Teilnahme
Bei der institutionalisierten Beteiligung geht es um aktive Partizipation. Das heißt, legitimierte Vertreter von Patienten und Bürgern sollen als gleichberechtigte Akteure im Gesundheitswesen Gestaltungs- und Entscheidungskompetenz erhalten. Kollektive Beteiligungsrechte gelten in Deutschland als defizitär. Die Frage ist, ob das tatsächlich ein so großes Manko ist. Auch im Ausland ist es damit noch nicht so weit her, aber aus einigen EU-Ländern (Niederlande, Großbritannien. Finnland) liegen schon Erfahrungen vor. EU-weit spielt das Thema eine wichtige Rolle. In Frankreich zum Beispiel wird derzeit die Einführung eines Patientenrechtgesetzes auf den Weg gebracht. Das vierte „European Health Forum“ vom September in Bad Gastein stellte eine Umfrage vor, derzufolge es bei den Patientenrechten in Europa einen erheblichen Nachholbedarf gebe. Der EU-Gesundheitskommissar David Byrne erklärte dort, dass in absehbarer Zeit das Recht auf Gesundheit und medizinische Versorgung als Grundrecht für die EU-Bürger festgeschrieben werden solle. Auch seitens des Europarates wurde Bürger- und Patientenbeteiligung Anfang 2000 als prioritäres Ziel eingestuft.
Ein Rechtsgutachen der Professoren Dr. Robert Francke und Dr. Dieter Hart, Bremen, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums und des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums kommt zu dem Schluss, dass in Deutschland Defizite bei der kollektiven Beteiligung vorliegen. Sie stellen unter anderem Modelle für eine mögliche Institutionalisierung vor. Denkbar sind:
• Verfahrensbeteiligung (zum Beispiel Anhörung, Stellungnahme)
• Beratungsbeteiligung (Beratungsrechte)
• Entscheidungsbeteiligung (zum Beispiel Mitentscheidungs- oder Zustimmungsrechte)
Die dritte Bank bleibt leer
Die Gutachter schlagen keine so genannte „dritte Bank“ (die der Patienten) im Gesundheitswesen vor, sondern bevorzugen Modelle der Verfahrens- und Beratungsbeteiligung nach jeweiliger Kosten-Nutzen- Abwägung. Jetzt wird kontrovers diskutiert, auch in der BMG-Arbeitsgruppe. Uneinigkeit herrscht, um ein konkretes Beispiel zu nennen, über eine Einbindung der Patienten im Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen. Die Krankenkassen lehnen die „dritte Bank“ aus rechtlichen Erwägungen ab. Ebenso tun dies die Ärzte und sprechen sich für die Ernennung von Ombudsleuten aus. Um berechtigte Interessen einzubringen, sollten Patientenorganisationen Stellungnahmen abgeben.
Bei der Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien könne man sich eine Patientenbeteiligung ebenso vorstellen wie bei Clearing- Verfahren, zum Beispiel bei der Ärztlichen Zentralstelle für Qualitätssicherung (ÄZQ), heißt es bei der Bundesärztekammer.
Auch bei der Umsetzung von Disease- Management-Programmen (DMPs) hält die Ärzteschaft die Einbindung von Patienten für wichtig. Vor kurzem stellte die KBV zusammen mit Patientenvertretern in Berlin drei DMP-Entwürfe für die Krankheitsbilder Asthma, Diabetes und Bluthochdruck vor. Patienten trügen mit ihrer Sachkunde zur Qualität der strukturierten Behandlungsprogramme bei, hieß es dort seitens der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V. . Diese plädiert im Übrigen dafür, Patienten an allen Fragen im Gesundheitswesen zu beteiligen. Das müsse nicht unbedingt eine Entscheidungsbeteiligung sein. „Wir wollen zuerst einmal eine qualifizierte Beratungsbeteiligung und nicht gleich überall mitentscheiden“ erklärte Geschäftsführer Christoph Nachtigäller in Königswinter.
Das Bundesgesundheitsministerium fördert Modellprojekte zur Beteiligung der Patienten im medizinischen Entscheidungsprozess. Seit September werden zehn Projekte unterstützt, die Methoden erproben, mit denen die Einbeziehung der Patienten verbessert werden kann. Dazu stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Mark (rund 3,25 Millionen Euro) zur Verfügung. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit einer Änderung des Heilberufegesetzes zum 1. Januar 2001 vorgesehen, dass Patientenorganisationen das Recht erhalten, juristische oder medizinische Fachleute als Patientenvertreter vorzuschlagen.
Eine Frage der Legitimation
Nach wie vor intensiver Beratung bedarf die Frage der demokratischen Legitimation von Organisationen, die Patienteninteressen vertreten. Bisher fast völlig unter den Tisch gefallen ist die Frage, welche Pflichten die Patienten eigentlich haben. Selbsthilfegruppen sind für ganz bestimmte Bereiche (zum Beispiel chronisch Kranke, Rheuma) zuständig. Sie sind aber nicht in der Lage, für alle Patienten kompetent zu sprechen. Langfristig wird sich aufgrund pragmatischer Lösungen herauskristallisieren, wer mit eingebunden wird.
Mit offenem Ergebnis diskutiert wird die Frage, wer eigentlich der Anwalt der Patienten ist. Verbraucherschützer und Patientenvertreter reklamieren die Anwaltschaft für sich. Die AOK sieht sich als Interessenvertreter oder „Anwalt der Versicherten“ für ihre Versicherten und Patienten. Die Ärzte sehen sich als Anwälte der Patienten, wobei die KBV auf dem Königswinter-Symposium als neue Richtung formulierte: „Wir verstehen uns als Partner der Patienten“.
Neue Wege der Zusammenarbeit mit Patientenvertretern hat die Ärzteschaft eingeschlagen. Seit 1999 gibt es in der KBV eine Koordinierungsstelle für Selbsthilfeorganisationen, die den Kontakt zu ihnen aufnehmen, pflegen und intensivieren soll. Eine solche Einrichtung gibt es auch auf Länderebene bei einigen KVen. Weiterhin wurde das Patientenforum gegründet, ein von der Bundesärztekammer gemeinsam mit der KBV eingerichtetes Gremium. Seitens der Patientenvertreter sind die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, die Mitgliedsverbände des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen beteiligt. Alle sind gleichbereichtigt. Aufgabe ist es, den Austausch von Informationen zu ermöglichen und Anliegen zwischen Ärzteschaft und Patientenselbsthilfe zu vermitteln, wie BÄK-Vizepräsidentin Dr. Ursula Auerswald erläuterte.
Erster Schwerpunkt ist die Qualitätsverbesserung von Patienteninformationen. Mit der Ärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung (ÄZQ) und in Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover wird die Qualität medizinischer Fachinformationen für Laien überprüft und bewertet (zum Beispiel medizinische Websites). Diskutiert wird die Vergabe eines Gütesiegels für Laieninformationen.
Auch die Krankenkassen sind aktiv. Der AOK-Bundesverband zum Beispiel hat ein Gesamtkonzept der AOK im Handlungsfeld Patientenrechte und Verbraucherschutz erarbeitet. Dazu gehört ein Behandlungsfehlermanagement, das inzwischen nach Modellerfahrungen der AOK Rheinland flächendeckend im gesamten Bundesgebiet läuft. Spezielle Service-Teams, die mit den Ärzten des medizinischen Dienstes der Krankenkassen zusammenarbeiten, stehen für die Versicherten zur medizinischen und juristischen Beratung zur Verfügung. Ab 1.1.2002 startet nach abgeschlossener Pilotphase im Bereich der AOK Niedersachsen eine Patientenberatung mit umfassendem Service.
Weiterhin bietet die AOK medizinische Beratung am Telefon in Form eines Call-Centers an. Der Dienst heißt CLARIMEDIS und wird flächendeckend ausgebaut. Derzeit existiert er für die Versicherten in Rheinland- Pfalz, Sachsen, Westfalen-Lippe und Sachsen-Anhalt, ab 2002 wird er im Saarland und in Schleswig-Holstein angeboten und in anderen Ländern stufenweise eingeführt.
Eine zentrale Aufgabe
Die Zahnärzteschaft betrachtet das Thema als zentrale Aufgabe. Auf einer Klausurtagung Ende Juni 2000 in Mainz legte der Vorstand der Bundeszahnärztekammer fest, dass sich der Berufsstand mit dem Thema Patientensouveränität auseinandersetzen wird. Als Marschrichtung wurde unter anderem damals festgelegt, die Patientenberatungsstellen als unabhängige Stellen weiter auszubauen, eine Patientencharta zu schaffen, eine transparente und öffentliche Darstellung der Arbeit der Schlichtungsstellen voran zu treiben oder sich auf europäischer Ebene bei den Diskussionen um die Bürgerrechtscharta einzubringen. Vieles geschieht bereits in den Ländern als Umsetzung von Kammeraufgaben.
Zur Schaffung von qualitätsgesicherten Patienteninformationen hat die Bundeszahnärztekammer vor kurzem eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde beschlossen, ein ehrgeiziges und umfangreiches Projekt. Derzeit werden sukzessive Informationen für Patienten konzipiert, auf der Liste stehen zunächst Themen wie Implantologie oder Schwangerschaft. Eine Evaluation der Information bezüglich der Nutznießung durch den Patienten ist vorgesehen.
Und im Jahr 2002, so legte es der Geschäftsführende Vorstand der BZÄK auf seiner letzten Sitzung fest, wird die Bundeszahnärztekammer die Belange des Patienten zu einem großen Arbeitsschwerpunkt machen und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Dabei wird das Konzept eines souveränen und eigenverantwortlichen Patienten im Rampenlicht stehen.