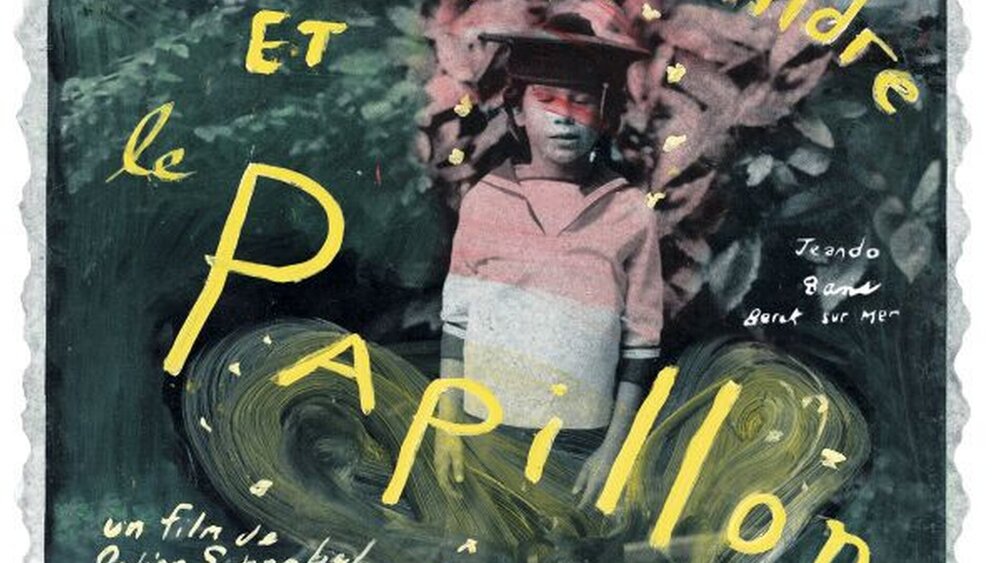Leben in Auszeit
Die Zahl der Wachkomapatienten hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland auf rund 10000 fast verdoppelt. Zwar hat sich in der Versorgung schon eine Menge getan, dennoch gibt es Lücken. Vielen Betroffenen bleibt der Weg in eine Spezialeinrichtung verschlossen, sie werden von Angehörigen zu Hause gepflegt oder in Pflegeheimen betreut. Mit zunehmendem Kostendruck im Gesundheitswesen ist auch der Rehabilitationsprozess gefährdet. Betroffene und deren Familien vermissen die optimale institutionelle Unterstützung, auch weil es dazu noch keine einheitlichen Leitlinien gibt. Hier setzen einige Initiativen an.
Espassiert jeden Tag, irgendwo in Deubchland. Ob Herzinfarkt oder Schlaganfall, Autounfall oder Himhautentzündung – es gibtverschiedene Gründe, die ein Koma verursachen künnen. Wird das Gehim über mehrere Minuten nicht ausreichend durchblutet, verliert der Mensch das Bewusstsein und fällt ins Koma. Je nach individueller Unterversorgung künnen die Schüdigungen des Hims stark variieren, dementsprechend ändem sich auch die Ausprägungen der Bewusstlosigkeit. Nur wenn absolut keine Himtätigkeit mehr messbar ist, spricht man vom Himtod. Dieser Zustand ist irreversibel – himtote Patienten sind ohne intensivmedizinische Maβnahmen nicht lebensfähig. Andere Patienten mit leichteren Schädigungen erlangen von alleine das Bewusstsein wieder.
Etwa ein Drittel aller Komapatienten bleibt im sogenannten Wachkoma hängen, auch apallisches Syndrom genannt. Die Patienten atmen meist selbstständig und ihre Augen sind geöffnet – ihr Blick geht allerdings ins Leere. Manche dieser Patienten reagieren auf bestimmte Schmerzreize und haben noch Reflexe, aber sie zeigen in der Regel keine Reaktionen auf Stimmen und können nicht aktiv kommunizieren. Die Diagnose des Wachkomas wird erst gestellt, wenn ein solcher Zustand über Monate fortdauert. Bei optimaler therapeutischer Versorgung besteht auch für Patienten mit dem apallischen Syndrom eine gute Chance, wieder zu erwachen. Es weiß nur niemand, wann. Es gibt Patienten, die nach über 20 Jahren Wachkoma wieder erwacht sind. Andere bleiben in der Bewusstlosigkeit bis zum Tod.
Verbesserte medizinische Versorgung
Rund 10 000 Wachkomapatienten gibt es zurzeit in Deutschland, ihre Zahl hat sich im vergangenen Jahrzehnt fast verdoppelt. „Die Zahl der Unfallopfer ist vor allem im Baugewerbe und im Bereich des Extremsports gestiegen. Hinzu kommt, dass immer mehr Komafälle von Kleinkindern verzeichnet werden, die im elterlichen Gartenteich fast ertrunken wären. Durch die verbesserte medizinische Versorgung überleben heute mehr Patienten ihre Unfälle und bleiben dann im Wachkoma hängen“, erklärt Prof. Christel Bienstein, Leiterin des Departments für Pflegewissenschaften an der Universität Witten/Herdecke. Die Wissenschaftlerin hat 1999 im Auftrag des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums die Versorgung von Wachkomapatienten untersucht und Vorschläge für eine Qualitätsverbesserung erarbeitet.
Bienstein: „Die Versorgungslage war seinerzeit überwiegend schlecht. Patienten, die nicht von Angehörigen gepflegt wurden, lagen meist in Altenheimen, die für die speziellen Bedürfnisse der Komapatienten nicht ausreichend eingerichtet waren.“ Doch seitdem habe sich eine Menge getan, so die Pflegewissenschaftlerin. Spezialeinrichtungen wurden aufgebaut und die Kostenträger bei der Verhandlung und der Finanzierung neuer Versorgungskonzepte mit ins Boot geholt. Mittlerweile hat sich ein ausgeklügeltes Phasenmodell der therapeutischen Behandlung etabliert, die Patienten profitieren von einer deutlich verbesserten Frühförderung – wenn sie in der richtigen Einrichtung behandelt werden. „Zwar ist die Versorgungssituation heute deutlich entspannter als noch vor zehn Jahren. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, dass die Lage seit einiger Zeit stagniert und man sich auf dem Erreichten ausruht.“
Von einer flächendeckenden Versorgung mit speziellen Behandlungszentren für alle Wachkomapatienten könne noch immer keine Rede sein, so Bienstein. Viele Patienten werden nach wie vor von Angehörigen versorgt oder in Pflegeheimen untergebracht. Da die Pflegekasse nur einen kleinen Anteil der Pflegekosten übernimmt, kommen auf die Familien sehr hohe Kosten zu. Dazu gebe es häufig noch ein Kompetenzgerangel zwischen Kranken- und Pflegekasse: „Die Angehörigen werden immer wieder beim Antrag auf Kostenübernahme spezieller Therapien zwischen den Kostenträgern hin- und hergeschoben. Viele Familien empfinden das als zermürbend.“
In den neuen Behandlungszentren sieht die Lage hingegen besser aus: Die Einrichtungen haben in der Regel spezielle Verträge mit den Krankenkassen und können neben der reinen Pflege dementsprechend andere Kosten abrechnen, als dies in normalen Pflegeheimen der Fall ist. Folglich sinke auch der von der Familie zu übernehmende Restbetrag, so Bienstein.
Doch immer noch werden 70 Prozent der Komapatienten zu Hause von Angehörigen gepflegt. „Diese Patienten brauchen sehr viel Pflege, sie atmen durch einen Luftröhrenschnitt und können natürlich auch nicht selbst zur Toilette gehen“, beschreibt Bienstein den Aufwand. „Wie diese Pflege zu Hause auf einem Standard gehalten werden kann, der das Leid der Patienten erträglicher macht, ist eine der Forschungsaufgaben unserer Universität.“ Für die Familien sei die Pflege eines Angehörigen im Wachkoma eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Häufig seien es die Frauen, die diese Aufgabe übernähmen und daher weniger Zeit für die übrige Familie hätten. In den von der Uni Witten/Herdecke untersuchten Fällen seien viele Ehen an dieser Belastung zerbrochen, erklärt Bienstein.
Zahnärztliche Betreuung
Ob häusliche Pflege oder Betreuung im Pflegeheim – die zahnärztliche Versorgung von Wachkomapatienten ist problematisch. Denn die Versorgungsnotwendigkeiten präventiver, therapeutischer oder oralrehabilitativer Art erfordern eine ganz spezielle Versorgung. Ohne kontinuierliche zahnärztliche Betreuung werden bei den Betroffenen oft Entzündungen im Mund- und Rachenraum nicht rechtzeitig erkannt und behandelt – mit teilweise weitreichenden Konsequenzen. Bakterien, die bei entzündetem Zahnfleisch ins Blut gelangen, können beispielsweise zu Diabetes, einer Lungenentzündung oder einem Schlaganfall führen.
US-Forscher des amerikanischen Gesundheitsinstituts (NIH) haben nun vier Bakterienarten des Mundraums (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia und Trepo-nema denticola) identifiziert, die vor allem das Herz-Kreislauf-System angreifen und zu einer Endokarditis (Herzentzündung) beziehungsweise zum Herzinfarkt führen können. Das Problem: In der Regel ist der ambulante Zahnarztbesuch weder für Angehörige noch für das professionelle Pflegepersonal eine realistische Option. Hat der Patient kariöse Zähne oder Entzündungen im Mundraum, bleibt nur der Gang in die Zahnklinik.
Seit 2005 zeigt ein wissenschaftlich begleitetes Projekt in 53 Münchener Pflegeheimen, dass es auch anders geht. Bei dieser Kooperation der Teamwerk-Gruppe, der AOK Bayern, dem Sozialreferat der Stadt München sowie der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) werden die Pflegeheimbewohner – wenn auch nicht speziell Wachkomapatienten – regelmäßig durch Zahnärzte vor Ort betreut. „Die verbesserte zahnmedizinische Betreuung erhöht die Lebensqualität der Heimbewohner und führt zugleich zu Einsparungen“, so Dr. Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern. Die Pflegebedürftigen, die in ihrer Mobilität deutlich eingeschränkt seien, würden im Pflegeheim am Bett aufgesucht. Durch die Vorsorge, zu der beispielsweise auch eine professionelle Zahnreinigung gehört, verringern sich nach Angaben der AOK die Entzündungen im Mundraum nennenswert. Dadurch komme es auch zu weniger Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislaufsystems sowie zu weniger Schlaganfällen und somit zu einer geringeren Zahl an Krankenhauseinweisungen. Trotz dieser Erfolge ist eine aufsuchende Betreuung durch Zahnärzte außerhalb von solchen Projekten immer noch eine Randerscheinung. Eine Ursache dafür könnten unter anderem honorarrechtliche Fragen sein, etwa wenn es um die Anerkennung der Besuchsgebühren geht. Außerdem ist die Betreuung von Wachkomapatienten sehr aufwendig und erfordert ein spezielles Fachwissen (siehe Interview).
Großes Rehapotenzial
Bundesweit fallen nach Angaben des Selbsthilfeverbands „Schädel-Hirnpatienten in Not“ jedes Jahr rund 20 000 Menschen ein bis zwei Wochen in ein tiefstes Koma, weitere 20 000 Patienten bleiben bis zu vier Wochen im Koma, und rund 3 000 Betroffene fallen in ein Wachkoma von mindestens sechs Monaten. Ein Drittel dieser Patienten könne wieder in das soziale Umfeld der Familie zurückgeführt werden, ein weiteres Drittel durch konsequente Reha sogar wieder in Beruf oder Schule reintegriert werden, so Armin Nentwig, Vorsitzender des Verbands. Dieses riesige „Rehabilitationspotenzial“ könne allerdings nur realisiert werden, wenn qualifizierte Therapeuten, engagiertes Pflegepersonal sowie fachlich versierte Mediziner und Logopäden eine koordinierte Behandlung umsetzten. „Die qualifizierte Frührehabilitation in unmittelbarem Anschluss an die neurologische oder neurochirurgische Intensivstation ist der zentrale Baustein auf dem Weg zurück aus dem Wachkoma“, betont Nentwig.
Es gebe mittlerweile im gesamten Bundesgebiet rund 4 000 qualifizierte Frühreha-Behandlungsbetten für Patienten mit apal-lischem Syndrom – 1988 seien es noch 25 Behandlungsbetten gewesen, so Nentwig weiter. „Heute wird in vielen Gebieten bereits eine flächendeckende Versorgung sichergestellt, allerdings gibt es immer noch einige unterversorgte Regionen und vor allem für Kinder und Jugendliche eine oftmals gänzlich fehlende Versorgung.“ Die prinzipiell positive Entwicklung in der Versorgung führt Nentwig auf konsequente Lobbyarbeit zurück. Seit sein eigener Sohn 1988 nach fünf Monaten Wachkoma starb, hat der ehemalige bayerische Landtagsabgeordnete zunächst in Bayern und spä-ter bundesweit großen Einfluss genommen auf die Einführung einer konsequenten Rehakette von Phase A bis Phase G (siehe Kasten).
Im zunehmenden Kostendruck sieht Nentwig die größte Gefahr, bereits erzielte Fortschritte in der Versorgung wieder zu verlieren. Nachdem Anfang der 90er-Jahre die konzeptionellen medizinischen Grund-lagen und Leitlinien zur Frührehabilitation erarbeitet worden seien, habe es eine „Blütezeit“ in den Jahren 1995 bis 2005 gegeben. In dieser Periode sei es möglich gewesen, Patienten im und nach dem Wachkoma für neun bis zwölf Monate frührehabilitativ zu behandeln. Im Zuge der Kostendebatte im Gesundheitswesen sei der Behandlungszeitraum in den letzten Jahren allerdings wieder drastisch minimiert worden. Heute besteht zwar ein rechtlicher Anspruch auf Rehabilitation, aber „es mehren sich die Fälle, wo Krankenkassen bereits nach drei Wochen die weitere Finanzierung verweigern mit dem Argument, es sei kein Rehapotenzial mehr vorhanden“, so Nentwig weiter. Dabei zeigten wissenschaftliche Untersuchungen, dass eine solche Argumentation – abgesehen von einigen Einzelfällen – fachlich unzulässig sei. Denn neurologische Frührehabilitation brauche vor allem eines: Zeit. Und Zeit kostet nunmal Geld.
Fehldiagnose Wachkoma
Wie viel nimmt ein Mensch wahr, der im Koma liegt und sich nicht mitteilen kann? Das herauszufinden sei eine Schwierigkeit, mit der Ärzte täglich konfrontiert seien, sagt der Neurowissenschaftler Steven Laureys, Leiter des Zentrums für Komaforschung an der Universität von Lüttich. Gerade bei Wachkomapatienten gelte eine Diagnose oft als Gratwanderung, da viele Untersuchungsmethoden unzulänglich seien. Rund 40 Prozent aller Diagnosen bei Patienten im Wachkoma seien vermutlich falsch. Tatsächlich befänden sich die Patienten zumeist in einem sogenannten Zustand minimalen Bewusstseins (MCS – minimally conscious state). Dies ist das Ergebnis einer zweijährigen Studie, die Laureys Forscherteam durchführte und die in der Fachpublikation „BMC Neurology“ veröffentlicht wurde. MCS-Patienten sind dem Wachzustand näher als dem Koma. Sie reagieren gelegentlich klar auf die Umwelt, können teilweise hören und sehen und reagieren auf Erzählungen und Anweisungen. Mit einer gezielten Therapie haben sie deutlich bes-sere Chancen als Wachkomapatienten, wieder das Bewusstsein zu erlangen.
Die falsche Einordnung als Wachkoma-patient kann für die Betroffenen schwere Folgen haben – etwa, wenn auf ihrer Grundlage die Entscheidung getroffen werde, rehabilitative Maßnahmen einzustellen oder sogar lebenserhaltende Maßnahmen zu beenden.
Den Grund für die häufigen Fehldiagnosen sieht Laureys darin, dass oft unzureichende Diagnosemethoden angewendet würden. Die Unterscheidung zwischen Wachkoma und MCS sei eine der schwierigsten Aufgaben für Mediziner überhaupt. Ob und wie sehr ein Mensch im Wachkoma bei Bewusstsein ist, versucht Laureys anhand der Positronen-Emmissions-Tomografie (PET) zu analysieren. Die PET ist eine sehr aufwendige und teure Diagnosetechnik, liefert aber laut Laureys auch genauere Ergebnisse über den Zustand eines Komapatienten. Der Hirnscanner zeigt eindeutig, welche Hirn-areale noch funktionsfähig sind und gibt damit wichtige Hinweise für die weitere Therapie. Laureys hatte 103 Patienten mit Bewusstseinsstörungen untersucht. Die derzeit gängige Methode erwies sich dabei besonders anfällig für Fehldiagnosen.
Locked-in-Syndrom
Als dramatischste Fehleinschätzung eines Wachkomapatienten gilt der Fall des Belgiers Rom Houben, ebenfalls ein Patient von Steven Laureys. Houben soll 23 Jahre lang bei vollem Bewusstsein in seinem gelähmten Körper gefangen gewesen sein, ohne sich mitteilen zu können. Nach einem Autounfall hatten die Ärzte ihn für einen Komapatienten ohne Bewusstsein gehalten, bis Laureys 2009 nach einigen Tests das Locked-in-Syndrom bei Houben diagnostizierte. Das Großhirn war offenbar nur wenig geschädigt – Laureys meinte, Houben sei nicht nur in der Lage, Gefühle zu empfinden, sondern sogar fähig, diese zu kommunizieren. Dem „Spiegel“ gab Houben ein weltweit beachtetes Interview, wonach er 23 Jahre lang alles um ihn herum genau wahrgenommen habe, ohne sich mitteilen zu können. Die Interviewfragen beantwortete der Patient mithilfe einer Computertastatur. Seine gelähmte rechte Hand wurde dabei von einer Logopädin gestützt.
Jeden Einzelfall prüfen
Zahlreiche Kritiker meldeten nach der weltweiten Berichterstattung des Falles Zweifel an der Geschichte des Patienten an. Sie unterstellten, das Verfahren, mit dem Houben kommuniziert haben soll, sei ein typisches Beispiel für die umstrittene „gestützte Kommunikation“. Das Verfahren vermittle nur den Anschein, dass der bewusstseinsgestörte Patient kommuniziere – in Wahrheit kämen die Aussagen unterbewusst von der Hilfsperson. Laureys reagierte auf die Vorwürfe und unterzog die Kommunikation einem Test: Rom Houben wurden in Abwesenheit der Logopädin Worte genannt, die er anschließend mithilfe der Logopädin tippen sollte. Dies gelang jedoch nicht ein einziges Mal. Trotz dieses Rückschlags steht für Laureys die Diagnose des Locked-in-Syndroms aufgrund des Diagnoseverfahrens außer Frage. Der Neurowissenschaftler und sein Forscherteam suchen seitdem nach einem anderen Weg, mit dem Patienten eine eindeutige Kommunikation aufzubauen. Die Methode des gestützten Schreibens sieht Laureys durch den Versuch allerdings nicht diskreditiert. Ein anderer gelähmter Proband mit vergleichbarer Hirndiagnose, den Laureys ebenfalls untersuchte, lag bei den Kontrollfragen 15-mal richtig, erklärte der Wissenschaftler gegenüber dem Spiegel: „Das bedeutet, man muss wirklich jeden Einzelfall prüfen.“
Otmar MüllerFreier gesundheitspolitischer Fachjournalistmail@otmar-mueller.de