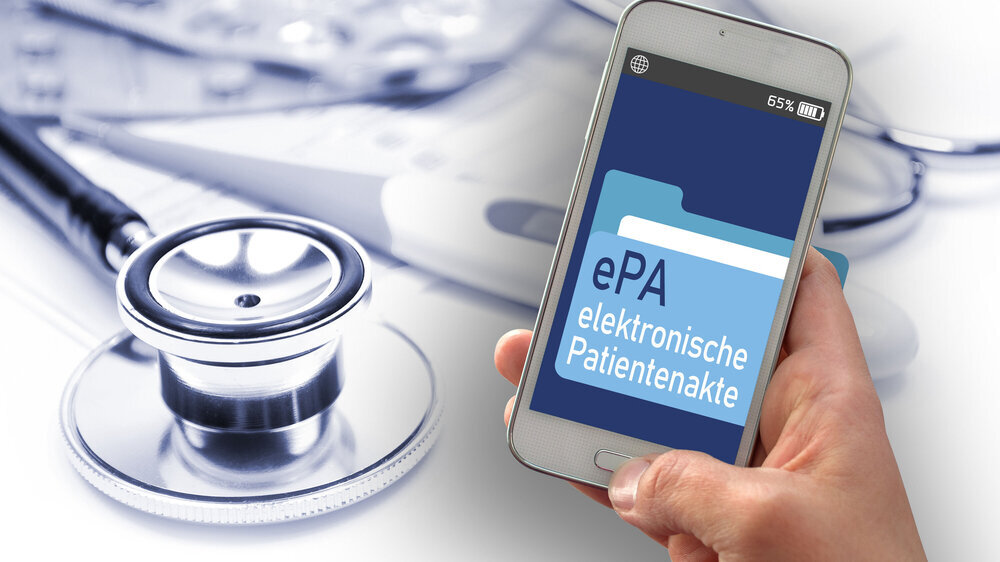„Die ePA ist noch nicht nutzerfreundlich“
Der Rollout der „ePA für alle“ zu Beginn des Jahres markiert einen Paradigmenwechsel, stellte IKK-Vorstandsvorsitzender Hans Peter Wollseifer in seinem Eingangsstatement heraus. „Noch ruckelt es im System. Technische Hürden und mangelnde Nutzerfreundlichkeit sorgen für Frust“, räumte er ein. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der IKK habe aber gezeigt, dass die Mehrheit der Versicherten der ePA positiv gegenüberstehen. Zudem biete die elektronische Akte viele Vorteile: Sie beschleunige Kommunikationsprozesse, mache Informationen besser verfügbar, unterstütze die Forschung und trage zum Bürokratieabbau bei. Außerdem trage sie dazu bei, Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Um die ePA erfolgreich zu machen, brauche es drei Dinge: einfache Prozesse, Vertrauen und eine koordinierte Steuerung durch Politik und Selbstverwaltung, führte der Vorstandschef aus. „Es liegt in unserer Hand. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die ePA alltagstauglich wird“, betonte Wollseifer.
Medikationsliste bietet konkreten Nutzen
Sie sei sehr glücklich, dass die ePA in Betrieb sei, sagte Dr. Annette Rennert. Die Hausärztin aus Dortmund bezeichnete die digitale Akte als „Gamechanger“ und „hellen Stern für unsere Arbeit“. Endlich gebe es eine Plattform, auf der sich Ärzte austauschen könnten. Einen konkreten Nutzen biete die Medikationsliste, berichtete Rennert. Davon profitierten auch Menschen ohne eigenen Zugang wie etwa Pflegeheimbewohner. Denn durch die Medikationsliste erhalte sie erstmals einen Überblick über die Medikation ihrer Patientinnen und Patienten; dies erleichtere den Versorgungsalltag und sei ein großer Gewinn für die Patientensicherheit. Probleme gibt es aus Sicht der Hausärztin noch mit der Strukturierung von Daten. Außerdem brauche es mehr Anwendungen und weitere Ausbaustufen, führte die Hausärztin aus.
„Dieses Jahr sind wir einen riesigen Schritt vorangekommen und nicht mehr weit vom Regelbetrieb entfernt“, sagte Lena Dimde, Product Ownerin der ePA bei der gematik. Zwar funktioniere die technische Infrastruktur noch nicht reibungslos und es gebe viele Ausfälle; daran arbeite die gematik. Auch die Zugänge seien noch nicht so einfach, wie sie sein sollten.
„Wir sind noch dabei, einen guten Mittelweg zwischen Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit zu finden“, erläuterte Dimde. Dazu müsse auch der Dialog mit den Patienten geführt werden. Im Vergleich zu anderen Ländern stünde Deutschland aber gar nicht so schlecht da, befand die gematik-Expertin, und verwies darauf, dass die Einführung der ePA eines der größten IT-Projekte Europas sei.
Erkan Ertan, Leiter des Arbeitsstabs des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, verglich Deutschland mit einem großen und schwerfälligen Tanker. Daher dauere es seine Zeit, bis ein Projekt wie die ePA ins Laufen komme. Gleichzeitig setze Deutschland mit der ePA-Einführung Standards.
Patienten befähigen, eigenständig mit Daten umzugehen
Ertan kritisierte, dass die elektronische Patientenakte „noch nicht nutzerfreundlich“ sei. Die Befähigung der Patientinnen und Patienten, eigenständig mit ihren Daten umzugehen, sei das größte Projekt und zugleich die größte Herausforderung. „Wenn die Politik nicht die Rahmenbedingungen schafft, wird die Wirtschaft es übernehmen – das birgt Risiken für die Patienten“, warnte Ertan. Die nächsten Meilensteine müssten patientenorientierter sein, um Vertrauen zu stärken. „Vertrauen muss man sich über Jahre erarbeiten, aber es kann auch schnell verloren gehen“, so Ertan.
Robert Leitl, Verwaltungsratsvorsitzender der BIG direkt gesund und Mitglied im Beirat der gematik, wünscht sich die ePA als eine interoperable Plattform, an der künftig auch kassenbezogen neue Dienste andocken können. Darüber hinaus wünscht sich Leitl, dass die Kassen die ePA-Daten für präventive Angebote nutzen dürfen.
Mehr Information und Aufklärung notwendig
Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass für die weitere Akzeptanz der ePA die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz entscheidend ist. Um das zu erreichen, müssten die Patienten noch stärker über die ePA informiert und aufgeklärt werden. Leitl sieht hier aber einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag: Die Aufgabe der Kassen sei es, regelmäßig zu informieren, aber die Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten müsse auf breiten Schultern getragen werden.
ELGA in Österreich genießt hohe Akzeptanz
Das Äquivalent zur elektronischen Patientenakte (ePA) ist in Österreich die elektronische Gesundheitsakte (ELGA), die vor rund zehn Jahren eingeführt wurde. Über das österreichische System informierte bei der IKK-Veranstaltung am 19. November Dr. Stefan Sabutsch, Technischer Geschäftsführer der ELGA GmbH, der digital zugeschaltet war. Wie in Deutschland wurde das System mit einer Widerspruchsregelung eingeführt. Anders als die ePA sei die ELGA jedoch ein System „von Profis für Profis“. Die Bürger könnten lediglich „mitschauen“, spielten aber keine aktive Rolle. Dennoch sei die Akzeptanz hoch: Lediglich drei Prozent der neun Millionen Österreicherinnen und Österreicher hätten Widerspruch eingelegt. Entscheidend für die Akzeptanz seien insbesondere die Schulung und Aufklärung der Anwender sowie die Nutzerfreundlichkeit, betonte Sabutsch.
Die komplexen Finanzierungs- und Steuerungsstrukturen erschwerten zu Beginn die Entwicklung, führte er aus. In Österreich finanzieren und steuern Bund, Länder und Sozialversicherung im Konsens die ELGA. Die Netzwerke funktionierten „sehr gut“. Am meisten genutzt werde die elektronische Medikationsliste. Weitere Anwendungen seien elektronische Befunde, Bilddaten und der elektronische Impfpass. In der Anwendung „e-Bilddaten“ würden allerdings lediglich Verweisdokumente gespeichert, nicht die Bilddaten an sich.
Auch bei der ELGA gibt es laut Sabutsch noch Verbesserungsbedarf. So stammen Befunde bisher fast nur aus Krankenhäusern; die Anbindung der Praxen sei erst 2026 vorgesehen. Das System werde noch weiter ausgebaut: Geplant seien die Einführung eines elektronischen Medikationsplans sowie der Anwendungen „e-Behandlungsplan“, „e-Patientenverfügung“ sowie einer Patientenkurzakte. Eine Plattform gerichteter Kommunikation sei ebenfalls geplant. Anders als in Deutschland wurde die Nutzung von Daten für die Forschung bei der Einführung des Systems ausgeschlossen, berichtete Sabutsch. Er verwies darauf, dass das Gesundheitstelematikgesetz eine grundlegende Überarbeitung benötige. Dies habe sich die Regierung auf die Fahnen geschrieben, so Sabutsch.
„Wir sind gar nicht so schlecht, wie wir uns oft sehen. Ich wünsche mir, dass das Vertrauen in die ePA wächst und das Feld nicht den großen Tech-Konzernen überlassen wird“, sagte IKK-Geschäftsführer Jürgen Hohnl in seinem Schlusswort. Um mehr Vertrauen in die ePA zu erreichen, sei mehr Patientenorientierung nötig, betonte Hohnl.