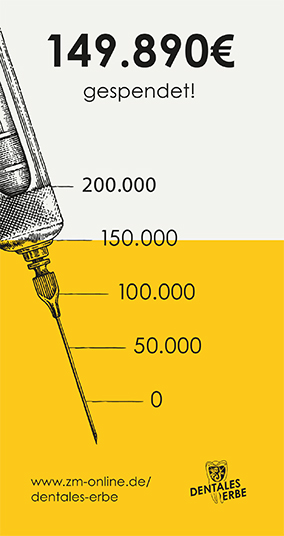Patientenorientierung - auch gut für Ärzte?
"Schon 1990 wurden die ersten politischen Rahmenbedingungen errichtet, um mehr Patientenorientierung in unserem Gesundheitssystem zu implementieren", führte Moderatorin Jessica Beyer von der apo-Bank in das Thema ein. "Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2003 wurde dann das Amt des Patientenbeauftragten geschaffen und nun das Patientenrechtegesetz. Doch was bringt das überhaupt?"
Kommunikation auf Augenhöhe
"Ein wesentlicher Punkt ist, dass mit dem Patientenrechtegesetz die Patienten auf Augenhöhe wahrgenommen werden", erklärte Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Patientenbeauftragter der Bundesregierung. "Das heißt, Arzt und Patient sprechen über den Erfolg und die Prozedur einer Behandlung, so dass der Patient am Ende weiß, worauf er sich einlässt. Diese Transparenz schafft Vertrauen!"
Transparente Strukturen - "damit tun wir uns im Gesundheitswesen noch schwer", konstatierte Laumann. "Doch als Patientenvertreter muss ich ein großes Interesse daran haben, dass Ärzte auch schwierige Fälle übernehmen und operieren. Deshalb müssen wir gute Behandlungsstrukturen finden." Eine "dicke Lanze" brach Laumann für das System der Freiberuflichkeit, "weil sie immer auch Patientenorientierung - im Sinne von Unabhängigkeit im System - bedeutet".
Zahnmedizin: Der Patient steht im Zentrum
Was Patientenorientierung für die Zahnärzteschaft bedeutet, machte der KZBV-Vorsitzende Dr. Wolfgang Eßer klar: "Bei uns steht der Patient im Zentrum des Versorgungsgeschehens. In keinem Bereich ist die Eigenverantwortung so stark mit dem Behandlungserfolg verquickt wie bei uns. Der Patient muss das Recht und die Freiheit haben, sich frei zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlich anerkannten Therapien zu entscheiden. Dadurch sind soziale Härten vermeiden - jeder kann wählen."
Der Patient sei dadurch nicht mehr passiver Empfänger einer Leitung, sondern Partner auf Augenhöhe. Eßer: "Gerade weil wir Wahltherapien anbieten, hat jeder Zahnarzt die Pflicht, die Patienten über die Kosten einer Behandlung aufzuklären und über ihre Chancen, Risiken zu informieren und dazu Alternativen aufzuzeigen - das bedingt die offene Kommunikation zwischen Arzt und Patient."
"Unser bester Patient ist der aufgeklärte Patient" erläuterte Eßer weiter, "denn gute Qualität können wir im Ergebnis nur erzielen, wenn ein vertrauensvoller Dialog stattfindet. Das geschieht bei uns mithilfe der Gutachter und in Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen wie der UPD, mit der wir seit 2013 eine Kooperation haben."
Mithilfe des zahnärztlichen Zweitmeinungsmodell schaffe man eine klare transparente Kommunikation mit dem Patienten und Möglichkeiten, sich über die Praxis hinaus beraten zu lassen. Eßer: "Das ist kostenlos und unbürokratisch."
"Die Zahnärzte haben es uns vorgemacht!"
Kannapinn: Dass nur ein zufriedener Arzt - "das heißt ein freiberuflich tätiger Arzt" - Patienten gut behandeln kann, erörterte Dr. Ulrich Kannapinn , Vorsitzender des Verbandes der Ruhr-Knappschaftsärzte: "Wir fragen uns jeden Tag, wie wir unsere Praxis so ausrichten können, dass die Versicherten zufrieden sind und wiederkommen", sagte er. "Die Zahnärzte haben es uns vorgemacht: Ihre Patienten haben seit Jahren ihr Bonusheft und damit ein Interesse an der Prophylaxe, um die Kosten zu senken. Aber wie kriegen wir das hin?" Der Schlüssel ist für ihn die Selbstbeteiligung des Patienten an der Behandlung: "Diese Selbstbeteiligung muss ins System!"
Daniel Friebe , Geschäftsführer der Saale-Klinik Halle und IVM plus GmbH beantwortete die Frage, inwieweit die Fast-Track Chirurgie die Patientenorientierung verschlechtert. Ziel dieser "Schnellspur"-Chirurgie ist, durch die Anwendung evidenzbasierter Behandlungsmaßnahmen allgemeine Komplikationen nach operativen Eingriffen zu vermeiden, die Rekonvaleszenz der Patienten zu beschleunigen die Liegedauer im Krankenhaus zu verkürzen. Friebe: "Die Rahmenbedingungen müssen für ärztliche Praxen und Krankenhäuser gleich sein. Dann haben wir einen Qualitätswettbewerb und da ist der Patient immer der Gewinner."
"Die Pflege ist schlecht organisiert!"
Einen Blick auf die Pflege warf Kerstin Paradies, Vorstandssprecherin der Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege (KOK) Deutsche Krebsgesellschaft e.V. "Es wird die Pflege, wies sie vor 20 Jahren gab, nicht mehr geben," konstatierte sie. Die Pflege sei immer Mittler zwischen Patient, Familie und Arzt. Paradies: "Hier braucht es mehr Kompetenzen." Man wolle den Ärzten nicht ihre Kompetenzen streitig machen, aber: "Delegation und Substitution werden sich mehr durchsetzen." Zum Beispiel in der Beratung onkologischer Fälle: "Hier gibt es 6.800 Präparate!" Laumann stimmte zu: "Keine Frage: Die Pflege ist schlecht organisiert. Hier braucht es schlagkräftige Berufsverbände, die sich emanzipieren und neu aufstellen."