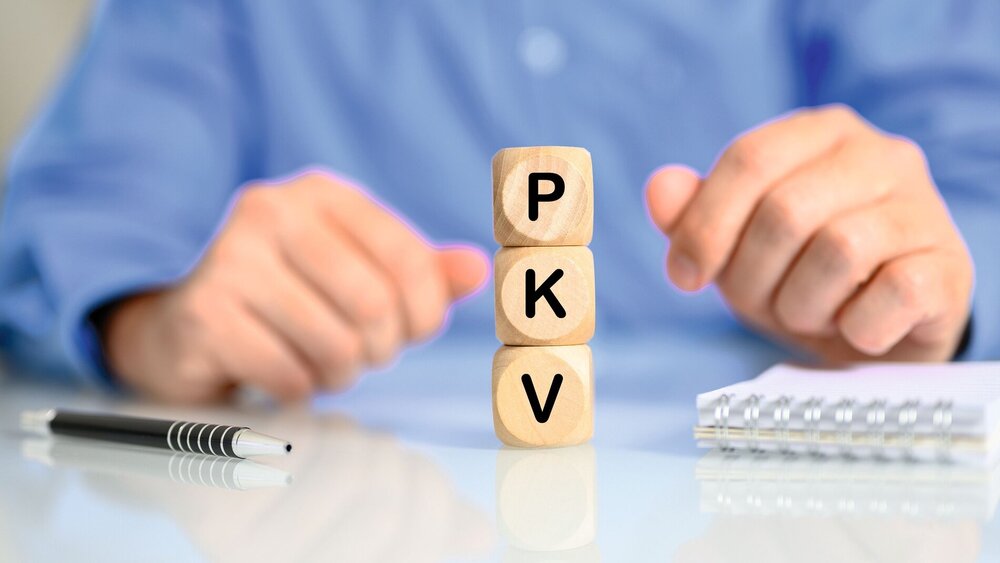„PKV sorgt für 74.000 Euro Mehrumsatz pro Praxis“
Für das Institut belegen die Ergebnisse die wachsende Rolle der Privaten Krankenversicherung (PKV) für das Gesundheitswesen. Die Mehreinnahmen kommen vor allem der ambulant-ärztlichen Versorgung zugute, heißt es. „Auf die niedergelassenen Ärzte entfallen 7,99 Milliarden Euro des PKV-Mehrumsatzes, ein Plus von 940 Millionen Euro gegenüber 2022. Rechnerisch ergibt das einen Mehrumsatz von durchschnittlich fast 74.000 Euro im Jahr für jede Arztpraxis.“
Den angegebenen „Mehrumsatz“ errechnet das WIP nach eigenen Angaben aus dem Unterschied zwischen den tatsächlich entstandenen Ausgaben für PKV-Versicherte und den hypothetischen Umsätzen, wenn diese Personen bei Inanspruchnahme der Leistung in der GKV versichert gewesen wären. Der reale Mehrumsatz der Privatversicherten sei sogar noch höher, erklärt das Institut hierzu, „da viele Rechnungen nicht zur Erstattung eingereicht würden und somit nicht in die Analyse einfließen“.
Damit brächten die PKV-Versicherten laut der Studie bei ambulanten Ärzten einen Finanzierungsanteil von 21,4 Prozent. Dieser liege deutlich über ihrem Bevölkerungsanteil von 10,4 Prozent, schreibt das WIP weiter. Zuwächse bei den Mehrumsätzen verzeichneten auch die stationäre Versorgung (plus 250 Millionen Euro), der Arzneimittelsektor (plus 230 Millionen Euro) und der zahnärztliche Bereich (plus 220 Millionen Euro).
Der Mehrumsatz ermögliche nicht nur bessere Vergütungen für Leistungserbringer, „sondern ist auch Voraussetzung für Investitionen in Innovation und Qualität“, schreibt das WIP zur Auswertung. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft und steigender medizinischer Ausgaben sei dieser finanzielle Beitrag unverzichtbar.
Schlechter Lebensstil kommt dem Gesundheitswesen teuer
Die aktuelle WIP-Analyse widmet sich auch dem Thema „Zugang zur Gesundheitsversorgung, Gesundheitszustand und Risikofaktoren – Das deutsche Gesundheitssystem im europäischen Vergleich“ und stellt anhand von Kennzahlen heraus, dass dieses zwar den besten Zugang gewähre, der Outcome im europäischen Vergleich aber vergleichsweise niedrig ausfällt.
Grund für den hohen Bedarf an medizinischen Leistungen seien die Auswirkungen des schlechten Lebensstils, analysiert das WIP. Immer noch werde in Deutschland pro Kopf viel Alkohol konsumiert, die Ernährung enthalte zu viel Zucker und schlechte Fette und die Hälfte aller Erwachsenen bewege sich zu wenig. Im Durchschnitt aller betrachteten verhaltensbedingten Risikofaktoren für die Gesundheit belege Deutschland darum im Ranking der betrachteten Länder den letzten Platz, schreiben die Autoren. Konkret heißt es:
"Deutschland gehört zu den Ländern mit überdurchschnittlich hohem Alkoholkonsum, 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland betreiben mindestens einmal im Monat Rauschtrinken (EU-Durchschnitt: 19 Prozent). Der Pro-Kopf-Alkoholkonsum liegt über dem EU-Durchschnitt.
Der Konsum von Zucker und Fett übersteigt deutlich die WHO-Empfehlungen. Im Vergleich zu den anderen Ländern gehört Deutschland bei Betrachtung der Indikatoren zum Obst-, Gemüse-, Fett-, Zucker- und Hülsenfrüchteverzehr zu den Ländern mit den schlechtesten Ernährungsgewohnheiten.
Nur etwa die Hälfte der Erwachsenen erfüllt die WHO-Empfehlung von mindestens 150 Minuten moderater bis intensiver körperlicher Aktivität pro Woche, während weniger als jeder sechste Jugendliche die empfohlene tägliche Bewegungsdauer von mindestens 60 Minuten erreicht.
Die Defizite in der Ernährung und Bewegung spiegeln sich in hohen Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas wider, die in Deutschland sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen im europäischen Vergleich hoch sind. Immerhin 53 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig oder adipös.
Die aufgezeigten Problemfelder verdeutlichten die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsbewussten Lebensstils und einer verbesserten Gesundheitskompetenz, lautet die Schlussfolgerung der Analyse.