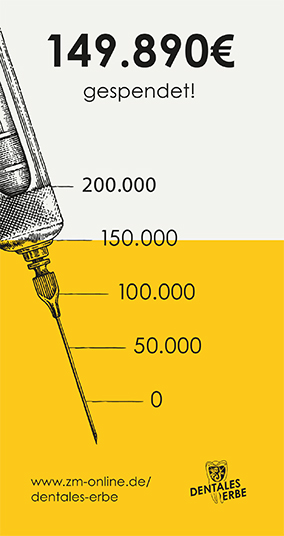Wer einmal fällt, fällt immer wieder
Elf Mal stolpert Butler James über den Kopf des ausgelegten Tigers. Elf Mal fängt er sich aber wieder und fällt nicht auf die Nase. Der beschwipste Held des alljährlichen Silvestervergnügens „Dinner for One“ hat somit mehr Glück als etliche ähnlich betagte Menschen: Stürze sind ein bedrohlich wachsendes Risiko für die alternde Gesellschaft und die häufigste Ursache von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit für Frauen und Männer über 65 Jahre.
Fünf Millionen Stürze pro Jahr
Eine gemeinsame Bestandsaufnahme des Robert Koch-Instituts (RKI), das Deutschen Zentrums für Altersfragen und des Statistischen Bundesamts klingt beunruhigend: Fast ein Drittel der 65-Jährigen und Älteren sowie die Hälfte der 80-Jährigen plus stürzen jährlich mindestens einmal. Ausgehend von der derzeitigen Bevölkerungsstruktur ergeben sich somit mindestens fünf Millionen Stürze älterer Menschen pro Jahr, schätzen die drei Institutionen. 2012 starben 10.240 Menschen durch einen Sturz, in 10.127 Fällen handelte es sich um einen Heim- und Freizeitunfall.
Stolperfallen auch im Altenheim
Die Bewohner von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen sind durch Stürze sogar mehr gefährdet als durch Organkrankheiten oder Ernährungsprobleme. Das dokumentieren die Zahlen des Geriatrischen Zentrums am Klinikum der Universität Heidelberg. Dort mussten 231 Heimbewohner, davon 83 Prozent Frauen, im Laufe eines Jahres stationär aufgenommen werden. Sie verbrachten durchschnittlich 32,6 Tage in der Klinik.
Dr. Norbert Specht-Leible, Oberarzt am Geriatrischen Zentrum berichtet: „Von insgesamt 7.983 stationären Behandlungstagen waren 3.627 Tage (45 Prozent) durch Stürze und Sturzfolgen, 2.039 Tage (26 Prozent) durch kardiovaskuläre Ereignisse, 835 Tage (elf Prozent) durch Infektionen und 495 Tage (sechs Prozent) durch Ernährungsprobleme verursacht."
Die Folgen sind beträchtlich:
Jeder fünfte bis zehnte Sturz führt zu Verletzungen, etwa fünf Prozent zu Knochenbrüchen, ein bis zwei Prozent zu einer hüftnahen Oberschenkelhalsfraktur.
Über 350.000 Krankenhausaufenthalte von 65-Jährigen und Älteren sind im Jahr auf Stürze zurückzuführen.
Jeder zweite Mensch im hohen Lebensalter, der wegen eines Sturzes stationär behandelt werden muss, und bis zu einem Drittel der Patienten nach einer Oberschenkelhalsfraktur sterben innerhalb eines Jahres.
Nur 33 bis 40 Prozent der Frauen und Männer, die einen Hüftbruch erlitten haben, können nach dem sturzbedingten Unfall ihre vormalige Kompetenz in den grundlegenden Aktivitäten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Essen und Körperpflege, wieder erreichen.
Aus der Balance
Dabei passieren die meisten Stürze keineswegs beim Fensterputzen, beim Aufhängen von Vorhängen von einer Leiter aus oder bei anderen riskanten Tätigkeiten, vor denen immer wieder gewarnt wird. Vielmehr kommen die meisten älteren Frauen und Männer bei ganz normalen, alltäglichen Aktivitäten zu Fall: zum Beispiel beim Aufstehen aus dem Bett, beim Gehen, Stehen oder Drehen, beim Treppensteigen und besonders häufig beim nächtlichen Gang zur Toilette. Specht-Leible bringt es auf den Punkt: „Der gebrechliche alte Mensch stürzt in Alltagssituationen, die ein Jüngerer mühelos bewältigt - weil er die Balance verliert“.
Angst vorm Hinfallen
Selbst ohne Verletzungen hat das Hinfallen nachteilige Folgen. Alte Menschen sind nach einem Sturz oft hilflos und nicht mehr in der Lage, alleine wieder aufzustehen. Etwa 30 Prozent der Sturzpatienten haben Angst vor weiteren Stürzen. Viele vermeiden aus Angst vor dem Hinfallen körperliche Aktivitäten und es entsteht so ein Teufelskreis von Unbeweglichkeit, sozialer Isolation, Depression und Hilfsbedürftigkeit.
„Ich bin bloß hängen geblieben“, so oder ähnlich versuchen die meisten Betroffenen ihre ersten Stürze zu bagatellisieren. Diese Erklärung greift jedoch zu kurz: An einem Sturz sind immer mehrere Ursachen beteiligt. Das nachlassende Sehvermögen im Alter erhöht das Sturzrisiko ebenso wie die verlangsamte Reaktionszeit; der unsichere Stand auf einem Bein und die Veränderungen im Gangbild.
Auch der Witwentröster ist beteiligt
Die Schrittlänge und die Gehgeschwindigkeit nehmen ab, der beeinträchtigte Gleichgewichtssinn löst Schwindel aus und führt zu Gehstörungen. Medikamente gegen die vielfältigen Beschwerden des Alters, zum Beispiel Blutdruckmittel und Schlafmittel, aber auch der „Witwentröster“ Alkohol sind ebenfalls an Stürzen beteiligt.
Doch Stürze sind vermeidbar! Wer einmal zu Fall gekommen ist, muss immer damit rechnen, erneut den Halt zu verlieren. Deshalb ist es besonders wichtig, Gefahrensituationen auszuschalten und auf künftige Stürze vorbereitet zu sein.
Aus dem Weg
Der im rheinländischen Swisttal beheimatete unabhängige Selbsthilfeverband BIVA (Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung) hat 2013 Standardempfehlungen zur Vermeidung von Stürzen veröffentlicht. Mit ihrer Hilfe sollen Stürze weitgehend verhindert oder die Folgen von Stürzen größtmöglich verringert werden. Hier die wichtigsten Empfehlungen für Pflegefachkräfte, die jedoch auch für den häuslichen Bereich ihre volle Gültigkeit haben:
Hindernisse auf den Fluren und in den Zimmer beseitigen;
instabile Einrichtungsgegenstände (wie Schemel, leichte Blumensäulen) nach Möglichkeit entfernen;
verschüttete Flüssigkeiten sofort und vollständig aufwischen;
Stolperfallen entschärfen: Leuchter, Kabel oder Schwellen beseitigen, rutschfeste Unterlagen schaffen;
für gute Beleuchtung sorgen, besonders am Abend und in der Nacht;
die Höhe des Betts individuell anpassen, damit man leicht ein- und aussteigen kann;
in Bad und Toilette Haltegriffe anbringen, eventuell Toilettensitz erhöhen.
Wieder in die Senkrechte kommen
Ältere Personen sollten außerdem das Aufstehen nach einem Sturz üben: sich auf den Bauch drehen, zu einem festen Halt krabbeln und sich daran dann vorsichtig hochziehen. Wichtig ist auch die rechtzeitige Planung, wie im Ernstfall Hilfe geholt werden kann. Notrufsysteme sind zwar nützlich, sie ersetzen aber nicht die regelmäßigen Kontakte zu Nachbarn und Freunden.
Und noch eins: Die beste Vorbeugung gegen Bewegungseinschränkungen und Stürze im Alter ist Bewegung bis ins hohe Alter. Nur wer sich bewegt und damit die Muskulatur erhält, bleibt auch im Alter beweglich. Das RKI, das Deutsche Zentrum für Altersfragen und das Statistische Bundesamt empfehlen in ihrer Veröffentlichung körperlich-sportliche Übungsprogramme, die auf Kraftzuwachs und eine Verbesserung des Gleichgewichts ausgerichtet sind.
Wenn der Boden schwankt
"Gleichgewicht“ bedeutet eine gewisse Instabilität, das heißt also, Störungen des Gleichgewichts und Schwindelattacken gehören ebenfalls zu den Beschwerden, die im Alter häufiger werden. Sie stellen gleichzeitig ein besonderes Risiko für Sturzunfälle dar.
Solche Störungen sind sind häufiger, als man denkt: Etwa jeder fünfte bis sechste Patient, der einen niedergelassenen Neurologen aufsucht, klagt über Schwindelbeschwerden. Etwa jeder Dritte hat damit zumindest irgendwann im Leben einmal Probleme.
„Der gutartige Lagerungsschwindel, auch benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPLS) genannt, gehört zu den häufigsten Gleichgewichtsstörungen“, berichtet der Münchner HNO-Spezialist Privat-Dozent Dr. med. Eike Krause: „Vor allem Ältere sind betroffen. So leiden etwa 30 Prozent der 70-Jährigen bereits mindestens einmal an den typischen Beschwerden.“
Nicht immer steckt der Schwindel im Ohr
Schwindel kann aber auch andere Ursachen haben, etwa als Folge eines Schlaganfalls oder einer Störung des Gleichgewichtsorgans („Vestibularapparat“) im Innenohr. Auch Migräne kann eine Schwindelattacke auslösen. Zudem gibt es verschiedene Formen, wie Dreh-, Schwank- oder Benommenheitsschwindel.
Die Ursachen können in verschiedenen und oft gleichzeitig in mehreren medizinischen Fachgebieten liegen. Deshalb ist die Betreuung der Betroffenen häufig nicht optimal: Sie müssen oft eine Reihe von Ärzten kontaktieren, bevor dann nach Wochen, Monaten oder sogar erst nach Jahren die richtige Diagnose gestellt wird.
Mit Spezialisten zur richtigen Diagnose
Seit kurzem gibt es in Deutschland spezialisierte Schwindelzentren, in denen verschiedene Spezialisten zusammenarbeiten, um die richtige Diagnose zu stellen und die Patienten interdisziplinär versorgen zu können. Ein solches Zentrum ist das 2009 etablierte „Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum“ der Ludwig-Maximilian-Universität München (IFB-LMU). Dort arbeiten Neurologen, HNO-Ärzte, Neuroradiologen, Internisten, Kinderärzte, Augenärzte und psychiatrische Psychotherapeuten zusammen. Dazu kommen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen und andere therapeutische Spezialisten, die miteinander vernetzt sind.
Unlängst wurde auch in Mitteldeutschland eine Anlaufstelle für Patienten mit Schwindelproblemen eingerichtet: An der Hans-Berger-Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Jena gibt es seit Oktober 2013 ein spezialisiertes Zentrum für Menschen mit wiederkehrenden Schwindelattacken.