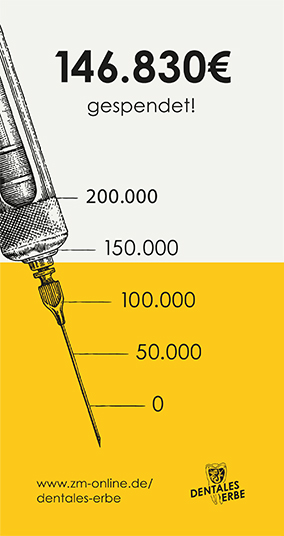Misserfolgsmanagement in der Implantologie
„Jeder Misserfolg ist eine willkommene Gelegenheit, das Denken nachzuholen“, begrüßte Dr. Derk Siebers M.Sc., der die Veranstaltung zusammen mit Dr. Jörn Werdelmann M.Sc. und Peter Albrecht M.Sc. organisierte, die Absolventen des Masterstudiengangs Orale Implantologie von DGI und Steinbeiß-Hochschule.
Studien kritisch beleuchten
Zu Beginn beleuchtete Prof. Dr. Bjarni Pjetursson aus Reykjavik den implantologischen Misserfolg aus der Sicht des Parodontologen und aus dem Blickwinkel des Prothetikers. Zunächst aber relativierte er die Erfolgszahlen in der Literatur: Studien nennen demnach meist Überlebensraten zwischen 92 und 99 Prozent. Eine Erfolgsrate von 99 Prozent bedeute fünf Misserfolge auf 500 gesetzte Implantate. Bei einer Erfolgsrate von 90 Prozent gingen bereits 50 von 500 Implantaten verloren. Hinzu komme der "Publication-Bias", also die Tatsache, dass überwiegend Arbeiten mit guten Erfolgsraten publiziert werden. „Wer berichtet schon gerne über Misserfolge?“, fragte Pjetursson: Daher sei Vorsicht geboten bei Untersuchungen mit allzu hohen Erfolgsraten.
Botschaft Nummer 2: „Überleben ist nicht gleich Erfolg.“ Zwar säße in erfolgreichen Fällen die Schraube noch im Kiefer, die aber Frage sei, wie sie aussieht. Eine systematische Übersichtsarbeit von Pjetursson und seinen Kollegen bescheinige den Zahnärzten anhand von steigenden Erfolgsraten zwar eine positive Lernkurve, doch die ästhetischen, biologischen und technischen Komplikationsraten seien mit 13,5 Prozent noch immer hoch.
Um Komplikationen zu reduzieren und Überlebensraten zu steigern, könnte man natürlich allen Risikopatienten eine Implantation verweigern – „genau dies geschieht in den Studien mit den hohen Erfolgsraten“, betonte der Referent. „Doch wenn Sie dies tun, haben Sie keine Patienten mehr.“ Die Alternative: „Um Komplikationsraten zu mindern, ist es wichtig, darüber zu sprechen und sie zum Thema zu machen, was inzwischen umfangreich geschieht.“
Risikopatienten identifizieren
Am Beispiel parodontal kompromittierter Patienten veranschaulichte Pjetursson, wie er diese mithilfe einer - maximal zweiminütigen - parodontalen Grunduntersuchung zur Erhebung des Parodontalen Screening Indexes (PSI) identifiziert. Pjetursson verwies auf Studien, denen zufolge die Misserfolgsraten nach acht bis zehn Jahren bei PA-Patienten höher sind als bei parodontal Gesunden. Auch das Periimplantitis-Risiko sei höher. Grundsätzlich gelte jedoch, dass eine Implantattherapie dann erfolgreich ist, wenn ihr eine erfolgreiche Behandlung der Parodontitis vorausging. Ist die parodontale Situation trotz erfolgter PA-Behandlung schlecht, warnte Pjetursson, sollte nicht implantiert werden.
Auch die Prothetik spiele bei einer Implantattherapie eine große Rolle. Um einen langfristigen Erfolg zu erzielen, sei es besonders wichtig, dass der Zahnersatz putzbar ist. Ist dies nicht der Fall, steigt die Periimplantitisrate. Zementreste sollten daher, betonte Pjetursson, immer gründlich entfernt werden, da diese schon innerhalb von vier Wochen zu einem Knochenverlust führten. Misserfolge in der Implantologie könnten aber auchdurch Material- und Implantatbrüche verursacht werden. Implantate, Abutments und Schrauben könnten sich lockern und zu biologischen Komplikationen führen.
Eine Komplikation – drei Fragen
Mit drei Fragen, die man sich bei Komplikationen immer stellen sollte, beendete der isländische Wissenschaftler seine Präsentation: Warum ist das passiert? Können wir das behandeln? Wie können wir verhindern, dass es wieder passiert? Nur so ließe sich der allergrößte Fehler vermeiden: dieselben Fehler wieder und wieder zu machen – nur mit größerem Selbstvertrauen.
Komplikationsmanagement und Fehlervermeidung
Dass bei zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen nicht immer alles glatt laufen muss, zeigte Dr. Puria Parvini aus Frankfurt am Main. Anhand von beeindruckenden Kasuistiken präsentierte er mögliche Komplikationen und gab Hinweise zum Komplikationsmanagement und zur Fehlervermeidung.
Ein Beispiel: die arterielle Blutung. In der anterioren Region im Unterkiefer können etwa die A. sublingualis und A. submentalis sowie deren Anastomosen verletzt werden. Die bidigitale Kompression ist der erste Schritt, mit einer Arterienklemme wird anschließend die Arterie umnäht. Dies ist auch das Vorgehen, wenn bei operativen Eingriffen in der Gaumenregion die A. palatina verletzt wird. Um Beschädigungen der Arterien zu vermeiden, sollten Länge und Breite des scharfen Anteils der verwendeten Instrumente bekannt sein. Zudem gibt es, führte Parvini aus, Richtwerte, die die Lokalisation der Arterien beschreiben.
Wichtig: die Medikamentenanamnese
Einem chirurgischen Eingriff vorausgehen muss die Medikamentenanamnese, Stichwort: Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmer. „Der Zahnarzt oder Oralchirurg sollte allerdings nie die Medikamente eigenständig absetzen, sondern die Medikation mit dem Hausarzt besprechen", sagte Parvini. Moderne NOAKs ermöglichten auch die Anpassung des OP-Zeitpunktes an das medikamentöse Therapieschema.
Bei Operationen im Oberkiefer kann der N. infraorbitalis, bei Operationen im Unterkiefer der N. alveolaris inferior in Mitleidenschaft gezogen werden. Vermutet der Behandler, dass im Unterkiefer ein Implantat in den Nervenkanal inseriert wurde, sollte sofort eine DVT angefertigt werden.
Die Kommunikation im Falle eines Misserfolgs
Prof. Dr. Günter Dhom, Ludwigshafen, präsentierte Konzepte für die Kommunikation mit Patienten im Falle eines Misserfolgs. Was darunter zu verstehen ist, hängt von der Perspektive ab. Was für Patienten ein Misserfolg ist, kann aus Arztsicht durchaus anders wahrgenommen werden – und umgekehrt. Sicher ist sich Dhom aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, dass rund 90 Prozent der Prozesse, bei denen Zahnärzte von Patienten verklagt werden, sich vermeiden ließen, wenn nicht irgendwann ein kommunikativer Bruch stattgefunden hätte.
„Es kommt nicht darauf an, wie ich es sehe, sondern wie der Patient es sieht“, verdeutlichte Dhom. „Arroganz und Überheblichkeit sind fehl am Platz“,stellte er klar. Vielmehr gelte es, die Gefühle des Patienten zu kennen, Emphatie zu zeigen, diese Gefühle zu bestätigen und dabei authentisch sein. Dabei gehe es nicht darum, sich zu entschuldigen oder zu verteidigen, sondern Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass man die Situation des Patienten versteht.
Risikofaktor Parodontitis
Wege aus den parodontalen Niederlagen wies Dr. Gerd Körner, Bielefeld. Generell plädiert er eher für eine rekonstruierende als für eine resektive Parodontologie. Seine strikt fallspezifische Therapie basiert auf einer akribisch erhobenen Diagnostik und Risikobewertung. Faktoren wie Bleeding on Probing (BOP), Taschentiefen, bisherige Zahnverluste, Knochenverlust, systemische oder generische Erkrankungen sowie Rauchen liefern die Basis der Risikoabschätzung.
Bei Patienten mit vorausgegangenen Parodontitiden seien ein engerer Recall und die unterstützende Parodontitistherapie erforderlich. Ein Wiederauftreten der Parodontitis seibei Hochrisikopatienten jedoch trotz einer unterstützenden Parodontitistherapie nur teilweise vermeidbar.
Entscheidend ist für Körner das ästhetische Ergebnis einer Behandlung. An erster Stelle steht der Aufbau verloren gegangenen Gewebes. Hier wendet er GBR-Techniken in Verbindung mit der plastischen Parodontalchirurgie an. Er zeigte, dass selbst große Substanzdefekte – auch hervorgerufen durch Misserfolge beim Versuch der parodontalen Regeneration – rekonstruierbar sind. Ist die Ästhetik noch nicht zufriedenstellend, könnten Korrekturen der weißen Ästhetik – Farb- oder Formkorrekturen – hilfreich sein. Kommt ein Knochenaufbau nicht infrage, ließen sich extreme Defekte auch rein prothetisch mit befriedigendem ästhetischen Ergebnis lösen.
Risikofaktor Implantat
Prof. Dr. Bertil Friberg, Mitbegründer der Brånemark Klinik in Göteborg, fragte nach den Ursachen von Misserfolgen und Komplikationen. An der Brånemark Klinik wurden mittlerweile mehr als 41.000 Implantate gesetzt. Vor diesem Hintergrund dokumentierte er die Entwicklung der Implantate von glatt zu oberflächenrau, von parallelwandig zu konisch, von extern zu intern verschraubt, und verglich Erfolgs- und Komplikationsraten.
Beispiel Oberflächenrauheit: Diese Oberflächen führen Studien zufolge zu einer schnelleren Knochenantwort, einer kürzeren Behandlungsdauer und einer verbesserten Überlebensrate als gedrehte Oberflächen. Parallel zeichnete Friberg den Erfahrungszuwachs nach, der mit der rasanten Erweiterung des Indikationsspektrums einherging - ausgehend von der Implantation im abgeheilten konsolidierten Knochen hin zur Sofortimplantation oder zu umfangreichen Knochenaufbauten, von der herausnehmbaren Versorgung unbezahnter Kiefer zu komplexen, festsitzenden Versorgungen.
Doch nicht nur die Implantateigenschaften und die Indikation beeinflussen Erfolg und Fehlschlag einer Behandlung. Das vorhandene Knochenangebot, die Knochendichte, systemische Erkrankungen entscheiden laut Friberg mit über den Erfolg einer Therapie. Nicht zuletzt spiele auch die Lernkurve des Operateurs und die seines professionellen Umfelds eine wesentliche Rolle. Friberg: „Schicken Sie Ihre Assistenz in Fortbildungskurse. Dies ist wichtig, damit die Mitarbeiter lernen, Ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.“
Der Stress des Operateurs
Nicht zu unterschätzen sei auch der Einfluss, den der Stress des Operateurs während einer Behandlung auf das Therapieergebnis hat. Es überrasche Friberg nicht, dass erfahrende Behandler während der Operation weniger Stress haben als Anfänger. Allerdings beeinträchtige Stress – unabhängig von der Ursache – bei einem Eingriff auch die nicht-technischen Fähigkeiten des Operateurs, wie Untersuchungen belegen.
Friberg: „Wenn ich gestresst bin, zittere ich vielleicht nicht, aber ich treffe falsche Entscheidungen.“ Der Stresslevel lasse sich mit verschiedenen positiven psychologischen Bewältigungsstrategien reduzieren. Dazu gehörten insbesondere die Neubewertung der Situation, das Behalten der Kontrolle während einer schwierigen Prozedur, die intraoperative Planung und Vorbereitung sowie der Erhalt der Teamkommunikation und -führung. Dann ließen sich folgenschwere Fehler oft vermeiden oder korrigieren. Dies habe auch bereits Konfuzius erkannt: „Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“