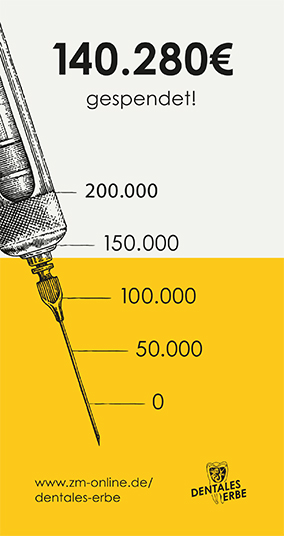Gender Bias auf Rezept?
Viele Gesundheits-Apps gehen nicht auf genderspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein. „Das birgt Risiken für die Versorgung,“ sagt Barbara Steffens, Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Nordrhein-Westfalen, der das Problem schon lange unter den Nägeln brennt. Ganz aktuell zeigt sich für sie der Genderaspekt bei den neuen Gesundheits-Apps auf Rezept – diese DIGAs können Ärztinnen und Ärzte seit Oktober 2020 ihren Patientinnen und Patienten verschreiben.
„Genderaspekte sind bei den Entwicklern der Apps nicht im Blick“, umreißt die ehemalige NRW-Gesundheitsministerin das Problem. Deshalb habe die TK in NRW auch einen Schwerpunkt auf dieses Thema gesetzt. Das Problem zeige sich bereits im analogen Bereich der wissenschaftlichen Studien, erläutert sie. Hier stehe oft der männliche Fokus im Mittelpunkt. Medizinische Studien würden in der Regel bei männlichen Probanden durchgeführt – mit Ergebnissen, die auf Männer fokussiert sind oder auf geschlechterundifferenzierten Daten beruhen. Steffens weiter: Übertrage man diese Ergebnisse auf die digitale Welt, zeige sich ein ähnliches Bild. Überwiegend Männer programmierten die Apps. Und unterschiedliche Belange von Männern und Frauen sowie unterschiedliche Krankheitsverläufe würden bei der Programmierung nicht berücksichtigt.
Als Beispiel nannte Steffens etwa Apps zum Thema Adipositas: Hier seien etwa geschlechterspezifisch unterschiedliche Angebote zu den Themen Ernährung und Bewegung angebracht – ein Aspekt, der bisher allerdings völlig fehle. Oder eine App zum Thema Schlafstörung: ein Krankheitsbild, von dem mehr Frauen als Männer betroffen seien – ohne dass die digitalen Helfer darauf eingingen. Oder Tinnitus: Mehr Männer seien betroffen, aber Frauen hätten stärkere Beschwerden. Auch das finde sich in den Apps nicht wieder.
„Haben die Entwickler das berücksichtigt? Haben sie Zugang zu geschlechtsspezifischen Informationen über die Krankheitsbilder? Wir wissen es nicht“, sagt Steffens. Daraus ergeben sich aus ihrer Sicht mehrere Handlungsfelder. Zum einen: Schon in der Zulassungsphase der Apps (dafür ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfARM zuständig) sollten Genderaspekte berücksichtigt werden. Zum Zweiten: Krankenkassen sollten geeignete qualitätsgeprüfte und gendergerechte Apps selbst entwickeln und dabei Erkenntnisse aus ihrer Versichertenstruktur mit einbringen. Und zum Dritten sollten Programmierer sensibilisiert werden, den Genderaspekt bei der App-Entwicklung im Blick zu haben. „Eigentlich“, so Steffens, „hätte man damit schon vor zehn Jahren beginnen müssen, den Genderblick in Versorgungskonzepten zu implementieren. Nun ist es schon sehr spät.“
Es geht nicht nur um Frauenmedizin
Auch von ärztlicher Seite kommt die Forderung, Genderaspekte bei der Entwicklung der neuen Gesundheits-Apps in den Fokus zu rücken, berichtet Dr. Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, im Gespräch mit den zm. „Ich beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit der Gendermedizin und möchte dies nicht als reines Frauenthema abtun“, erklärt Groß, die auch in der Ärztekammer Nordrhein den Vorsitz im Ausschuss „EHealth und KI“ führt. Ihr Ansatz: „Es geht eben nicht nur um Frauenmedizin. Gendermedizin ist immer ein Thema für Männer und für Frauen mit den jeweiligen Unterschiedlichkeiten von Symptomatik bis Behandlung im Blick – für mich ein wichtiger Schritt in Richtung individualisierte, also auf den einzelnen Menschen heruntergebrochene Medizin.“
Bereits zugelassene DiGAs
Invirto: Therapie gegen Angst für Menschen mit einer Agoraphobie, Panikstörung oder sozialen Phobie
Kalmeda: Therapie gegen chronische Tinnitusbelastung
somnio: dient der Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen
Velibra: Therapie gegen generalisierte Angst- und Panikstörungen
Vivira: unterstützt die Behandlung von Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen
zanadio: unterstützt bei der Gewichtsreduktion und der Veränderung von Gewohnheiten, bei der Bewegung, bei der Ernährung sowie bei weiteren Verhaltensweisen
Groß sieht – wie Steffens – bei den neuen DiGAs die Gefahr, dass die bisherigen Erkenntnisse der analogen Studienwelt eins zu eins auf die digitale Welt übertragen werden. Die neuen Anwendungen betrachtet sie als einen „Riesen-Feldversuch, bei dem man wie in Watte fasst“: Ärztinnen und Ärzte, die eine DiGA verschreiben wollen, sei nicht bekannt, wie diese bei Frauen oder bei Männern wirke. Den App-Entwicklern fehle die nötige Sensibilität für das Thema. Das sei ein Beratungsproblem, das dringend aufgegriffen werden müsse, so Groß. „Je eher, desto besser, und am besten noch, bevor weitere Apps konfiguriert werden.“
Doch was ist konkret zu tun? Groß fordert, bei der künftigen Evaluation der DiGAs unbedingt Aspekte der Gendermedizin mit einfließen zu lassen. Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte müsse es auch sein, diese Aspekte beim Verschreiben im Blick zu haben – wobei ihnen aber auch entsprechende Informationen der Hersteller zur Verfügung stehen müssten, die bislang völlig fehlen. Und Firmen, die die Apps entwickeln und programmieren, sollten den Gender Bias von Anfang an berücksichtigen.
Ist die Basis schief, ist auch das Ergebnis schief
Auf ein Grundproblem bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Medizin kommt Brigitte Strahwald von der Pettenkofer School of Public Health an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu sprechen: „Wenn die Grundlage schief ist, ist auch das Ergebnis schief“, sagt sie im zm-Gespräch. Schon bei der Gewinnung von Daten können Verzerrungen auftreten. Bezogen auf die DiGAs bedeute das, es fehle der Blick auf Risiken, Grenzen oder Nebenwirkungen. Zwar gebe es für medizinische Studien inzwischen Vorgaben, dass Probanden geschlechtergerecht aufgeteilt werden sollen. Im konkreten Umgang mit Daten in KI-Systemen sehe dies jedoch anders aus.
Strahwald sieht das Problem der Verzerrung allerdings nicht nur auf den Genderaspekt bei Apps beschränkt. „Das ist nur ein Punkt von vielen. Es geht zum Beispiel auch um weitere Aspekte wie ethnische Besonderheiten oder Alter“, sagt sie. Ihre Forderung: „Wir brauchen Fördertöpfe für eine bessere Entwicklung, und wir müssen über wissenschaftliche Standards reden.“
Die App auf Rezept
Seit Oktober 2020 können Ärzte Apps auf Rezept verschreiben. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Grundlage dafür ist das Digitale-Versorgung-Gesetz. Geregelt ist dort, dass Versicherte einen Anspruch auf Medizinprodukte niedriger Risikoklassen haben, deren Hauptfunktion auf digitalen Technologien beruht – sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen. Diese Apps müssen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und dort in einem Leistungsverzeichnis gelistet sein. In diesem Verzeichnis können sich Ärzte über zugelassene DiGAs und über Fachinformationen der Hersteller informieren.
Die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) haben vor Kurzem eine Handreichung zu den Apps im klinischen Alltag herausgegeben. Die Publikation bietet einen Überblick über Nutzen und Risiken der Apps und erklärt, wie man gute von schlechten Gesundheits-Apps unterscheiden kann. Mehr dazu unter: https://www.aezq.de/gesundheitsapps