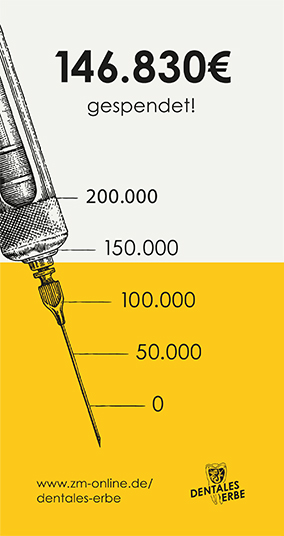Alles auf eine Karte
Flensburg, April 2008: Seit gut anderthalb Jahren zählt die Stadt zu den sieben Regionen, in denen die elektronische Gesundheitskarte getestet wird. Aber jetzt reicht es den Beteiligten – sie stoppen den 10 000er-Test. „Mit der Karte laufen wir sehenden Auges ins Chaos“, begründet Eckehard Meissner, Vorstandssprecher des Praxisnetzes Region Flensburg, die Entscheidung. Die Ärzte hätten keine Zeit für zusätzliche PIN-Spielchen.
Knackpunkt PIN
Laut Protokoll scheint sich das Drama zu bewahrheiten: Gerade ältere Menschen kamen mit der komplizierten Karte nicht zurecht. Sie scheiterten bei dem Versuch, die sogenannten Notfalldaten anzulegen und zu speichern, weil sie sich entweder nicht mehr an ihre sechsstellige PIN erinnern konnten oder Mühe hatten, diese in den vorgeschriebenen zehn Sekunden zwei Mal einzugeben.
Ergebnis: Die Notfalldaten hat man als Anwendung kaum genutzt, weniger als die Hälfte der ausgestellten Rezepte eingelöst. Von den gut 7 500 Chipkarten, die seit Testbeginn an die Versicherten gingen, wurden etwa 75 Prozent gesperrt.
Aber auch die Ärzte hatten ihre Last. Gut 30 Prozent knockten sich mit ihrem Heilberufsausweis (HBA) aus – ebenfalls durch das Eintippen falscher Geheimnummern. Außerdem gaben 2 000 der 10 000 Karten mitten im Test den Geist auf: „Ungültig“, weil die Sicherheitszertifikate abliefen.
Das Beispiel Flensburg zeigt bereits, dass die eGK selbst in ihrer Sparversion weit davon entfernt ist, an den Start zu gehen. Vom angestrebten Ziel, die medizinische Versorgung zu verbessern und unnötige Bürokratie zu vermeiden, ganz zu schweigen. Im Gegenteil: Etliche gravierende Probleme sind noch nicht gelöst – von der Konzeption bis zur konkreten Praxis.
Geht es nach dem BMG, soll der „Basisrollout“ dennoch im dritten Quartal 2008 beginnen. Auf dem Prüfstein stehen dann erstmal nur die Funktionen der heutigen KVK – offline. Mehr als das Auslesen der Versichertenstammdaten und ihre Übernahme in das Praxisverwaltungssystem ist damit also nicht drin. Anfangen will man auch nicht bundesweit, sondern mit der sogenannten Durchstichregion. Vorgesehen ist, die Rollout-Logistik dort flächendeckend zu erproben. In einem zweiten Schritt, dem „Quality Gate“, sollen die Erfahrungen dann bewertet werden. Wobei es nicht darum geht, die Funktionalität von Karte und Lesegerät zu prüfen. Nein, die Untersuchung umfasst lediglich Fragen zur Logistik; etwa, ob die benötigte Hard- und Software auch verfügbar ist oder die Anpassung der PVS-Systeme schnell genug erfolgte. Im Anschluss daran ist der bundesweite Rollout geplant – gestaffelt nach KVund KZV-Bereichen sollen die Ärzte und Zahnärzte bundesweit sukzessive mit Kartenterminals und Updates ihrer Praxisrechner ausgestattet werden.
Die „Dolchstoßregion“
Nach dem Rückzieher von Sachsen sieht das BMG in Sachen Durchstichregion Nordrhein in der Pflicht: Die zuständige KV hatte nämlich an allen anderen Leistungs- und Kostenträgern vorbei einfach ihre Bereitschaft verkündet. Das Ministerium reagierte prompt und erklärte daraufhin – ungeachtet der Proteste – Nordrhein zur Durchstichregion.
Bei der Selbstverwaltung stößt das Konzept freilich auf wenig Gegenliebe. Die Krankenkassen befürchten durch die Pflege zweier Parallelsysteme einen erhöhten finanziellen Aufwand. „Wir stricken hier Wegwerfsoftware für zwei Monate“, hieß es aus Kassenkreisen. Auch die Leistungsträger sind dagegen. Aus gutem Grund.
„Wir leben heute in einer mobilen Gesellschaft“, erläutert der stellvertretende KZBVVorsitzende und Telematikexperte Dr. Günther E. Buchholz. Dass Patienten aus Westfalen-Lippe zum Arzt nach Düsseldorf gehen, sei kein Einzelfall. Umgekehrt kämen Versicherte aus Nordrhein nach Gütersloh. Buchholz: „Diese Grenzproblematik bedeutet, dass der Patient zwei Karten vorhalten muss, um uneingeschränkt behandelt werden zu können. Und so ein Szenario ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt!“ Um den reibungslosen Ablauf in der Praxis zu gewährleisten, befürworten die Zahnärzte daher eine flächendeckende Ausstattung der Praxen vor Kartenausgabe. Eben weil die Zweigleisigkeit erhebliche Komplikationen berge. Zu groß sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient die „richtige“ Karte vergisst – oder, wie in den Tests geschehen, die alte trotz aller Warnungen einfach vernichtet. „Das Verfahren bringt uns weder einen Mehrwert, noch einen Erkenntnisgewinn und ist überdies vom Zeitplan vollkommen unrealistisch“, bilanziert Buchholz. „Diese Vorgehensweise ist rein politisch motiviert. Das BMG will ganz einfach sagen können: Der Rollout hat begonnen!“
Unter der Maßgabe, dass die technischen und logistischen Voraussetzungen erfüllt werden, haben die zuständigen Krankenkassen, KV, KZV und Krankenhausgesellschaft – unter Moderation von Landesminister Laumann – jetzt dem Basisrollout in Nordrhein zugestimmt. Bedingung auch hier: ein geordnetes Verfahren. Bevor der Startschuss fällt, betont die Zahnärzteschaft, muss eine Frage allerdings zwingend beantwortet sein: die der Finanzierung. Im Unterschied zu den anderen Leistungsträgern steht diese für die Zahnärzte nämlich noch aus. Und da gibt es momentan noch Klärungsbedarf. Eine konkrete Abmachung liegt jedenfalls noch nicht auf dem Tisch. „Ohne die läuft gar nichts – auch nicht in Nordrhein!“, bestätigt Buchholz.
Alles auf den Kopf gestellt
Wichtig ist für die Zahnärzteschaft auch ein Nachweis über die Funktionalität der eGKs im Test. Eigentlich selbstverständlich für ein solches Megaprojekt, sollte man meinen. Doch weit gefehlt: Wenn Ende Januar 2009 mit dem „Release 2“ die Versichertenstammdaten und das e-Rezept auch online gecheckt werden sollen, liegen die Testergebnisse aus „Release 1“ noch gar nicht vor. Erste Resultate erwartet man nämlich erst im nächsten Frühjahr. Im Klartext: Man geht in die nächste Teststufe und beginnt mit den Feldtests – ohne die vorherigen Resultate überhaupt zu kennen, zu berücksichtigen und in die Testverfahren einfließen zu lassen.
Unvorstellbar, aber genauso ist es, wie Jürgen Herbert, Präsident der Landeszahnärztekammer Brandenburg und Telematikexperte der BZÄK, bestätigt: „Fakt ist: Es wird immer noch an der Telematikinfrastruktur und den Anwendungen herumgewerkelt. Das heißt, parallel zu den Tests brütet man nach wie vor über der weiteren Konzeption der Karte. Dieser Planungsprozess hätte – wie bei Projekten normalerweise üblich – in der Phase der praktischen Umsetzung natürlich längst abgeschlossen sein müssen.“
Hätte, wäre, könnte. Wer in die Tiefen des Projekts einsteigt, verwendet schnell jene Verben, mit denen man verpasste Chancen und Möglichkeiten umschreibt. Worum es eigentlich geht? Vielleicht darum, dass Deutschland wieder einmal in etwas Weltmeister werden möchte.
So wie bei der Maut, bei der die Bundesregierung ein System entwickeln ließ, das fast alles kann, doch bis es soweit war und endlich funktionierte, ziemlich viele Menschen verärgerte.
Telematik made in BMG: Bereits 2003 verkündete Ulla Schmidt die Einführung der eGK. Heute, fünf Jahre später, steht bei dem Projekt immer noch vieles auf Anfang. Prinzipielle Anwendungen der Karte sind noch nicht durchdekliniert. Nicht planerisch und erst recht nicht technisch. Strittig sind beispielsweise der Ablageplatz für die Organspendeerklärung und der Speicherort für die Patientendaten. Nicht geklärt ist, mit welchen Ausweisen Krankenschwestern, Pfleger und andere ausgestattet werden.
Noch viel Klärungsbedarf
Nehmen wir den Organspendeausweis. Das BMG hat mittels Weisung erwirkt, dass die Organspendeerklärung im Notfalldatensatz gespeichert wird. Laut Transplantationsgesetz darf die Auskunft, ob eine Organspendeerklärung vorliegt, aber erst eingeholt werden, wenn der Tod des möglichen Spenders festgestellt wurde. Ist die Erklärung Teil der Notfalldaten, stößt der Notarzt freilich zwangsläufig vorher darauf. Dabei ist für ihn das Ja zur Organspende bei der Erstversorgung irrelevant. Darüber hinaus erfordert der Organspendeausweis als rechtswirksame Erklärung die elektronische Signatur des Patienten – der muss seine Patientenerklärung zudem jederzeit verändern können. Das wäre bei der Speicherung im Notfalldatensatz jedoch nicht möglich, weil dort jede Änderung nur mit der Signatur des Arztes erfolgen kann.
Die Ärzte plädieren deshalb dafür, den Organspendeausweis in einem Extrafach abzulegen. Die Bundesärztekammer hat beim BMG angefragt, welche Verantwortung der Behandler trägt, wenn er anstelle des Patienten die Organspendeerklärung signieren muss und was daraus für rechtliche Konsequenzen entstehen. Die Antwort aus dem BMG lässt bis heute auf sich warten. Unklar ist auch die Haftung bei den Notfalldaten als solchen. Verantwortet der Kollege, der die Daten zuletzt geändert hat, auch deren Richtigkeit? Spätestens nach dem ersten Prozess wird sich dagegen wohl jeder Mediziner sperren, weil er im Zweifelsfall die alten Daten gar nicht prüfen kann.
Schlüssel für den Datenschutz
Noch wichtiger: das Thema Sicherheit. Sind die Patientendaten auf der Karte wie beim Transport hinreichend geschützt? Ja sagen Datenschützer und geben dem Telematikprojekt grünes Licht. Mit der Verschlüsselung ist gewährleistet, dass ein Zugriff von Heilberufsangehörigen auf Patientendaten immer nur dann erfolgen kann, wenn Arzt und Patient ihre Karten, HBA und eGK, gleichzeitig in die Lesegeräte stecken und sich mit ihrer PIN authentisieren.
„Bei der eGK sind die Anforderungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts vorbildlich umgesetzt worden“, schreibt beispielsweise Lukas Gundermann vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) in Schleswig-Holstein, Anfang Februar im Deutschen Ärzteblatt. Das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ bedeutet, dass der Patient grundsätzlich selbst darüber bestimmt, wie seine persönlichen Daten verwendet werden und wem er sie zugänglich macht. Er allein muss darüber entscheiden, wann er wem welche Gesundheitsdaten preisgibt. Der Chef kann noch so viel Druck machen: Will er am Firmenrechner einen elektronischen Blick auf die Gesundheit seines Mitarbeiters werfen, hat er keine Chance. Medizinische Daten können nur in Kombination von elektronischer Gesundheitskarte mit Patienten-PIN und Heilberufsausweis ausgelesen werden.
Gleichwohl mehren sich die Stimmen, die den Schutz der Daten kritisch sehen. Gerade weil noch nicht entschieden ist, ob diese in einem Pool auf Servern oder dezentral gespeichert werden sollen. Denn ist auch die Nutzung der Patientendaten durch Krankenkassen oder Industrie verboten: Eine zentrale Sammlung dieser Informationen weckt Begehrlichkeiten. Und eine simple Gesetzesänderung könnte die eingebauten Sicherheitszäune schnell einreißen. Während Krankenkassen sich für eine zentrale Speicherung auf Servern einsetzen, plädieren Zahnärzte und auch die BÄK darum für eine dezentrale Vorhaltung, idealerweise auf Speichermedien in Patientenhand. Plus Erprobung entsprechender Konzepte.
Kritische Stimmen
Wenngleich die Ärzte dem Projekt insgesamt nicht so kritisch gegenüberstehen, hat sich ihr Widerstand gegen das Telematikprojekt seit dem Deutschen Ärztetag in Münster 2007 verstärkt. Damals hatte das Ärzteparlament die Karte „in der bisher vorgestellten Form“ abgelehnt und eine Neukonzeption gefordert. Hauptkritikpunkte: die mangelnde Sicherheit der Patientendaten, die Störung der Abläufe in den Praxen, der fehlende medizinische Nutzen und die ungeklärte Finanzierung. Beim Ärztetag 2008 in Ulm sprachen sich die Mediziner erneut gegen die eGK in ihrer jetzigen Machart aus – vor allem aus ethischen Erwägungen. Sie sei „mit dem Grundvertrauen der Patienten in unser ärztliches Berufsethos nicht vereinbar“ und zerstöre „das bewährte Konzept von einer am Individuum …
orientierten Humanmedizin in unserer Gesellschaft“. Die in Münster vorgebrachten Argumente gegen die Einführung der eGK seien durch die Pannen und Fehlschläge diverser Testphasen noch erhärtet und bestätigt worden, heißt es in einem Antrag. Gleichzeitig votierten die Delegierten für eine kritisch-konstruktive Weiterentwicklung der Gesundheitstelematik.
Stolper- statt Meilenstein
Nach dem Desaster in Flensburg erteilten die Ärzte insbesondere dem eRezept eine Absage. Denn wenn der Arzt für jede einzelne Verordnung ein e-Rezept ausstellen und, wie es das Signaturgesetz vorsieht, mit sechsstelliger PIN seine eUnterschrift bestätigen muss, legt das Prozedere zweifellos den Praxisalltag lahm. Die Ärzte haben deshalb gefordert, dass es für diese Vorgänge andere, sprich praxistaugliche, Lösungen geben muss. Zum Beispiel die Authentifizierung durch den Mediziner per Fingerabdruck Daran arbeitet die gematik. Wobei Alltagssituationen wie eine Vertreterregelung im Test übrigens überhaupt nicht abgebildet werden. Für den Aufbau einer sicheren Telematikinfrastruktur sind sie aber unabdingbar – schließlich geht es darum, „Risiken und Nebenwirkungen“ vorher auszuschalten.
Die Delegierten der KZBV-Vertreterversammlung hatten bereits vergangenes Jahr mit großer Mehrheit beschlossen, dass das Projekt für die Praxen keinen erkennbaren Nutzen bringt. Dieser Standpunkt wurde auf der jetzigen VV am18. Juni erneuert. Darüber hinaus teilen die KZV-Vertreter die Positionen des Deutschen Ärztetags zur eGK. Das heißt, sie machen sich dafür stark, Alternativen zur zentralen Datenspeicherung zu prüfen, die Anwendungen neu aufzusetzen und die Freiwilligkeit einer Anbindung der Ärzte zu unterstützen. Den Basisrollout lehnte das Zahnärzteparlament mit großer Mehrheit ab. Insgesamt wurde der KZBV-Vorstand beauftragt, darauf hinzuwirken, den mit der eGK verbundenen Aufwand in den Praxen so klein wie möglich zu halten
Dass die Forderungen reell und die Befürchtungen durchaus real sind, machen die Pleiten in den Testregionen nur zu deutlich. Ein Boykott des Projekts durch die Mediziner wird die Einführung der eGK auf Dauer freilich nicht verhindern – wurde diese doch von einer großen parlamentarischen Mehrheit beschlossen und von der Mehrheit der Bevölkerung laut Umfragen bislang nicht infrage gestellt. Und last but not least wird Ulla Schmidt ihr Referenzprojekt ohne Not nicht stoppen. Eine totale Verweigerungshaltung sei deshalb keine Lösung, stellen Buchholz und Herbert unisono klar. „So chaotisch das Projekt ist, der Rollout lässt sich nicht abwenden – er wurde durch Intervention der KZBV aber immerhin in geordnete Bahnen gelenkt: Der Zahnarzt muss jetzt nur noch analog zur KVK die Versichertendaten einlesen“, erklärt Buchholz. „Wichtig ist, das wir für die niedergelassenen Zahnärzte ein akzeptables Ergebnis erzielt haben und weder an den 10 000ernoch an den 100 000er-Tests teilnehmen brauchen.“ Ungeachtet der grundsätzlichen Ablehnung der elektronischen Gesundheitskarte durch die Zahnärzteschaft sei entscheidend, dass die Bundesorganisationen an den Prozessen teilhaben. Herbert bekräftigt: „Nur wenn wir mitmischen, können wir in unserem Interesse und auf Grundlage eines geordneten Verfahrens die Entscheidungen beeinflussen. Bedienen wir uns der Vogel-Strauß-Taktik und verweigern uns komplett, wird mit uns kurzer Prozess gemacht!“