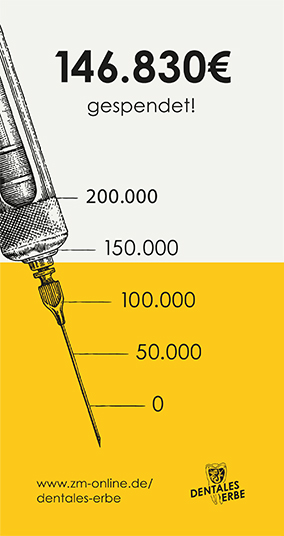Doktorspiele
Puls ist runter auf 50. Keine Atmung mehr. Sättigung nur noch bei 78.“ So könnte ein typischer Dialog in einer Arztund Krankenhausserie aus dem Fernseher lauten. Nach der Diagnose eilen die behandelnden Ärzte wie der Blitz in den OP – Leben retten. Solche Szenen sind charakteristisch für das Medical Drama, so der englische Name des Genres. Sie sollen für Spannung sorgen. Wenn die Zuschauer den Atem anhalten und ihren Emotionen freien Lauf lassen, haben Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseure und Darsteller ihr Ziel erreicht.
Arztserien sind dramaturgische Alleskönner. Es bleibt den Machern überlassen, ob sie eine Produktion inhaltlich Richtung Schnulze oder Krimi trimmen, ob es eher um die Medizin geht oder um die Beziehungen der Figuren untereinander. Fernsehärzte arbeiten in Notaufnahmen oder eigener Praxis, verdingen sich als Chirurgen für Herz, Gehirn und Schönheit oder klären als Gerichtsmediziner Verbrechen auf. Egal, um welches Fachgebiet es sich dreht: Im ärztlichen Alltag passiert immer etwas. Unaufhörlich treffen Menschen aufeinander, streiten, verlieben sich. Ärzte geraten in private und professionelle Konflikte, sie kämpfen gegen den Tod und für das Überleben ihrer Patienten. Kurz: Die Protagonisten durchleben eine Grenzerfahrung nach der anderen. Für bewegende Geschichten bietet das die perfekte Kulisse. Genau diese Wandlungsfähigkeit macht das Medical Drama so erfolgreich. Seit jeher.
Schon im 19. und 20. Jahrhundert etablieren sich Mediziner als beliebtes Motiv in den Groschenromanen der Trivialliteratur. Bis heute werden sie dort gern genommen. Bekanntester Vertreter der Zunft in Deutschland: Dr. Daniel Norden. In den vergangenen 35 Jahren wurden mehr als 800 Heftchen mit den Stories über ihn gefüllt und um die 180 Millionen Mal verkauft. Wie alle Romanärzte ist Norden überaus attraktiv und allzeit souverän. Ein echter Tausendsassa eben.
Im 20. Jahrhundert erobern Arztfiguren dieses Typs die Kinoleinwände und setzen sich auch im neuen Medium Fernsehen schnell als unverzichtbare Akteure durch. Zunächst in den USA, wo Arztserien bereits in den 40ern mit großem Erfolg im Hörfunk gesendet wurden. Mit „Dr. Kildare“, dargestellt von Richard Chamberlain, schickte die NBC 1961 den ersten Fernseharzt ins Rennen. Das Rezept „schlank, gutaussehend, einfühlsam und kompetent“ funktionierte hervorragend und prägte eine Form der Arztserie, die sich stark an den Erzählmustern der Soap Operas orientiert. Medizin bildet dabei nur den Rahmen einer Handlung, in der es heftig menschelt.
Im Jahr 1964 importierte das ZDF die amerikanische Erfolgsserie, und auch hierzulande fesselten die Geschichten über den jungen Assistenzarzt das TV-Publikum. Grund genug für deutsche Produzenten, sich selbst an das Thema heranzuwagen. Im Jahr 1967 ging mit „Landarzt Dr. Brock“ die erste Eigenproduktion an den Start, lief allerdings nur für zwei Jahre. Es folgten weitere Versuche, die sich mitunter sehr an die Sehgewohnheiten der Zeit anpassten. So unterbrachen in der Serie „Unser Doktor ist der Beste“ Arzt und Krankenschwestern nach Art des Revuefilms ihre Arbeit regelmäßig für Gesangs- und Tanzeinlagen.
In den 70ern wurden der ein oder andere komplexere Stoff umgesetzt. Die ZDF-Serie „Der Schwarze Doktor“ schilderte 1973 die Erlebnisse eines farbigen Mediziners und einer koreanischen Krankenschwester in Deutschland. Finanziert wurde die Produktion von der Evangelischen Kirche. Ein Jahr zuvor hatten die Katholiken die fünfteilige Serie „Patienten“ präsentiert, in der es um Grenzbereiche in Medizin und Ethik ging. Doch die Resonanz war mäßig.
Die 80er Jahre markierten die Rückkehr zur weichgespülten Fernsehunterhaltung. Beim Medical Drama dominierte in Deutschland vor allen Dingen eine Serie: die Schwarzwaldklinik.
Überarzt mit großem Herz
Das berühmteste Krankenhaus im Glottertal ist zwar fiktiv, mit der Schwarzwaldklinik fuhr das ZDF jedoch handfeste Traumquoten ein. Professor Brinkmann, sein Sohn Udo und Schwester Christa gingen am 22. Oktober 1985 zum ersten Mal on air. Schon in Staffel eins lockten sie zu Spitzenzeiten 28 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Zum Vergleich: Das Finale der Fußball-WM im Juli 1986 verfolgten 27 Millionen Menschen. Im Durchschnitt schalteten 60 Prozent der Haushalte bei der Schwarzwaldklinik ein, das entsprach umgerechnet etwa 25 Millionen Zuschauern pro Folge.
Dramaturgisch setzte die Serie vor allem auf die Irrungen und Wirrungen im Privatleben ihrer Protagonisten. Dazu gehörten sowohl die ständigen Vater-Sohn-Konflikte als auch das sich heftig drehende Liebeskarussell. Und zwischendrin erwies sich Prof. Brinkmann immer wieder als allwissender Wunderheiler. Die Schwarzwaldklinik ist durchsetzt mit den bewährten Elementen amerikanischer Soaps: Liebe, Leidenschaft, Streit und Tragik. Der Schlüssel zu ihrem Supererfolg war aber, dass sie es schaffte, gleichzeitig auf deutsche Sehgewohnheiten einzugehen. Die Serie bediente den Hunger nach traditionellen Werten wie Heimat und Familie, Medizin diente einzig als Vehikel für die ärztlichen Retter in der Not, allen voran Brinkmann.
Bis heute werden Arztserien in Deutschland nach diesem Rezept konzipiert. Das beobachtet auch Dr. Pablo Hagemeyer, der als medizinischer Berater für Fernsehproduktionen arbeitet. „Heimatgefühl und Eckbankgemütlichkeit scheinen in deutschen Arztserien wichtig für den Erfolg zu sein. Universitätsärzte in anonymen Betonbauten sind problematische Protagonisten. Zumindest wurden diese Settings noch nicht intensiv ausprobiert. Es bliebe abzuwarten, ob solche Serien den Zuschauern – jungen wie alten – gefallen“, sagt der Münchner.
Die Macher der Schwarzwaldklinik wollten es jedenfalls nicht darauf ankommen lassen. Sie standen zu ihrem Prinzip der Unterhaltung mit Zuckerguss. „Schlechte Nachrichten kennen die Leute genug. Das Elend der Welt müssen sie nicht auch noch von mir präsentiert bekommen. 90 Minuten Entspannung, danach kommt der miese Wetterbericht – die Pause ist kurz genug“, erklärte Produzent Wolfgang Rademann.
Immerhin, gab Drehbuchautor Herbert Lichtenfeld 1985 in einem Interview mit der „Zeit“ zu bedenken, seien die Schwarzwaldklinik-Fans zumindest flüchtig mit heiklen Themen wie etwa Sterbehilfe bekanntgemacht worden, die ihnen sonst möglicherweise ganz verschlossen geblieben wären. Mit dem ärztlichen Alltag hatte die geschönte Realität des Kliniklebens allerdings nicht viel zu tun.
Falsche Erwartungen
Serien wie Schwarzwaldklinik, Landarzt oder Praxis Bülowbogen, die stark auf Idylle und heile Welt setzen, sind gefährlich. Das meint auch die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Constanze Rossmann, die eine Studie zur Auswirkung von Krankenhausserien auf das Ärzteimage gemacht hat. Fernsehärzte würden in der Regel als Halbgötter in weiß dargestellt, die sich aufopferungsvoll ihren Patienten widmen. In diese Kerbe schlug auch die Serie „Alphateam – Die Lebensretter im OP“, in deren Vorspann folgender Slogan zu hören war: „Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Nichts. Gar nichts.“
Probleme wie Zeitnot, Fehldiagnosen und Geldmangel werden in vielen Serien nicht thematisiert. Das schafft eine Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität, die nicht nur Patienten, sondern auch Mediziner in die Irre führt. Rossmann: „Ärzte stellen daraufhin zu hohe Erwartungen an sich und unterlassen oft notwendige Zugeständnisse an die Grenzen ihres Könnens. Umgekehrt üben die Patienten einen großen Druck auf die Ärzte aus, die so wie sie sind, nämlich fehlbar, die Erwartungen nicht erfüllen können.“ Hagemeyer, der neben seiner Beratertätigkeit fürs TV auch in einer Klinik praktiziert, kennt diese Zwickmühle: „Ich bemerke schon, dass die Serien zu einer falschen Sicht der Realität führen können. Patienten wundern sich zum Beispiel oft darüber, wie viel Zeit Anamnese, Diagnose und Therapieplanung in Anspruch nehmen.“ Arztserien verkürzten diesen Prozess zugunsten der Handlung. Was ja auch logisch sei: Die TV-Fälle müssen innerhalb einer Episode abgeschlossen sein. Oft stehe im Fernsehen nur ein Symptom im Vordergrund. Das schaffe künstlich eine Dilemmasituation oder eine Sackgasse, die die Handlung abwechslungsreich macht. Hagemeyer: „In der Realität sind die Fälle häufig weniger eindeutig.“
In den 90ern gab es eine US-Serie, die mehr Chaos wagte und den Weg für Produktionen ebnete, die sich stärker an der Wirklichkeit orientierten. Beim Publikum avancierte sie zum Erfolg. Sie hieß, passend zum Setting, „Emergency Room“ (ER).
Anbruch der Neuzeit
Dokumentarischer war Medical Drama bis dahin nicht gewesen. Temporeich und authentisch schilderte ER den Alltag in der Notaufnahme eines Chicagoer Krankenhauses. Von den Dialogen bis zum kleinsten Handgriff – alles war medizinisch genau recherchiert. Die Idee zu ER stammt aus der Feder von Michael Crichton, der in Harvard Medizin studierte. Seine Erfahrungen als Assistenzarzt in einer Notaufnahme in den 70ern fasste er als Buch zusammen. Der Stoff stieß auf wenig Interesse bei Produzenten. Zu schnell sei er, zu fremd und deshalb nicht vermittelbar. Crichton weigerte sich aber, die Handlungsstränge zu vereinfachen oder auf die medizinische Terminologie zu verzichten. 20 Jahre später war schließlich die Zeit gekommen und er konnte das Drehbuch seinen Vorstellungen entsprechend umsetzen.
Den Erfolg der Serie erklärte Crichton nachträglich so: „ER brachte die Realität zurück ins Fernsehen. Menschen, Arbeitsplatz, Probleme – alles war dem wirklichen Leben nachempfunden. Fernsehen hatte sich in den Jahren zuvor immer mehr an Charleys Angels und Dallas orientiert. Dallas ist ja auch okay, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, die Zuschauer fanden ER erfrischend, weil das, was sie sahen, ihren Erfahrungen entsprach.“
Den ER-Ärzten wurde durchaus zugestanden, dass sie Fehler machten. Sie stießen immer wieder an die Grenzen ihrer Fähigkeiten und hatten nicht immer Erfolg als Retter in der Not. Das neuartige Konzept begeisterte vor allen Dingen jüngere Zuschauer im Alter von 20 Jahren aufwärts. Zum Vergleich: Schwarzwaldklinik & Co. erreichten ein überwiegend älteres Publikum. Für Serienfans, die ein beschauliches Erzähltempo bevorzugten, war ER nicht das Richtige. „Die Serie funktioniert nach dem Prinzip Überforderung“, erläutert Hagemeyer. „Dem Zuschauer fliegen die Fakten nur so um die Ohren. Dramaturgisch ein geschickter Schachzug, denn Hektik und Infodichte erzeugen Spannung, zwingen zur Handlung. Die Amerikaner haben ein Händchen für solches Storytelling. Allerdings fließen dort auch fünf Millionen Dollar in eine Episode. Davon können deutsche Produktionen nur träumen.“
Nach ER war die Tür offen für innovative Arztserien. Das Interesse an traditionellen Settings und überhöhten Protagonisten ging zurück, riss aber nicht ab. Im Jahr 2002 ergab eine Umfrage des Allensbach-Instituts, dass immerhin noch 15 Prozent der Zuschauer bei Arztsoaps „sehr gerne“ einschalten.
Der Gefürchtete
Wo es Helden gibt, muss es auch Antihelden geben. Dr. Gregory House fällt in diese Kategorie. Der Spezialist für Infektionskrankheiten ist griesgrämig und gemein, aber ein genialer Diagnostiker, der auch die obskursten Krankheitsherde aufspürt. Der Haken: Patienten behandelt der Lebensretter ohne jedes Mitgefühl. Nicht umsonst lautet sein Motto: Menschlichkeit wird überbewertet.
Einen zynischeren Fernseharzt als House hat es bisher nicht gegeben. Selbst seine Kollegen und Freunde sind vor seinen bissigen Bemerkungen nicht sicher. Ein unkonventioneller Protagonist für das Medical Drama. Ungewöhnlich an der Serie ist außerdem die Schmerzmittelabhängigkeit des Protagonisten, die in jeder Episode offen thematisiert wird. House schluckt regelmäßig Pillen, um seine Schmerzen im rechten Bein zu lindern, wo ihm ein Teil des Oberschenkelmuskels entfernt werden musste. Sein Handicap zwingt ihn außerdem dazu, am Stock zu gehen. Ein weiteres Detail, das ihn von den archetypischen, attraktiven medizinischen Lichtfiguren unterscheidet, deren gutes Aussehen fachliche Souveränität signalisiert.
Am Respekt seines Umfelds mangelt es House nicht. Sein Fachwissen verschafft ihm eine Sonderstellung. Hagemeyer ist allerdings wenig überzeugt vom medizinischem Know-how des TV-Kollegen: „Diagnosen, die House stellt, sind teilweise ziemlich absurd, oft rollt er die Fälle von hinten auf. Aber er ist ein klassisches Beispiel für den Arzt als Detektiv. Das ist dramaturgisch interessant für alle und die Medizin sorgt dort hauptsächlich für spannende Wendungen im Drehbuch.“
Der Beliebtheit von House beim Publikum tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil, seit Serienstart im Jahr 2004 hat sie mit Emmy und Golden Globe die wichtigsten US-Fernsehawards gewonnen. House-Darsteller Hugh Laurie erklärt sich den anhaltenden Erfolg wie folgt: „Meine Theorie lautet, dass die Leute die Nase voll haben von der Political Correctness unserer Zeit. Es ist nicht mehr erlaubt, die Wahrheit auszusprechen, alles muss beschönigt werden. House hat kein Interesse daran. Er sagt, was er denkt.“ In Sachen Autorität steht Dr. House anderen Fernsehärzten in nichts nach. Er ruht nicht, bis ein Fall gelöst ist. In seinem Streben danach, Menschenleben zu retten, fügt er sich in die traditionelle Darstellung des Fernseharztes ein. Seine Figur zeigt aber auch, dass die dramaturgischen Möglichkeiten des Genres seit seiner Entstehung vielfältiger geworden sind. Die Protagonisten der Serien müssen nicht mehr unbedingt nett oder überirdisch schön sein. Es gelingt ihnen nicht immer, Leben zu retten. House ist das beste Beispiel dafür, dass nicht mehr nur Zuckerguss als Erfolgsrezept der Arztserie funktioniert. Er ist der Inbegriff der Arroganz. Ein unausstehlicher Halbgott in weiß, aber ein Halbgott nichtsdestotrotz.
Susanne TheisenFreie Journalistin in KölnSusanneTheisen@gmx.net