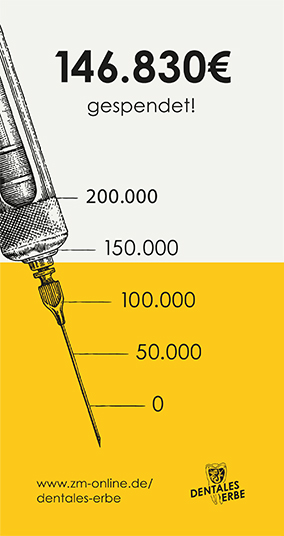Fast echt
Andreas B. hat Stress. Vor den Augen des Medizinstudenten wird ein Fahrradfahrer auf dem münsterschen Promenadenring durch die Luft geschleudert. Der 24-Jährige eilt zu Hilfe, während genervte Autofahrer um die Wette hupen.
Situationen wie diese lernen angehende Ärzte an der Universität Münster jetzt in realitätsnaher Umgebung zu meistern. „Simu-Scape“ heißt das Projekt, bei dem künftig nicht nur Verkehrsunfälle in mehrminütigen 3-D-Filmen simuliert werden sollen.
Auch Drogensüchtige in Bahnhofstoiletten und alte Damen in Dachwohnungen werden die Hochschüler nach Vorstellungen der Medizinischen Fakultät bald in einem zylinderförmigen, rund 25 Quadratmeter Fläche umfassenden Uni-Anbau behandeln. Im Inneren projizieren sieben Beamer bewegte Bilder an die Wand. Diese verschmelzen zu einer Rundum-Perspektive mit Tiefenwirkung und erzeugen einen realistischen Eindruck eines beliebigen Umfelds.
Entwickelt hat den Umgebungssimulator das Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik in Berlin. Dr. Bernhard Marschall, Studiendekan in Münster, betont den Nutzen der Investition: „Ein projiziertes Wohnzimmer ist günstiger als jedes echte oder nachgebaute.“ Mit den 3-D-Filmen soll die Realitätsnähe in der Ausbildung wachsen.
Im zahn-/medizinischen Berufsalltag sind neben fachlichen Qualifikationen soziale Kompetenzen gefragt. Nicht nur in Stellenanzeigen für Chefarztpositionen werden soft skills verlangt: „Wir suchen einen verantwortungsvollen, teamfähigen und kompetenten Behandler“, schreibt eine Gemeinschaftspraxis. Ein Zahnarzt sucht einen Partner „mit Freude am Patienten“ und „Einfühlungsvermögen“. Fachhochschulen und Institute bieten Zusatzausbildungen an. Auf dem Stundenplan: zwischenmenschliche Kommunikation und interkulturelle Kompetenz, Mitarbeiterführung und Teamfähigkeit, Emotion und Motivation, Rhetorik und Körpersprache. Rollenspiele sollen eigene Handlungsmuster aufzeigen. Ihre Rolle als Arzt oder Zahnarzt erproben Studenten an deutschen Universitäten inzwischen mithilfe von Simulationen. Schauspieler, Hightech-Puppen und nachgebaute Krankenzimmer sollen mehr Praxisnähe bringen sowie gleichzeitig non-technical skills schulen.
„Medizin nur aus Büchern zu lernen ist so, als würde man ohne Seekarte zur See fahren“, sagt Prof. Dr. Matthias Rothmund. Der Medizindekan der Philipps-Universität Marburg begrüßt, dass an seiner Fakultät das interdisziplinäre Skills Lab „Maris“ entstanden ist. Das Trainingszentrum zum Einüben praktischer ärztlicher Fertigkeiten startete zum Wintersemester 2008/2009. Angeregt hatten das Lernzentrum Studenten. Sie wünschten sich einen höheren Praxisanteil während der Ausbildung.
Seitdem haben die Hochschüler gute Erfahrungen gemacht: Sie nutzen das Skills Lab für curriculare Angebote, Kurse und Tutorien sowie zum Selbststudium. Sie üben mit interaktiven Puppen, Modellen und Simulationspatienten – in realitätsnahen Situationen und Settings. Künftig sollen zudem visuelle Fähigkeiten geschult und Bildmaterial interpretiert werden.
Realitätsnahe Rollenspiele
Die Mitarbeiter des Maris sehen große Vorteile in der Arbeit mit Schauspielern, die Patienten mimen: „Die Studenten gewinnen enorm an Sicherheit für den ohnehin belastenden Klinikalltag“, betonen die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Andrea Schönbauer und Tina Stibane. Das Training im geschützten Rahmen bringe Selbstvertrauen und werde als extrem authentisch erlebt.
Mit Simulationspatienten trainieren angehende Mediziner nicht nur körperliche Untersuchungstechniken, sondern auch kommunikative Fertigkeiten. In den realitätsnahen Rollenspielen bleibt es laut Schönbauer und Stibane nicht bei Anamneseerhebungen: Die Studenten beraten, klären auf und erläutern Untersuchungen. Selbst schwierige Situationen erproben sie im geschützten Rahmen. Sie lernen, Patienten nachhaltig zu überzeugen, wann sie sich als Arzt im Gespräch zurücknehmen sollten und wie sie schlechte Nachrichten angemessen formulieren. Sie erfahren, wie sie in Gestik, Mimik, Sprache und Fragetechniken auf ihren Gegenüber wirken. Das rüstet sie aus, später vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehungen aufzubauen. Auf die Gespräche bereiten sich auch die Simulationspatienten vor. Sie spielen eine vorgegebene Rolle, präsentieren eine bestimmte Krankheit, geben Feedback zu Auftreten und Gesprächsverhalten.
Klinik der Simulanten
Ähnlich ist es in Münster: Im Studienhospital der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität liegen regelmäßig Schauspieler im Bett. Seit Ende 2007 absolvieren Medizinstudenten dort wesentliche Teile ihrer praktischen Ausbildung. Studiendekan Marschall will dadurch nicht nur mehr Praxisnähe erreichen, sondern vor allem mehr Lehreffizienz. „Die Lehrforschung hat belegt, dass Wissen und Fähigkeiten, die man unter realen Bedingungen erwirbt, besser erinnerlich und abrufbar sind“, sagt der Initiator der Einrichtung.
Um situatives Lernen zu ermöglichen, konzipierte Marschall ein Krankenhaus im Kleinen. Helle Wände, glatter Boden, schlichte Gardinen, Krankenbetten, Nachtschränkchen mit Blumenvase – bis ins Detail soll die Ausstattung Klinikstandard und -atmosphäre treffen. Der Student soll in diese Welt eintauchen und so das Erlernte besser behalten.
Europaweit gibt es laut den Initiatoren kein vergleichbares Projekt. Das Ausbildungskonzept erhielt im vergangenen Jahr den Janssen-Cilag-Zukunftspreis. Zudem brachte es die Fakultät beim aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in puncto Praxisbezug neun Plätze weiter nach vorn, wie Pressesprecher Dr. Tobias Bauer unterstreicht. Nun liege Münster in dieser Kategorie auf Rang vier.
„Der Nächste bitte“, heißt es seit Ende 2008 in zweiten Trakt des ehemaligen Schwesternwohnheims. „Über die Hälfte der Studierenden arbeitet später ambulant“, betont Dr. Hendrik Friederichs, Leiter des Studienhospitals. Eine Studienpraxis mit Rezeption und Wartezimmer soll dem Rechnung tragen: Bis zu elf gleichzeitig wartende Patienten und schwierige Diagnosen gehören zum Konzept. Neben Krankenhaus, Praxis und 3-D-Filmen kommen in Münster weitere Simulationen zum Einsatz: In einem Alterssimulationsset erfahren Hochschüler, wie sich betagte Menschen fühlen. Dazu streifen sie einen unbequemen Anzug über, der Beweglichkeit und Gesichtsfeld einengt. Die Auskultationspuppe „Harvey“ zeigt lebensechte Lungen- und Herzgeräusche. 2010 soll ein Operationstrakt die Einrichtung komplettieren.
Puppen, Roboter und Patienten
Dummys wie Harvey sind geduldige Patienten. Dies schätzen Heidelberger Studenten, die seit vergangenem Jahr an der dortigen Universitätsklinik für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten mit neuen Phantompuppen mit auswechselbaren Gebissen arbeiten. An insgesamt 84 modernen Multimedia-Simulationsarbeitsplätzen lernen sie systematisch die einzelnen Arbeitsschritte der Zahnerhaltung und des Zahnersatzes (siehe zm 20/08, S. 64ff).
Ungeduldig ist dagegen eine 1,60 Meter große elektronische Patientin aus Japan (siehe auch zm 19/08, S. 32ff). Sie ruft „Aua“ und „Das tut weh“, sobald ein angehender Zahnmediziner einen Nerv anbohrt. Nicht wie ein Gegenstand, sondern wie ein menschliches Wesen möchte „Simroid“ laut Hersteller behandelt werden. Damit zwinge die Roboterdame zu mehr Feingefühl. Schließlich soll der Behandler von morgen wissen, wie sich der Patient auf seinem Stuhl fühlt.
Das Studium frühzeitig patientennah zu gestalten, ist das Ziel des Greifswalder Modells „Der Frühe Patientenkontakt“ (siehe zm 11/06, S. 96ff). Bereits ab dem zweiten vorklinischen Semester betreuen mittlerweile alle Zahnmedizinstudenten einen Patienten in seiner häuslichen Umgebung, machen sich mit dessen intraoraler Situation vertraut und erstellen einen individuellen Mundhygieneplan. Über ein Jahr lang bauen sie eine Vertrauensbasis zu der betreuten Person auf: mal ist es ein Mittvierziger mit Alkoholikervergangenheit, mal eine pflegebedürftige Rentnerin, mal ein Jugendlicher mit Lernschwäche. Ein Kurs in ärztlicher Gesprächsführung schult sie für den Umgang mit Patienten. Hinzu kommen Vorlesungen und Hospitationen. „Soziale Kompetenzen sind mindestens genauso wichtig wie zahntechnisches Know-how“, bekräftigt Oberärztin Dr. Anja Ratzmann. Um jemanden adäquat behandeln zu können, müsse die Arzt-Patienten-Beziehung stimmen. Die „Person hinter dem Zahn“ sollen die angehenden Zahnmediziner erfassen und einschätzen lernen.
Geschulte Schauspieler
Seit zwei Jahren kommen deshalb auch speziell geschulte Schauspieler zum Einsatz: In einer Zusatzprüfung im Physikum beweisen die Kursteilnehmer, was sie im Programm gelernt haben. „Wir haben das standardisierte OSCE-Prüfungsverfahren aus der Medizin angepasst“, berichtet Ratzmann. Die Teilnehmer durchlaufen einen Parcours, zwei Prüfer bewerten anhand von Checklisten, ob sie etwa die richtigen Fragen stellen. Bevor der künftige Behandler in den Mund schaut, erfragt er beispielsweise die Krankengeschichte. „Hatten Sie Kinderkrankheiten?“ „Ja, Masern“, antwortet der Simulationspatient. Das Verfahren soll kognitive Fähigkeiten sowie manuelle und kommunikative Fertigkeiten ab- und ausbilden.
Ein weiterer Baustein des interdisziplinär ausgerichteten Modells „Der Frühe Patientenkontakt“ ist Problemorientiertes Lernen (POL). Bei dieser Lehrmethode präsentieren die Dozenten die Fakten zu einer Erkrankung nicht fachspezifisch gegliedert und geordnet in einer Vorlesung, sondern die Hochschüler sind selbst gefordert: Ein Patient steht mit einem Problem vor ihnen – wenn anfangs auch nur als Fall auf dem Papier – und sie sollen dieses lösen.
„Die Studierenden eignen sich Wissen hauptsächlich durch Selbststudium an, diskutieren ihre Lösungen“, berichtet Dr. Gabriele Viergutz von der Universität Dresden. POL setzt die Zahn-/Medizin der sächsischen Hochschule ein, um dynamischen Wissenserwerb und interdisziplinäres Arbeiten zu fördern. Gleichzeitig lerne der Nachwuchs so im Team zu arbeiten.
Stimme für den Simulator
Rund 400 Kilometer entfernt, in Rostock, spricht der Patientensimulator: Mithilfe eines eingebauten Lautsprechers und eines Mikrofons leihen dort Ausbilder der Puppe „Igor“ ihre Stimme. Seit vergangenem Semester trainieren Studenten, Ärzte, Pflegepersonal, Rettungsdienstmitarbeiter und verwandte Berufe an dem kabellosen Trainingsmodell – vor allem, wie sie lebensbedrohliche Krankheitsbilder behandeln. Das Modell sei derzeit der weltweit modernste Simulator, betont Dr. med. Gernot Rücker, Leiter der Rostocker Simulationsanlage für Notfallausbildung.
Igor schwitzt, röchelt, blutet, wird blau. „Wir können unzählige Krankheitsbilder imitieren“, sagt Rücker. Welche tatsächlich auf dem Programm stehen, hängt von der Zielgruppe ab. Zahnärzte lernen etwa, wie sie die ersten zehn Minuten bei einer allergischen Reaktion ihres Patienten in ihrer Praxis überstehen.
Jeder Handgriff soll für den Ernstfall sitzen: „Es geht vor allem um die richtige Abfolge der Handgriffe und eine zielgerichtete Diagnostik vitalbedrohlicher Zustände“, erklärt der Notfallmediziner. Die Schulungsteil-nehmer müssen Symptome zur richtigen Diagnose zusammenbauen und schnell reagieren. „Wir fokussieren Kernkompetenzen“, betont Rücker.
Die Rostocker Anlage besteht aus einem Drei-Betten-Seminarraum und einer Drei-Betten-Intensivstation für Patientensimulatoren. Sie verfügt über drei voll ausgestattete Beatmungsbetten, Notfall-Sets mit Defibrillatoren, Medikamenten und mobilen Beatmungsgeräten sowie einer kompletten Rettungswagen-Ausrüstung. Rund 2 000 Teilnehmer kommen laut Rücker pro Jahr, arbeiten an den über 40 Puppen und Modellen. Zielgruppen wie Notfallteams lernen dabei die richtige Kommunikation: Sie gehört ebenso zum Notfallmanagement wie Handwerk und Ausrüstung. Im Schockraum mit Schwerverletzten ist es laut Rückers sehr wichtig, wie sich das Team untereinander austauscht.
Vergleichbare Szenarien erproben Ärzte jedes Ausbildungsstandes im Lehr- und Simulationszentrum für Anaesthesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin an der Uniklinik Göttingen. Kameras zeichnen die Szenen auf, um das Verhalten detailliert analysieren zu können. Wie Notfallmediziner Arndt Timmermann in der Ärzte-Zeitung berichtet, sind Kommunikationsprobleme verantwortlich für viele Schwierigkeiten in Notsituationen.
„Oft fällt auf, dass der leitende Arzt das Richtige denkt und tut, aber es nicht sagt“, betont der Leiter des Göttinger Zentrums. Auch non-technical skills wie Organisationstalent und Führungskompetenzen trainieren die Kursteilnehmer. Anforderungen, die nicht nur in 3-D-Filmen und Stellenanzeigen, sondern gerade auch im Berufsalltag an sie gestellt werden.
Janine ReichertJournalistin in Kölntext.reichert@gmx.de