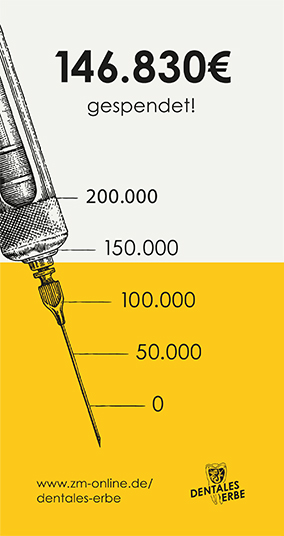Schöner Schein
Sogar Heidi Klum zitiert in ihrer Casting-Show indirekt die alten Römer: Nur wer am Schluss ein Foto seiner selbst von ihr erhält, kommt nämlich in die nächste Runde – ähnlich wie Narcissus, Archetypus der Selbstliebe, in Ovids Metamorphosen seinem Spiegelbild im Wasser verfällt und „von den eigenen Augen verzehrt“ wird. Selbst in den Tiefen des Reality-TV gilt die Antike also noch als wegweisend für die Definition von Schönheit. Wird in unserer Gesellschaft der perfekte Körper öffentlich zur Schau gestellt, bezog sich der Begriff der Schönheit zu jener Zeit allerdings maßgeblich auch auf die inneren Werte. Schön sein, das hieß gütig sein, wahrhaftig sein. Denn anhand dieser drei fundamentalen Werte könne jedes Ding bestimmt werden, glaubte man. Schönheit beinhaltete die Harmonie von Seele und Körper. „Wer schön ist, ist lieb, wer nicht schön ist, ist nicht lieb“, schrieb etwa der griechische Dichter Hesiod. 300 Jahre später, also 450 vor Christus, wurde Sokrates, berühmt für seine Hässlichkeit, dafür indes nicht mehr verunglimpft: Er strahlte, so sagte man, von innen. Noch heute bezeichnen wir etwas als schön, wenn es uns gefällt oder gut erscheint. Dennoch ist das, was als schön empfunden wird, stark abhängig von der Epoche und der jeweiligen Kultur.
Dass Schönheit in erster Linie eine Frage der Proportion ist, geht auf Platon zurück. Die bis vor einigen Jahren gültigen Traummaße 90-60-90 beschrieben damals freilich noch nicht das Ideal – wenngleich schon Pythagoras exakte mathematische Regeln vorgab, um die perfekte Relation zu ermitteln. Darauf aufbauend prägte auch Vitruv im 1. Jahrhundert vor Christus das Schönheitsbild, indem er die richtigen Proportionen des Körpers als Teile des Ganzen verstand. Das Gesicht sollte beispielsweise ein Zehntel des Gesamtkörpers ausmachen, der Kopf ein Achtel. Eine Definition, die für Kunst und Mensch gleichermaßen zutraf: „Kein Tempel kann ohne Symmetrie und Proportion eine vernünftige Formgebung haben, wenn seine Glieder nicht in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, wie die Glieder eines wohlgeformten Menschen.“ Auch der griechische Bildhauer Polyklet, geboren um 480 vor Christus, setzte sich mit den idealen Maßverhältnissen des menschlichen Körpers auseinander. In seinem „Kanon“ definierte er, dass sich der Kopf zum Körper verhalten muss, wie der Körper zu den Beinen. Er verzichtet auf feste Einheiten, es gibt nur organische Unterscheidungsmerkmale: Die Beziehungen zwischen den Körperteilen werden je nach Körperbewegung, Perspektive und Stellung zum Betrachter bestimmt. Nicht nur antike Künstler bezogen sich auf seine Theorien, auch Philosophen und Ärzte beriefen sich auf ihn, um auf die allgemeine Gültigkeit ihrer Lehren zu verweisen. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dünn – das war das rechte Maß. Zu gewinnen nicht nur anhand von Zahlen und Formen, auch die Haltung eines Menschen und seine Gefühlslage konnten die richtige Norm zum Ausdruck bringen. Seine bekannteste Statue, der Doryphoros, galt als steinernde Manifestation der absoluten Schönheit. Tatsächlich verkörpert dieser Speerträger das rechte Maß in jedem Sinn, wiewohl in den Körperformen als auch in Haltung und geistigen Ausdruck. In ihm sind die Gegensätze festgehalten, die sich im Ganzen ausgleichen: Ruhe und Bewegung, Spannung und Entspannung, Hebung und Senkung.
Göttliche Proportionen
Proportion und Harmonie, die man als Gleichgewicht der Gegensätze deutete, plus Symmetrie avancieren ab der griechischen Klassik zu wichtigen Kriterien der Schönheit. Piero della Francesca, Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer studieren Jahrhunderte später Platons regelmäßige Körper und preisen sie als ideale Modelle: Der Goldene Schnitt, er gilt ab hier als göttliche Proportion. Alles in allem sprach man offenbar in allen Zeiten von Proportion – wenngleich sich ihre Bedeutung trotz der geometrischen und arithmetischen Prinzipien, derer man sich bediente, ständig änderte.
Natürlich hatte auch das Hässliche in diesem Kosmos seinen Platz. So stellte man sich im Mittelalter vor, dass auch die Monster als Verkörperung des Hässlichen – und sei es nur als Kontrast – zur Schönheit des Ganzen beitragen. Erst an der Schwelle zur Neuzeit wandelt sich das Denken. Ärzte und Forscher sind zwar immer noch fasziniert vom Bestiarium und führen in ihren Werken neben der Beschreibung physiologischer Deformationen weiterhin auch fabelhafte Ungeheuer wie Sirenen und Drachen auf.
Dennoch verliert das Monstrum nach und nach seinen Symbolgehalt und wird zunehmend zum Kuriosum der Natur. Es geht nicht mehr um schön oder hässlich, es geht darum, die Abweichung zu studieren. Man folgt wissenschaftlichen Kriterien – wenn auch noch in fantastischer Form – und lässt sich nicht mehr vom mystischen, sondern naturkundlichen Interesse leiten.
Survival of the Prettiest
Erst in der Moderne macht die ästhetische einer funktionalen Schönheit Platz – die direkte Folge von Massenproduktion, Technisierung und Kommerzialisierung. Die neue Schönheit ist Objekt und hat ihre Einzigartigkeit weitestgehend eingebüßt: Sie ist reproduzierbar geworden. Obwohl die Massenmedien kein einheitliches Vorbild liefern – im Gegenteil, teilweise entdecken sie die Formen des 19. und 20. Jahrhunderts neu – muss der Körper in erster Linie eins sein: makellos. Wenn die Figur nicht stimmt, wird nachgeholfen: Body-Shaping und -Styling sind mittlerweile akzeptierte Renovierungstechniken, der Gang ins Fitnessstudio Pflicht. Wer diesem Ideal nicht nacheifert, ist nicht nur dick, nein, auch faul und hässlich. Attraktivität ist das entscheidende Kriterium – nicht nur bei der Wahl des Partners, sondern auch im Hinblick auf Karrierechancen und Beliebtheit im Freundeskreis. Im Klartext: Schön sein, heißt erfolgreich sein. Und Schönheit ist Macht. Niedliche Babys erhalten mehr Aufmerksamkeit, hübsche Kinder bessere Noten, attraktive Frauen und Männer lukrativere Jobs, gut aussehende Kriminelle werden seltener angeklagt und milder bestraft. Ja, schöne Menschen gelten nicht nur als sympathischer, zufriedener, geselliger und siegreicher, sondern auch als smarter, vertrauenswürdiger, fleißiger und kreativer.
Auch an der Medizin und Zahnmedizin geht diese Entwicklung nicht spurlos vorüber. Bereits 2004 konstatierte die Bundesärztekammer eine Vermarktung schönheitschirurgischer Leistungen in den Medien. Dort werde „eine Scheinrealität konstruiert, die Schönheitsoperationen zu einem erstrebenswerten Konsumgut werden lassen. Dem Zuschauer wird suggeriert, jeder könne durch einen chirurgischen Eingriff an Nase, Kinn, Brust oder Beinen besser aussehen“. Schönheits-OPs seien aber keine harmlosen Eingriffe. Häufig rede man die Risiken solcher Operationen klein und verstärke dadurch den Eindruck, dass eine Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes weitgehend komplikationsfrei sei. „Wir müssen verhindern, dass unsere Kinder sich in ihrem Selbstwertgefühl vor allem durch suggerierte Defizite gegenüber Stars und Sternchen definieren – Persönlichkeit ist keine Frage der Chirurgie“, betonte der ehemalige Ärztepräsident Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe in dem Kontext. 2011 wurde mit Änderung der Musterberufsordnung auch die Regelung zur ärztlichen Aufklärung modifiziert: Indem Ärzte ihren Patienten ausreichend Bedenkzeit einräumen müssen, will die Kammer sicherstellen, dass Patienten vor allem bei medizinisch nicht notwendigen Schönheitsoperationen einen geplanten Eingriff noch einmal abwägen können.
Kosmetik versus Ethik
Dass die Orientierung der zahnmedizinischen Berufsausübung an kosmetischen Aspekten die Gefahr der Vergewerblichung des Berufsstandes birgt, verdeutlicht auch Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer: „Folgen sind Vertrauensverlust auf Seiten der Patienten und der Verlust der besonderen Stellung des Zahnarztes als freier Beruf in der gesellschaftlichen Werteorientierung.“ Keinesfalls dürfe ökonomische Gewinnorientierung das freiberufliche Leistungsethos überlagern. Eine klare Werteorientierung sei für die Zahnärzteschaft von zentraler Bedeutung und verlange eine intensive Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Trends. Oesterreich: „Auch Wünsche der Patienten im Hinblick auf kosmetische Eingriffe bedürfen einerseits der Abklärung psychosomatischer Krankheitsbilder wie der körperdysmorphen Störung und andererseits eines besonderen Aufklärungs- und Abwägungsprozesses hinsichtlich möglicher schädigender Folgewirkungen auf die Gesundheit des Patienten.“ Ob Heidis Mädchen diese Kassandrarufe hören? Vielleicht tickt das 21. Jahrhundert anders – die Trojaner schenkten der Prophetin jedenfalls kein Gehör.