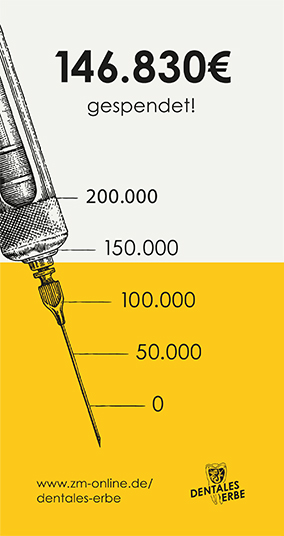Zwei Seiten einer Medaille
Sind sie schon Patient in unserer Praxis?“, fragt die Schwester in den Telefonhörer. „Nein? Dann tut es mir leid, aber wir können Sie hier nicht mehr aufnehmen. Bitte wenden Sie sich an eine andere Praxis.“ Alltag in einer Doppelpraxis für Kinder- und Jugendmedizin. Nicht auf dem flachen Land in Hintertupfingen oder der Uckermark, die ja sonst immer als Exempel herhalten muss, wenn es um Versorgungsmissstände geht. Nein, die Praxis liegt mitten in der Bundeshauptstadt, im Berliner Bezirk Pankow. Das Problem: Eine der beiden Ärztinnen ist in Pension gegangen. Trotz eines langen Atems und vieler Vorstellungsgespräche konnte kein Nachfolger gefunden werden. Das heißt, es wurde einer gefunden. Aber der ist mit der Zulassung in einen anderen Stadtbezirk gegangen – mit dem Segen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Jetzt führt die Ärztin die Praxis allein. Die mangelnde Unterstützung der KV ärgert sie: „Die KV hat das Regelleistungsvolumen für die Doppelpraxis einfach durch zwei geteilt, dabei habe ich pro Quartal an die 400 bis 500 Patienten mehr. Die KV weigert sich jedoch konsequent, diesen Mehraufwand zu erstatten“, moniert die Ärztin.
Grundzüge Gesetzentwurf
Um strukturellen Missständen in der medizinischen Versorgungslandschaft den Garaus zu machen, verständigten sich das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit den Koalitionsfraktionen von CDU und FDP nach monatelangen Verhandlungen auf Eckpunkte für das sogenannte Versorgungsgesetz, das am am 1. Januar 2012 in Kraft treten soll. Das geplante Maßnahmenbündel umfasst 14 Themenkomplexe. Zuvor einigte sich die Bund-Länder-Komission zu Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Deutschland im Rahmen der Erarbeitung des Gesetzes bereits auf einer finalen Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am 6. April auf 27 konsentierte Punkte. Den Kern des Kommissionspapiers bilden die Schwerpunkte:
• Reform der Bedarfsplanung
• Erweiterung der Länderkompetenzen
• Reform der Aus- und Fortbildung
Bei der Bedarfsplanung soll die verbindliche Vorgabe entfallen, dass Planungsbereiche den Stadt- und Landkreisen entsprechen. Die neue Prämisse ist, sich bei der Planung an einer flächendeckenden Versorgung zu orientieren. Zudem soll die Anpassung der Verhältniszahlen künftig allein nach den in § 101 Abs. 2 SGB V genannten sachgerechten Kriterien und nicht mehr stichtagsbezogen erfolgen.
Die Aus- und Fortbildung von Ärzten soll in mehreren Punkten reformiert werden: Geplant ist, die Studienplatzzahl in der Humanmedizin zu erhöhen. An den Kosten für den Ausbau will sich der Bund beteiligen. Zudem sollen die traditionellen Auswahlkriterien- und -verfahren überprüft werden. Neu ist, dass die Bedeutung der Abiturnote gesenkt werden soll – zugunsten anderer Kriterien wie einschlägige Berufsausbildungen, einem absolvierten Freiwilligen Sozialen Jahr oder einem Eignungs- und Motivationstest für medizinische Studiengänge. Eine Landarztquote soll die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sichern. Die KVen erhalten laut Gesetzentwurf die Chance, potenzielle Landärzte via Stipendium zu begleiten, wenn diese sich verpflichten, sich nach dem Studium als Landarzt niederzulassen.
Der Gesetzentwurf sieht vor dem Hintergrund eines Anstiegs von Frauen im Medizinberuf vor, den Vertretungszeitraum für Vertragsärzte bei der Geburt eines Kindes von sechs auf zwölf Monate zu verlängern. Für die Vertretung am Arbeitsplatz während der Betreuung des Kindes (maximal bis zum Alter von drei Jahren) sollen „Entlastungsassistenten“ geschaffen werden.
Rotes Licht aus Bayern und Bremen
Kaum veröffentlicht, hagelte es für den Gesetzentwurf schon Kritik aus einzelnen Ländern. Bayern und Bremen drohen mit Widerstand im Bundesrat, weil die schwarzgelbe Koalition frühere Vereinbarungen mit den Bundesländern nicht umsetzen will. Die Länder erhielten dadurch weniger Kompetenzen als gefordert. Der bayerische Gesundheitsminister Markus Söder kündigte an, dass es als Folge der ungeklärten Differenzen noch eine weitere Bund-Länder- Konferenz geben soll. Dies habe ihm Rösler zugesagt. Die Länder wüssten besser als Berlin, wo vor Ort Ärzte gebraucht werden.
Auch Bremen droht mit einem Nein im Bundesrat. Sollte Rösler das Konzept nicht noch einmal wesentlich überarbeiten, „dann zeigen die Länder ihm im Bundesrat geschlossen die rote Karte”, sagte der Bremer Gesundheits- Staatsrat Hermann Schulte-Sasse gegenüber der „Tageszeitung”. Sasse wirft dem Gesundheitsminister vor, in der Endfassung des Konzepts drei wesentliche Zugeständnisse an die Länder wieder herausgestrichen zu haben – auf Druck seiner eigenen Koalitionsfraktionen. „Für uns Länder stellt sich jetzt die Frage: Ist Rösler überhaupt verhandlungsfähig? Lohnt es sich, sich mit ihm stundenlang zusammenzusetzen, wenn er die Einigung nicht mal in seinen Fraktionen durchkriegt?”, barmte Schulte-Sasse.
Rösler und Regierung doktern an Symptomen
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Martina Bunge, erklärt: „Dieser Koalition fehlen Kraft, Mut und der Blick auf das Patientenwohl für ein vernünftiges Versorgungsgesetz. Stattdessen plant Schwarz-Gelb ein Ärztebeglückungspaket, das die Versicherten über Zusatzbeiträge bezahlen sollen.“ Deutschland habe vor allem ein Verteilungsproblem. In einigen Regionen fehlten Ärzte, in andern gäbe es zu viele. Bunge: „Das Geld muss dahin fließen, wo Versorgung gebraucht wird, und nicht dahin, wo die Ärzte sind.“ Die Aufhebung der Deckelung für Ärzte in unterversorgten Gebieten sei ein schönes Geschenk. Es bringe jedoch keinen einzigen zusätzlichen Arzt aufs Land. Dieser müsste nämlich damit rechnen, dass die Deckelung dann wieder gelte, wenn die Unterversorgung behoben ist. „Besser wäre die adequate Bezahlung der speziellen Anforderungen – wie zum Beispiel von Hausbesuchen – durch eine Umverteilung der Gelder“, erklärte die Politikerin.
Dr. Harald Terpe, drogenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages und Vorstandsmitglied der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, klagt: „Das Versorgungsgesetz wird die Versorgung nicht verbessern. Die Eckpunkte der schwarz-gelben Koalition enthalten nichts, was substanzielle Antworten liefert auf die kommenden Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung einer alternden Gesellschaft.“ Statt echte Strukturreformen für mehr Qualität auf den Weg zu bringen, doktert die Koalition an einzelnen Symptomen herum und nennt das eine Verbesserung der erlebten Versorgungsqualität.“ Konkret vermisst der Grünen-Politiker, übrigens gelernter Mediziner, Vorschläge zur Aufwertung der Primärversorgung, zur neuen Aufgabenverteilung zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Gesundheitsberufen sowie wirksame Schritte zur Überwindung der Trennung zwischen ambulantem und stationärem Sektor. Die neu geschaffenen Planungsgremien bezeichnet Terpe als „fragwürdig“ und „ohne echte Kompetenzen“. Anreize zum Abbau der Überversorgung würden endgültig abgeschafft, die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) erschwert. Echtes Lob klingt anders. Einen „großen Durchbruch“ nannte die Eckpunkte dagegen der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn.
BZÄK und KZBV haben sich positioniert
Auch Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben sich in ersten Stellungnahmen zu den Eckpunkten positioniert: So begleite die BZÄK die Erstellung der Eckpunkte des zukünftigen Versorgungsgesetzes intensiv, auch wenn im zahnärztlichen Sektor derzeit nicht von einer flächendeckenden Unterversorgung gesprochen werden könne. „Die nunmehr geplanten Strukturen zur Sicherstellung einer umfassenden ambulanten und stationären ärztlichen Versorgung würden schließlich auch im Falle einer medizahnmedizinischen Unterversorgung zum Tragen kommen“, erklärt RA Sven Tschoepe aus der Rechtsabteilung der BZÄK. Von hohem Interesse für die BZÄK wären zudem die mit dem Gesetzesvorhaben verknüpften grundlegenden strukturellen Fragen wie die stärkere Einbindung der Länder in die zukünftige Bedarfsplanung und die geplanten Veränderungen der Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), über die offenbar noch kein Konsens erzielt wurde.
Echo der KZBV: Das Eckpunktepapier sieht hinsichtlich der vertragszahnärztlichen Versorgung Neuregelungen zu einigen der Hauptkritikpunkte der Zahnärzteschaft vor. „Insbesondere soll dabei die bisherige strikte Budgetierung der Gesamtvergütungen unter Anbindung an die jeweilige Entwicklung der Grundlohnsumme beseitigt und den Vertragspartnern eine Berücksichtigung auch der Entwicklung von Zahl und Struktur der Versicherten ermöglicht werden“, konstatiert Dr. Thomas Muschallik, Leiter der KZBV-Rechtsabteilung. Zur Ablösung der Budgetierung sei zudem vorgesehen, dass die Gesamtvergütungen einmalig nicht auf der Grundlage der bisherigen, starren Budgets, sondern krankenkassen- beziehungsweise kassenartenbezogen auf der Grundlage der tatsächlich abgerechneten Punktmengen vereinbart werden. Im Übrigen bezögen sich die Aussagen im Eckpunktepapier im Wesentlichen auf spezifische Fragestellungen im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung und dort insbesondere auf den Bereich der Bedarfsplanung und -zulassung.
Verbände pochen auf Verbesserungen
Bedenken äußerten auch Vertreter der Verbände. „Eine klinische Universitätsausbildung mit bestmöglicher Patientenversorgung bekommt man nicht zum Nulltarif“, mahnt der Vorsitzende der Deutschen Hochschulmedizin e.V., Prof. Dieter Bitter-Suermann. Der Verband vertritt die Medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika. Es sei leicht, so Bitter-Suermann, gesundheitspolitische Wünsche zu äußern, wenn man die daraus resultierenden Leistungen nicht selbst erbringen oder bezahlen muss. „Wenn mehr Ärzte ohne entsprechende Ressourcen ausgebildet werden sollen, kann die anerkannte Qualität des Medizinstudiums nicht gehalten werden“, mahnt der Verbandschef, der auch Präsident des Medizinischen Fakultätentages ist.
Ann Marini, Pressereferentin beim GKVSpitzenverband, erklärte gegenüber den zm: „Die unterversorgten Regionen werden im Gesetzentwurf gut diskutiert. Allerdings sind wir der Ansicht, dass man auch über Regionen sprechen muss, die überversorgt sind.“ Insgesamt gebe es bundesweit nicht zu wenig Ärzte – sie seien jedoch ungleichmäßig verteilt. Der GKV-Spitzenverband fordert eine Annäherung zwischen ambulantem und stationärem Bereich. Hoch spezialisierte Fachärzte würden oft die gleichen Leistungen anbieten, wie ein Krankenhaus – etwa eine Augen-OP. Hier lägen noch Effizienzreserven verschüttet. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Johann-Magnus v. Stackelberg, ergänzt: „Viele konkrete Entscheidungen werden vor Ort, etwa in den Landesausschüssen, getroffen, in denen Ärzte und Krankenkassen an einem Tisch sitzen. Dass die Länder ihren Sachverstand künftig in solche Beratungen mit einbringen werden, ist zu begrüßen.“ Wichtig sei aber, dass die Entscheidungshoheit bei denen bleibt, die entweder als Mediziner die Leistung erbringen oder sie als Krankenkassen bezahlen. Stackelberg: „Das deutsche Gesundheitswesen ist nicht zuletzt deshalb eines der besten der Welt, weil die Konkretisierung und Umsetzung des staatlichen Rahmens in den Händen der tatsächlich Beteiligten liegt.“
Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum, erklärt: „Die Eckpunkte der Koalition sind zusammen mit den Ländervereinbarungen geeignet, die ambulante medizahnmedizinischen zinische Versorgung besser abzusichern. Die vorgesehene Neuordnung der spezialärztlichen Leistungen ist hinsichtlich der zukünftig alleine auf die Qualitätsanforderungen abstellenden Zulassungskriterien grundsätzlich zu begrüßen. Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte können damit zu gleichen Bedingungen in diesem Bereich tätig werden." Bei der Umsetzung müsse allerdings darauf geachtet werden, dassdas ambulante Leistungsspektrum, in dem die Kliniken heute Patienten versorgen, nicht kleiner werde. Sonst stünden die Enwicklungen im Widerspruch zu den Zielen eines Versorgungsgesetzes.
KBV-Chef Horst Köhler erklärt mit Blick auf die ambulanten Kodierrichtlinien (AKR): "In den Eckpunkten zum Versorgungsgesetz spricht die Regierungskoalition von leicht handhabbaren und einfacher umsetzbaren Kodierrichtlinien. Diese Aussage wird von uns begrüßt. Gleichzeitig fordern wir die Begrenzung auf einen repräsentativen Querschnitt. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, die AKR zu vereinfachen und praxistauglicher zu machen". Die KBV spricht im Unterschied zu anderen Akteuren von einem ausgesprochenen Ärztemangel und verweist auf Initiativen der einzelnen KVen, wie man diesem aktiv begegnet (Kasten)
Bei aller Reglementierung sollte man die Rechnung nicht ohne den Wirt, in diesem Fall ohne den medizinischen Nachwuchs, machen.
Beispiel Klinikärzte: Was sie bei der Entscheidung für einen beruflichen Standort bewegt, weiß Dr. Uta Korneli. Die Personalberaterin und Gesellschafterin von Korneli, Unger &: Partner GbR, Berlin, akquiriert im Auftrag von Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Universitätskliniken sämtliche Medizinberufe vom Arzt in Weiterbildung über den Chefarzt, Geschäftsführer, ärztlichen Direktor bis hin zum pflegedienstleiter. Gegenüber den zm gab Korneli Auskunft: "Wir fahren in jede Einrichtung, um einen Eindruck zu gewinnen und mit Überzeugung für die jeweilige Stelle eintreten zu können. Nur so können wir den Bewerbern glaubwürdig die Atmosphäre beschreiben." Neben monetären Aspektenseienauch sogenannte weiche Faktoren ausschlaggebend: "Wenn wir Ärzte in weniger attraktive Gegenden bewegen wollen, prüfen wir immer auch, was für Schulen es gibt und wo das nächste Theater liegt." Der hohe Anteil an Frauensei ausihrer Sicht auch ein Grund für den Ärztemangel, weil sie für Schwangerschaft, Niederkunft und Kinderbetreuung regelmäßig ausfallen. Entscheidend sei deshalb aber auch, ob es einen Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten gebe, so Korneli. Noch viel wichtiger sei aber heutzutage gerade für junge Ärzte, dassder Arbeitgeber ihnen eine gute Weiterbildung ermöglicht und dasssie in einer bestimmten Zeit ihren OP-Katalog abarbeiten könnten. "Unter dem Strich suchen junge Ärzte ein Haus mit einem modernen Management. Wenn die Bewerber beispielsweise sehen, dass das Krankenhaus eine total veraltete Homepage hat, ziehen sie den Schluss, dass die Klinikleitung nicht modern aufgestellt ist." Urbane Zentren sind beliebter als der ländliche Raum."Wir erleben ganz oft, dass Ärzte sich wünschen, nach Hamburg, Berlin oder München zu kommen - in Ballungszentren." In den neuen Bundesländern sei der "Ärztemangel" stärker spürbar, ausgenommen Dresdenund Leipzig. Korneli: "Wir akquirieren auch Ärzte aus dem Ausland. Dabei achten wir streng darauf, dass sie zum jeweiligen Zeitpunkt arbeitssuchend sind und somit dem jeweiligen Versorgungssystem nicht entzogen werden." DieseÄrzte sind fertig ausgebildete Mediziner und warten entweder auf eine Facharztausbildung oder sind auf der Suche nach einer Anstellung. In Deutschland erhalten die Ärzte dann nach einem Sprachtest (Kompetenzstufe B2) die vorübergehende Arbeitserlaubnis und können in die Weiterbildung nach deutschen Vorgaben gehen. "Wir haben uns diese Quelle erschlossen, weil wir für manche Häuserkeine Lösung hatten. Wir haben einfach keinen Kandidaten gefunden“, berichtet die Beraterin. Für sie spiegelt sich in den Stellenanzeigen der einschlägigen medizinischen Medien der Bedarf an Ärzten. Am meisten gesucht werden demnach momentan Psychiater und Psychotherapeuten. Ähnlich problematisch sei es in den Bereichen Innere Medizin, Anästhesie und Geriatrie. Aber auch für das Fachgebiet Gynäkologie sei es schwer, Ärzte zu finden.
Zahnmedizin als Teil des kommunalen Verbunds
Für das Fachgebiet Zahnmedizin wurde im eingangs erwähnten Komissionspapier unter Punkt 18 vermerkt: „Zusätzlicher Versorgungsbedarf kann zukünftig auch bei der vertragszahnärztlichen Versorgung festgestellt werden.“ Diesen „zusätzlichen Versorgungsbedarf“ findet man schon jetzt in einzelnen Regionen – etwa in der viel zitierten und in der Tat sehr dünn besiedelten (44 Einwohner/Quadratkilometer) Uckermark, dem größten deutschen Landkreis am nordöstlichen Rand der Re publik. Dort liegt die Kleinstadt Templin, wo Angela Merkel ihre Kindheit verbracht hat. Niedergelassene Zahnärztin vor Ort ist Kerstin Finger. Gegenüber den zm schildert sie die dortige Versorgungssituation: „Die Probleme anderer Regionen multiplizieren sich bei uns. Die demographische Situation schlägt doppelt zu. 25 Prozent der Menschen beziehen Hartz IV, 30 Prozent sind Rentner und das Gros der Menschen wird zu Hause gepflegt.“ Zahnmedizin sei für Finger auch eine aufsuchende Medizin. Damit rückt sie ethische Fragestellungen in den Vordergrund. Für ihre mobile Zahnarztpraxis – ein umgebauter Nissan NV 200 – wurde sie jetzt vom Brandenburgischen Landwirtschaftsministerium mit einem Preis ausgezeichnet. Sie fährt zu den Menschen, die nicht aus eigener Kraft zu ihr in die Praxis kommen können. Finger: „Vom Bund ausgearbeitete Richtlinien genügen nicht immer, um in unserer strukturschwachen Re gion etwas erreichen zu können.“ Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen schöpft Finger ihre freiberuflichen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Darüber hinaus plädiert sie für einen „dritten Sozialraum“, der von bürgerschaftlichen Engagement lebt. Die fachlich-personelle sowie materielle Ausstattung von zahnärztlichen Versorgungssystemen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stellen nur die notwendige quantitative Seite sicher. Die ambulante Versorgung müsse – bezogen auf den umgebenden Sozialraum – aktiv gestaltet werden. Sprich, professionelle Hilfssysteme sollten durch das Engagement von Angehörigen und Helfern aus der Nachbarschaft ergänzt werden. Finger: „Es besteht die Notwendigkeit, regionale individualisierte Behandlungssysteme zu entwickeln, in denen sich Selbsthilfesysteme, Profisysteme und gesellschaftliche Hilfssysteme treffen.“ So könnte man die „man power“ im ländlichen Raum optimal nutzen, um gemäß der Gesundheitsdefinition der WHO, zu „physischen, psychischen und sozialem Wohlbefinden beizutragen.“ Den Blick auf die Würde von immobilen Menschen gerichtet, sei „der Mundraum als ein Kulturraum zu betrachten. Er stellt die Verbindung von Innen- und Außenwelt dar.“ Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität führe eine reduzierte Zugänglichkeit zu zahnmedizinischer Betreuung zu verminderter Teilhabe am sozialen Leben.
Finger verweist auf die Möglichkeiten im Sozialversicherungsrecht zur Gestaltung von Projekten mit Modellcharakter. „Die von den Kranken- und Pflegekassen verwalteten Versichertengelder sind so einzusetzen, dass die finanziellen Mittel der Leistung folgen, wobei gebührentechnische Einschränkungen, wie die Budgetierung der Einzelbereiche und die numerische Beschränkung der Abrechenbarkeit bestimmter Gebührenpositionen, partiell außer Kraft gesetzt werden könnten“, bemerkt die Zahnärztin aus Templin.
Medizinische Versorgung ist kein Einzelschicksal
Gerade in Flächenländern mit einer schwierigen Alters- und Morbiditätsentwicklung besteht zeitnah die Notwendigkeit, gesetzliche Rahmenbedingungen auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Raumes zu übertragen, um die lokale medizinische Versorgung bedarfsgerecht zu decken (Unterversorgung) oder anzupassen (Überversorgung). Das bedingt eine konstruktive Kooperation von Leistungsträgern, Leistungserbringern und den Vertretern der Kommunen. Zusätzlich besteht Bedarf an bürgerschaftlichem Engagement, um die Lücke zwischen immobilen, aber noch zu Hause lebenden Patienten und dem professionellen Hilfssystem zu schließen. Eine rein quantitative Steigerung der Arztzahlen durch eine Erhöhung der Studienplätze ist unzureichend. Vielmehr müssen Akteure lokale Anreize schaffen, um den medizinischen Nachwuchs unter besonderer Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf langfristig vor Ort zu binden.