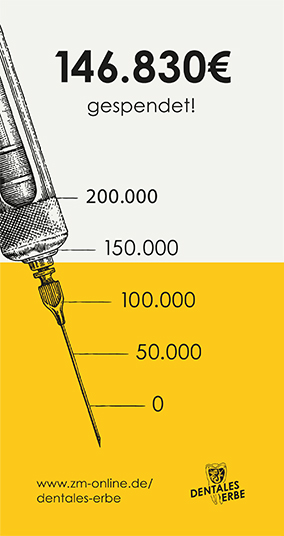Vorbeugen statt heilen
Stefan Grande
Erst vor wenigen Wochen noch wurde in Dresden die Zahnärzteschaft als Pionier medizinischer Vorsorge gelobt: Auf dem Nationalen Präventionskongress im September priesen Gesundheitsökonomen, Mediziner und Wissenschaftler unisono die Leistungen des Berufsstandes im Bereich präventiver Zahnheilkunde (siehe zm 20). Dabei ist die Erfolgsgeschichte zahnärzt- licher Vorsorge denkbar, manche meinen vermeintlich, einfach. Sie basiert auf einer Kombination von frühzeitiger Gruppen- prophylaxe (etwa über die Landesarbeits-gemeinschaften zur Verhütung von Zahn-erkrankungen in Kindergärten und Schulen) mit einer konstanten Individualprophylaxe bei älteren Patienten.
Beide haben positive Auswirkungen auf die Mundgesundheit der Deutschen, dargelegt in Untersuchungen wie der „Deutschen Mundgesundheitsstudie IV“ (DMS IV) des „Instituts Deutscher Zahnärzte“ (IDZ) aus dem Jahr 2006. Auch in Erhebungen der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege“ (DAJ) von 2009 sind die folgenden Ergebnisse dargestellt. Danach konnte in allen Altersgruppen ein massiver Rückgang an Karies festgestellt werden, bei Kindern ist im Vergleich zur DMS III von 1997 ein Minus von fast 60 Prozent zu verzeichnen. Auch Erwachsenen und Senioren attestiert die DMS IV einen starken Rückgang von Karies, wesentlich weniger Zähne mussten deswegen in den letzten drei Jahrzehnten extrahiert werden. Die Bilanz zahnärztlicher Prävention: Noch vor vierzig Jahren war der Zahnersatz bei Kindern und Jugendlichen die Regel, heute eher die Ausnahme. Und: Immer weniger Senioren sind auf Totalprothesen angewiesen.
Musterbeispiel Bonusheft
Diese Erfolge sind auf das ständige Bemühen des Berufsstandes zurückzuführen, die Mundgesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Hierbei wird ein großes Augenmerk auf die präventive Zahnheilkunde gelegt: Längst wird das Bonusheft von Verantwort-lichen in der Gesundheitspolitik, Kollegen aus der Allgemeinmedizin sowie von Gesundheitsökonomen und -forschern als Paradebeispiel für die Anregung gefeiert, wie man Patienten dazu animiert, aktiv am individuellen Gesundheitszustand mitzuwirken. Dies wurde auch durch eine aktuelle Befragung des Robert-Koch-Instituts bestätigt. Demnach nutzen 75 Prozent der Deutschen zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen.
Schon die DMS IV benannte Herausforderungen für die Zahnärzteschaft, die in den vergangenen Jahren immer dringlicher wurden. Karies und Parodontitis sind nach wie vor die wichtigsten oralen Erkrankungen und gelten als Volkskrankheiten. Die Professionelle Zahnreinigung (PZR) ist und bleibt daher wichtiger Pfeiler zahnmedizinischer Prävention. Defizite in der Mundgesund-heit gibt es unter anderem bei der prophylaktischen Betreuung sogenannter Risikogruppen, etwa bei Kleinkindern unter drei Jahren, bei Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen einhergehend mit niedriger Bildung und geringem Einkommen. Besonders kritisch ist die Mundgesundheit bei pflegebedürftigen Senioren und bei Menschen mit Behinderungen.
Prof. Gerd Glaeske vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen und Haupt-geschäftsführer des „Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung“ bestätigte in Dresden denn auch die Erkenntnisse von Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV): Bei der zahnmedizinischen Versorgung älterer Menschen in Pflege- und Altenheimen besteht eine eklatante Unterversorgung.
Versorgungskonzept für Pflegebedürftige
Doch sowohl BZÄK als auch KZBV haben in den vergangenen Jahren viel unter- nommen, um die Herausforderungen aktiv anzugehen. Und werden dies auch weiterhin tun. Beispiele:
• Beide Zahnärzteorganisationen haben gemeinsam mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften bereits im Jahr 2010 ein Konzept zur Betreuung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung vorgelegt. Zwar wurde im Versorgungsstrukturgesetz der Regierung zaghaft begonnen, diesen Missstand zu beheben. Nach Ansicht von BZÄK und KZBV ist aber noch ein weiter Weg zu beschreiten, bis der besondere Versorgungsbedarf der Betroffenen wirklich gedeckt werden kann. Vor allem müsse ein systematisches Präventionsmanagement installiert werden.
KZBV und der „Deutsche Caritasverband“ fordern daher die Einführung eines solchen zahnärztlichen Präventionsmanagements für Pflegebedürftige und Menschen mit Demenz (siehe zm 20). Hintergrund ist eine Untersuchung, die das IDZ durchgeführt hat. Ergebnis: Die Mundgesundheit und die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen sind deutlich schlechter als beim Bevölkerungsdurchschnitt.
Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer, führt aus: „Pflegebedürftige, Demenzkranke und Menschen mit Behinderung haben einen besonderen zahnärztlichen Behandlungs-bedarf, der in der gesetzlichen Krankenversicherung bisher kaum berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber hat zwar erste Schritte unternommen, die zahnärztliche Betreuung dieser Gruppen zu verbessern, eine systematische zahnärztliche Prävention gibt es für sie allerdings bisher nicht. Gezielte präventive Leistungen sind aber notwendig, denn diese Patienten sind zu einer eigen-verantwortlichen Mundhygiene oft nicht in der Lage. Diesen gravierenden Nachteil müssen wir durch vorsorgende Betreuung so weit wie möglich ausgleichen.“
Eßer verweist auch darauf, dass bei 50 Prozent aller Pflegebedürftigen in Heimen zwischen zwei Zahnarztterminen mehr als 22 Monate vergehen. Das sei zu lang und bestätige den erheblichen Handlungsbedarf, den die Zahnärzteschaft in der aufsuchenden Betreuung hätte.
Der Vizepräsident der BZÄK, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, weist zudem auf die besonders prekäre Lage von Kindern mit Behinderung hin: „Zwölfjährige, die mit einer Behinderung leben, erleiden bis zu 25-mal häufiger einen Verlust bleibender Zähne als der Durchschnitt der Altersgruppe.Das verlangt nach deutlich verstärkten präventiven Anstrengungen.“
Vielfältige Aktivitäten
• Beim Tag der Zahngesundheit stand in diesem Jahr explizit die Zahngesundheit älterer Menschen im Mittelpunkt. Zu diesem Anlass wurde unter Beteiligung von Wissenschaft, Verbänden, Politik und Wirtschaft in Berlin eine Initiative für eine bessere Vorsorge gegen Mund- und Zahn-erkrankungen auf den Weg gebracht (siehe zm 19). Die Gründer des „Forums Zahn- und Mundgesundheit Deutschland“ wollen „einen zielgerichteten, langfristigen Dialog mit Partnern aus Wissenschaft, Politik, Verbänden und Wirtschaft herstellen und fördern“. Den Vorsitz hat Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Das Thema Zahn- und Mundgesundheit kommt in der aktuellen politischen Debatte zur natio- nalen Präventionsstrategie (siehe Kasten) zu kurz. Das möchten wir ändern“, so Oesterreich.
• BZÄK und KZBV kündigten außerdem an, dass weitere Daten – insbesondere zur Mundgesundheit von Pflegebedürftigen in Privathaushalten – im Zuge der „Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie“ (DMS V) erhoben werden sollen, die 2013 anläuft.
• Zudem hat die Bundeszahnärztekammer erst im September des Jahres ihre bereits 2004 entwickelten Mundgesundheitsziele aktualisiert und konkretisiert (Näheres in diesem Heft).
• Darüber hinaus sind beide Berufsverbände aktive Mitglieder bei gesundheitsziele.de. Der 2002 auf Initiative der damaligen Bundesregierung gegründete Verbund vereint über 70 verschiedene Akteure im Gesundheitswesen. Mit konkreten Zielen will er unter anderem die Bevölkerung animieren, gesünder zu leben und mehr für die eigene Gesundheit zu tun.
Thema mit Geschichte
Das Thema Prävention ist auf der gesundheitspolitischen Agenda nicht neu: Schon in den 1970ern gab es Ansätze, die „Trimm Dich“-Bewegung gilt als prototypisch. In jüngster Zeit platzierte vor allem die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) zwischen 2001 und 2009 das Thema ganz oben auf der To-do-Liste. Schmidt war es auch, die ein eigenes Präventions- gesetz entworfen hat. Gesundheitsvorbeugung sollte als vierte Säule neben Akut- versorgung, Rehabilitation und Pflege fest im Gesundheitssystem verankert werden. Doch die Pläne verliefen im Sande (siehe Kasten „Gesundheitspolitische Chronik“).
Auch die derzeitige Koalition möchte die gesundheitliche Prävention stärken und stellt das Thema als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit dar. Aus gutem Grund: Jähr- lich werden in der GKV Milliardenbeträge ausgegeben, die für die Bekämpfung von Zivilisationskrankheiten und lebensstil-bedingten Erkrankungen aufgewendet werden müssen. Nach Ansicht von Experten wie etwa den Gesundheitssachverständigen ließe sich dieser Betrag mit gezielter Prävention um etliche Prozent vermindern.
Auch belegen Studien unterschiedlichster Couleur immer wieder: Angesichts der stetigen Alterung der Gesellschaft muss es einer nachhaltigen Gesundheitspolitik vor allem um drei Ziele bei der Prävention gehen: Gesundheit fördern und chronischen Krankheiten vorbeugen, Lebensqualität verbessern, Kosten einsparen.
Zwar haben CDU/CSU und FDP in ihrem Koalitionspapier 2009 ein Gesetz ausgeschlossen. Dennoch: Prävention, so heißt es aus dem Bundesministerium für Gesundheit, sei die zentrale Investition in die Zukunft. Die Vorstellungen aber, wie sie gestaltet werden soll, gehen (nicht nur in der Koalition) weit auseinander. Zudem weist das „Deutsche Ärzteblatt“ auf einen weiteren Umstand hin, der eine flottere Gangart bisher eher verhindert hat: „Die Präventionslandschaft hierzulande zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr zersplittert ist und auf unterschiedlichen Ebenen – oft von konkurrierenden Anbietern, häufig in Einzelprojekten – organisiert wird.“
Geißel Volkskrankheiten
Doch Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes mellitus gehören zu den großen gesundheitspolitischen Herausforderungen. Nach Angaben des Verbandsmagazins der Ersatzkassen waren 2008 bereits 63 Prozent aller weltweiten Todesfälle (insgesamt 36 Millionen) auf Volkskrankheiten zurückzuführen. Bundesweit verursachten sie im selben Jahr etwa 50,7 Prozent der gesamten Krankheits- kosten. Der Betrag hierfür belaufe sich auf 129 Milliarden Euro. Allein schon aus diesem Grund müsse Deutschland seine Präventionsmaßnahmen ausbauen. Auch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und bei der EU ist das Problem bekannt. Erst im September 2012 hat das europäische Regionalkomitee der WHO daher ein Konzept mit dem Schwerpunkt Gesundheits-förderung entwickelt. Ziel dabei ist es, die Gesundheit in der EU zu verbessern und die regionalen Ungleichheiten zu verringern. So gibt es derzeit etwa Unterschiede in der Lebenserwartung innerhalb der EU von dreizehn Jahren.
Der Gesundheitsexperte Werner Fürstenberg kritisierte auf der Tagung „Bürgerorientierte Gesundheit in Deutschland“, ohnehin, dass das heutige Gesundheitssystem ökonomisch gesehen ein Krankheitssystem sei. Krankheit steigere das Bruttosozialprodukt, denn solange mit Krankheit und nicht mit Gesundheit Geld verdient werde, könne Prävention wirtschaftlich nicht gewollt sein.
Bahrs Pläne
Für FDP-Gesundheitsminister Daniel Bahr kommt eine gesetzliche Regelung nach wie vor nicht infrage. Seit Längerem schon arbeitet er an einer sogenannten Präventionsstrategie (siehe Kasten), über die bislang wenig bekannt wurde. Medienberichten zufolge will Bahr Ärzten ein Extrahonorar dafür bereitstellen, wenn sie Patienten auf Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, sie über Präventionsmaßnahmen beraten und gegebenenfalls auch derartige Angebote vermitteln.
Während Kritiker dem Gesundheitsminister Klientel-Politik vorwerfen, kann sich Bahr des Beifalls und der Unterstützung der Ärzteschaft sicher sein: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ließ bereits im Frühjahr wissen, begleitende Konzepte in der Schublade zu haben, bei denen die Ärzte eine zentrale Rolle spielen sollen. Der KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Köhler will dabei Mediziner als Präventionslotsen stärken, sie „wüssten schließlich am besten, woran es den Patienten fehle“, hieß es. Ein Präventionsmanagement sei wichtig: Zwei Drittel aller ambulanten Arztkontakte entfielen auf chronisch kranke Menschen.
Bekannt wurde auch, dass Bahr einen nationalen Krebsplan umsetzen möchte. Dieser verfolge ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen verschiedener Akteure bei der Krebsbekämpfung. Bahr möchte dabei auch die Krebsregister fördern, in denen die Krankheitsfälle dokumentiert werden und anhand derer sich die Qualität der Behandlung überprüfen lässt – aber kein einheitliches Register schaffen. Kritik an seinen Plänen kommt unter anderem von der AOK: Der bestehende Flickenteppich von 46 Registern müsse abgelöst werden durch eine Stelle, die für aussagefähige, länderübergreifende, transparente und frei zugängliche Daten sorge, so der AOK-Bundesverband.
Absichten der Union
Demgegenüber wollen Gesundheitspolitiker aus der Union einen anderen Weg einschlagen. In einem Eckpunktepapier legten sie Mitte des Jahres ein Konzept vor, das sich wesentlich von Bahrs Plänen abgrenzt. In dem Entwurf heißt es: „Die Aktivierung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung in allen gesellschaftlichen Schichten ist primäres Ziel. Dies wollen wir mit einer nationalen Präventionsstrategie erreichen. Ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik hin zu einer stärkeren Betonung von Prävention und Gesundheitsförderung wird nur dann erreicht werden können, wenn Prävention und Gesundheits- förderung im deutschen Gesundheitswesen neben Kuration und Rehabili- tation gleichwertig und verbindlich geregelt werden.“
Vorwiegend die Gesundheitsvorsorge in den Betrieben und ein „Aktionsplan Prävention und Ernährung“ sollen dabei im Fokus stehen. Ziel: Volkskrankheiten wie Burn-out, Diabetes und Herz-Kreislauf-Schwächen sollen angegangen werden, die Arbeitskraft der Beschäftigten soll damit so lange wie möglich aufrechterhalten werden.
Dies aus gutem Grund: „Nirgendwo tritt das wirtschaftliche Potenzial von Prävention deutlicher zutage als im Erwerbsleben“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK, Dr. Rolf-Ulrich Schlenker. Die Barmer richtete im Oktober dieses Jahres einen Kongress zum Thema „Arbeitsleben und Prävention“ aus. Tenor: Bald schon wird jeder dritte Arbeitnehmer über 50 Jahre alt sein. Zwar seien die ältesten Arbeitnehmer durchschnittlich nur halb so oft krank wie die jüngsten, dafür aber mehr als viermal so lang.
In ihrem Entwurf geht es den CDU/CSU-Gesundheitsexperten auch darum, den Kassen mehr Geld für ihre Versicherten zur Verfügung zu stellen: Insgesamt 400 Millionen Euro mehr sollen die Versicherer pro Jahr für die Prävention bekommen.
Der Präventionsrat
Im Zentrum des Papiers steht ein sogenannter, zu bildender Präventionsrat. Dieses Gremium soll für die Umsetzung festgelegter Präventionsmaßnahmen verantwortlich sein. Der Bundestag soll zuvor konkrete Ziele bestimmen, etwa eine zahlgenaue Senkung von Diabetes-Erkrankungen.
Der Plan scheint ernst zu sein. „Wir brauchen einen nationalen Präventionsrat, der die einzelnen Maßnahmen dauerhaft koordiniert“, sagte etwa der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Johannes Singhammer. „Denkbar wäre, die Prävention mit Mitteln aus dem Gesundheitsfonds zu fördern“, so Singhammer. Der Präventionsrat solle einzelne Aktionen verschiedener Akteure bündeln und dauerhaft koordinieren, einzelne Maßnahmen hätten nur wenig Wirkung. Singhammer. „Die Präventionsausgaben von heute sind eine Investition in die Zukunft.“
Knackpunkt an den Vorstellungen von CDU/CSU: Die Pläne lassen sich nur schlecht ohne gesetzliche Grundlage umsetzen. Dies ist den Konservativen durchaus bewusst. „Damit Prävention verbindlicher wird, wird es ganz ohne gesetzliche Regelungen nicht gehen“, so der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn. Die „Ärzte Zeitung“ (ÄZ) mutmaßt, dass damit auch die Union „nicht weniger fordert, als dass die Säule Prävention gleich- berechtigt neben denen von Kuration und Rehabilitation“ installiert werden soll.
Doch in der Union scheint man sich da noch nicht ganz einig zu sein: „Wir brauchen kein Präventionsgesetz“, so der stellvertretende Fraktionschef Singhammer. Der Paradigmenwechsel hin zu einer präventiven Ausrichtung des Gesundheitswesens könne auch mit den vorhandenen Instrumenten gelingen.
Forderung nach gesetzlicher Regelung
Unterdessen fordern neben der SPD auch zahlreiche Verbände aus dem Gesundheitsbereich eine gesetzliche Regelung. So erneuerte etwa der Wohlfahrtsverband „DER PARITÄTISCHE“ erst im August 2012 seine Forderung nach einem eigenen Bundes- gesetz für nicht-medizinische Primär- prävention und Gesundheitsförderung, um bereits erprobte Ansätze zu verstetigen und flächendeckend umzusetzen. „Wir brauchen mehr als Aufklärungs- und Informationskampagnen oder die medizinische Verhinderung von Krankheit durch Impfungen. Wir brauchen zielgruppenspezifische Maßnahmen, die dort ansetzen, wo die Menschen sind“, so der Verbandsvorsitzende Prof. Dr. Rolf Rosenbrock. Dies sei nicht zuletzt ein Gebot ökonomischer Vernunft. „Jeder Euro, den wir heute in wirkungs- volle Prävention investieren, zahlt sich auch finanziell langfristig aus durch eine Entlastung der Sozialsysteme. Jeder Tag, den wir weiter warten, ist volkswirtschaft-lich betrachtet, vergeudetes Geld“, so der Gesundheitsökonom. Es gebe kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsdefizit: „Der Minister ist in der Bringschuld.“
Mini-Ausgaben für Vorsorge in der GKV
Indes: Bekundungen von Gesundheits- politikern sind das eine, die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache: Zwar haben die Ausgaben für die Primär-prävention in den vergangenen zehn Jahren in der Gesetzlichen Krankenversicherung zugelegt. Dennoch sind sie im Vergleich zu anderen Ausgabenposten verschwindend gering (siehe Tabelle). Aus dem Präventionsbericht 2011 der Gesetzlichen Krankenkassen geht hervor, dass die Kassen insgesamt für Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung nur etwas über 300 Millionen Euro ausgegeben haben.
Kein Wunder also, dass die „Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten“ (DGVP) scharfe Kritik an den mageren Ausgaben für Prävention übt. Gerade sie sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte deren Verbandspräsident Wolfram-Armin Candidus. Eine gesundheitsbewusste Lebensführung könne solche Krankheiten verhindern oder verzögern.
Doch genau dies ist eine ewige Streitfrage im Gesundheitsbereich: Was bringen die Ausgaben für Prävention – gesundheits- politisch und volkswirtschaftlich gesehen? Noch mussten sich die Präventionsinitia- tiven der Vergangenheit von „Trimm Dich“ bis „Gib Aids keine Chance“ keinen Kosten-Nutzen-Analysen stellen, schreibt die Ärzte-Zeitung.
Effizienz wissenschaftlich nicht belegt
Auch die derzeitige Regierung bemängelt in einer Antwort auf eine Anfrage von SPD-Abgeordneten, dass es keine „adäquaten wissenschaftlich-methodischen Instrumente zur Durchführung von Kosten-Nutzen-Analysen“ gebe. Deswegen wolle sie verstärkt auf ökonomische Analysen setzen.
Welche gesamtwirtschaftlichen Kosten und individuellen Folgen es hätte, wenn Prävention ganz eingestellt werden würde, vermag niemand zu sagen. Skeptiker wie der Kieler Gesundheitsökonom Prof. Dr. Fritz Beske räumen zwar gerne ein, dass Investitionen in die Gesundheit im Einzelfall dazu beitragen, spätere Behandlungen zu minimieren oder erst gar nicht notwendig werden zu lassen. Doch allzu altruistisch ginge es im Gesundheitswesen teilweise nicht zu, so Beske. Deshalb könne man auch fragen: Wem nützt Prävention? Vorteilhaft könne sie sich somit nicht nur im Einzelfall auf den Patienten auswirken, sondern auch und vor allem auf den zweiten Gesundheitsmarkt – und hier besonders der Pharma- industrie und den Apotheken dienen.
Gesund Leben bleibt oft nur Vorsatz
Unterstützung findet diese These etwa durch eine aktuelle Umfrage von Bertelsmann und Barmer GEK: Sie förderte zutage, dass ein gesundes Leben für viele häufig ein guter Vorsatz bleibt. Demnach würden gesundheitsrelevante Faktoren wie ausreichende Bewegung, ausgewogene Ernährung oder regelmäßiger Stressabbau von 75 bis 92 Prozent der Befragten als „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“ eingestuft. Aber offenbar führe diese Einschätzung häufig nicht zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise. Denn rund 40 bis 60 Prozent der Befragten gaben gleichzeitig an, dass sie diese Gesundheitsaspekte nur zum Teil oder nicht konsequent in ihrem Alltag berücksichtigen. Gar ein Drittel gestand ein, mindestens einmal pro Woche bewusst gegen ihre gesundheitlichen Interessen zu verstoßen.
Zwar waren laut Umfrage viele bereit, Produkte und Dienstleistungen für die Gesundheit selbst zu bezahlen. Doch häufig würden gesundheitsbezogene Produkte und Dienstleistungen eingekauft, deren Nutzen nicht nachgewiesen sei. So werde die Rangliste der beliebtesten Gesundheitsprodukte von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und Mineralien angeführt.
Wohl auch deshalb fordert der Verbandspräsident des DGVP, Wolfram-Armin Candidus, dass gesundheits- bewusstes Verhalten immer wieder geübt und verfestigt werden müsse. „Prävention ist für den Staat, die Gesellschaft und die einzelnen Bürger eine Daueraufgabe. Wer hier spart, spart am falschen Ende.“
Kriterium Lebensumfeld
Experten wie Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Schwartz sind sich einig: Prävention kann nur dann wirksam sein, wenn mit Aufklärung, Maßnahmen und deren Umsetzung möglichst viele Menschen direkt erreicht werden. Diese Ansicht vertrat der Gesundheitsökonom auf der genannten Tagung „Bürgerorientierte Gesundheit“. Für erfolgreiche Prävention spielten gesundheits- förderliche Ansätze im direkten Lebens- umfeld (sogenannte „Settings“), die die sozialen und materiellen Rahmenbedingungen für Gesundheitsverhalten beeinflussen, eine Schlüsselrolle, so Schwartz. Als Settings ließen sich etwa Gemeinden, Familien, Kindergärten, Schulen, Sportvereine, Betriebe, Senioreneinrichtungen definieren. Für eine stärker an gesundheitsbezogenen Zielen und Ergebnissen orientierte Gesundheits-politik forderte er eine kontinuierliche Übersicht über die vielfältigen Aktivitäten und sie, wo sinnvoll, zusammenzuführen. Institutionen und Akteure trügen bereits in vielen Bereichen dazu bei, Prävention und Gesundheitsförderung umzusetzen und zu verbreiten. Viele Einzelaktivitäten und Programmansätze seien aber kleinteilig und oft auch nicht nachhaltig angelegt. Zudem vermisse man bei vielen einzelnen Projekten die Ausrichtung auf gemeinsame Leitideen und bewährte, extern evaluierte Erfolgskriterien. Durch Vernetzung und Koordination der Einzelangebote könne die Prävention nur profitieren.
Grenzen der Prävention
Wundermittel Prävention? Mitnichten. Immer wieder wird auch diskutiert, wo die Vorsorge an ihre Grenzen stößt und wo Vorsorge sogar unsinnig ist. So monierte der Leiter des „Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen“ (IQWiG) in Köln, Jürgen Windeler, gegenüber der „Rheinischen Post“ die unzureichende Information, welche Vorsorge- und Früherkennungsprogramme wertvoll und welche man vernachlässigen könne. Windeler: „Vorsorge ist nicht immer sinnvoll.“
Zwar sei die Idee der Prävention, dass man durch Früherkennung „etwas Besseres tun kann, als wenn man etwas spät erkennt“. Dies sei aber keineswegs immer so. Studien hätten gezeigt, dass etwa bei Lungen- oder Eier- stockkrebs Früherkennungsuntersuchungen nicht empfohlen werden könnten, weil Menschen, deren Tumor früh entdeckt wurde, später nicht besser, sondern teilweise schlechter gestellt waren. Das sei bei der Früh- erkennung von Darm- oder Gebärmutterhalskrebs anders. „Da sterben weniger Menschen, wenn der Tumor früh erkannt wird.“
Insgesamt sei Früherkennung in ihrem Für und Wider eine sehr schwierige Angelegenheit. So finde man etwa bei Ganzkörper-Untersuchungen – von der Strahlenbelastung beim CT abgesehen – immer eine hohe Zahl anatomischer Normabweichungen oder sogar pathologischer Befunde, von denen viele Ärzte gar nicht bestimmen könnten, ob eine Krankheit vorliege oder nicht. Windeler: „Von 100 Personen, die in ein MRT oder CT hineingehen, kommen 40 bis 50 mit auffälligen Befunden heraus, ohne dass jemand sagen könnte, was diese Befunde bedeuten. Untersuchungen, die als Prä- vention verkauft werden und ungeklärte Diagnosen liefern, sind eigentlich verantwortungslos“, so der IQWiG-Leiter. Letztlich sei ein Check-up-Test ein trojanisches Pferd, das einem möglicherweise etwas einbrocke, mit dem nicht zu rechnen war, fasst er seine Ansichten zusammen.
INFO
Der Begriff der Prävention ist ein Oberbegriff für zeitlich unterschiedliche Maßnahmen zur gesundheitlichen Vorsorge. Unterschieden werden drei Stufen: Mit der primären Prävention soll die Entstehung von Krankheiten verhindert werden. Die sekundäre Prävention oder Früherkennung will Krankheiten frühzeitig erkennen, damit möglichst rasch eine Therapie einge-leitet werden kann. Mit der tertiären Prävention sollen Krankheitsfolgen gemildert, ein Rückfall bei schon entstandenen Krankheiten vermieden und ihre Verschlimmerung verhindert werden.
Quelle BMG+ÄZ
INFO
Die Koalition plant, ressortübergreifend das Thema Alterung der Gesellschaft anzugehen. Im Rahmen verschiedener Maßnahmen, die die Demografie betreffen, soll der Prävention dabei ein großer Stellenwert zugemessen werden (Präventionsstrategie). Dazu hat auch Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan mit dem Gesundheitsministerium ein Rahmenprogramm zur Gesundheitsforschung aufgelegt. Schwerpunkt des Programms sollen Prävention, Diagnose und Behandlung von Volkskrankheiten sein.
INFO
2005 beschließt der Bundestag unter der rot-grünen Regierung ein Präventions- gesetz. Allerdings lehnt der Bundesrat das Gesetz ab. Nachdem es in den Vermittlungsausschuss verwiesen wurde, legt dieser das Gesetz auf Eis. Auch die Große Koalition wird sich 2006/2007 über ein Gesetz nicht einig: Die CDU wehrt sich gegen die SPD-Vorstellungen; die Bundesländer haben überdies unterschiedliche Ansichten über die Finanzierung.
Eine gesetzliche Verankerung des Themas haben Union und FDP im Koalitionsvertrag 2009 ausdrücklich ausgeschlossen.
INFO
Die Untersuchung von Brustkrebs gilt als am besten installierte Vorsorgemaßnahme – und steht gleichwohl in der Kritik: Zum einen sind sich viele Experten einig, dass bei früher Erkennung weniger Frauen an Brustkrebs sterben. Andererseits gibt es das Problem der Übertherapie: Frauen, die aus einem festgestellten Knoten in der Brust keinen Krebs bekommen würden, werden trotzdem aggressiv behandelt. Das Problem der Übertherapie gibt es auch bei Haut- und Prostata-Karzinom.