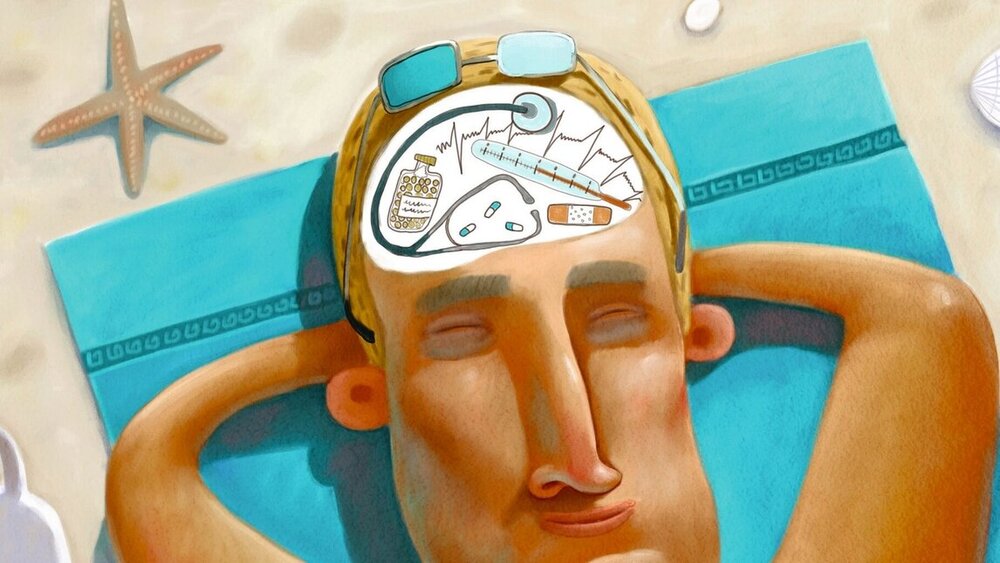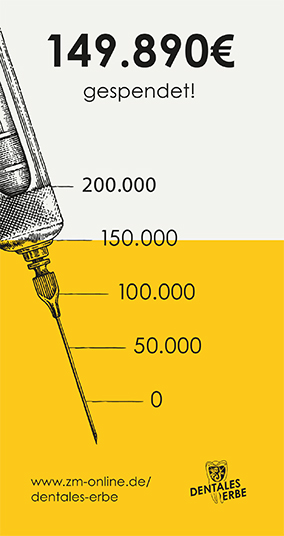Wie der Beruf Zahnärztinnen und Zahnärzte in Kanada krank macht
Die psychische Belastung von Zahnärztinnen und Zahnärzten wird in der internationalen Fachliteratur zunehmend als relevantes Thema diskutiert. Eine aktuelle Untersuchung aus Kanada liefert Erkenntnisse, die auch für die zahnmedizinische Praxis in Deutschland von Bedeutung sein können. Die Studie zeigt, dass ein erheblicher Anteil der Zahnärztinnen und Zahnärzte unter psychischen Gesundheitsproblemen leidet, darunter depressive Symptome, Ängsten sowie Burn-out.
Insgesamt nahmen 397 Zahnärztinnen und Zahnärzte an der Umfrage teil. Rekrutiert wurden sie über direkte Einladungen und öffentliche Aufrufe, etwa in sozialen Medien. Die Ergebnisse zeigen, dass rund 44 Prozent der Befragten unter psychischen Belastungen leiden. Besonders betroffen sind demnach Frauen, bei denen jede zweite psychische Probleme angab, während es bei den Männern nur 37 Prozent waren.
Wenig Raum für Entscheidungen versus Probleme in der Praxisführung
Zu den wesentlichen beruflichen Belastungsfaktoren zählen Arbeitsüberlastung, eingeschränkte Entscheidungsspielräume bei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Schwierigkeiten in der Praxisführung und Konflikte mit dem Praxismanagement bei Praxisinhaberinnen und -inhabern. Ein wiederkehrendes Thema waren die überhöhten und teilweise unrealistischen Erwartungen der Patientinnen und Patienten.
Weiterhin gaben viele Zahnärztinnen und Zahnärzte an, dass Patientinnen und Patienten, deren Behandlung durch staatliche Programme finanziert wird, einen großen Teil ihrer Arbeitszeit beanspruchen, während die Vergütung vergleichsweise niedrig sei. Diese Klientel würde von den Zahnärztinnen und Zahnärzten teils nur ungern behandelt, doch fühlten sich die Befragten aus ethischen Gründen dazu verpflichtet.
Auch der Umsatzdruck wurde wiederholt thematisiert, häufig ausgeübt durch die Praxisinhaberinnen und -inhaber. Genannt wurden unrealistische Umsatzziele sowie der Druck, Patientinnen und Patienten Behandlungen zu empfehlen, die finanziell vorteilhafter seien. Bei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten zählten zusätzlich Konflikte mit Praxisinhaberinnen, Mobbing und eingeschränkte Autonomie bei der Gestaltung der Arbeitszeiten zu den Stressfaktoren.
„Die größte Herausforderung für mich bei der Arbeit ist die Führung meiner Mitarbeiter.“
Qualitative Angabe eines Befragten
Aus Sicht der Praxisinhaberinnen und -inhaber ist der finanzielle Druck ein weiterer belastender Faktor. Einige der Befragten hoben hervor, dass die wirtschaftlichen Anforderungen in der Praxis extrem hoch sind.
Enorme laufende Kosten und ein erheblicher Anteil der Einnahmen, der allein für den Betrieb aufgewendet werden muss, machten die Praxisführung zu einer großen Herausforderung – selbst bei optimaler Auslastung. Administrative Aufgaben sowie die Gewinnung von qualifiziertem Personal erschwerten den Praxisalltag zusätzlich: 48,5 Prozent der Befragten benannten verschiedene Aufgaben der Praxisverwaltung als starken Stressfaktor.
„Man ist nicht nur Gesundheitsdienstleister, sondern auch Unternehmer. Es ist nicht leicht, hier die richtige Balance zu finden, und der Zeitaufwand ist enorm.“
Qualitative Angabe einer Befragten
Die Studie zeigt deutlich, dass die Geschlechtsidentität von Zahnärztinnen und Zahnärzten eine zentrale Rolle für das psychische Belastungserleben spielt. Frauen wiesen grundsätzlich eine höhere Belastungsquote auf als Männer. Diese erhöhte Vulnerabilität hängt sowohl mit strukturellen Faktoren als auch mit berufsspezifischen Gegebenheiten zusammen.
Als Gründe wurden Doppelbelastungen durch familiäre Aufgaben genannt, etwa Stress im Zusammenhang mit Kinderbetreuung. Darüber hinaus berichteten Praxisinhaberinnen, dass sie sich bei Mitarbeitenden in manchen Fällen schwerer durchsetzen konnten, was zu Unzufriedenheit bei den Zahnärztinnen und zu einem höheren empfundenen Stresslevel führte. Auch iauf der Arbeit empfanden viele Zahnärztinnen die Belastung im Vergleich zu männlichen Kollegen als höher.
Zahnärztinnen und Zahnärzte in Einzelpraxen oder ländlichen Regionen berichteten zudem teilweise über soziale Isolation. Auch in Gemeinschaftspraxen äußerten einige Befragte das Gefühl des Alleinseins, insbesondere in schwierigen Behandlungssituationen, in denen kein unmittelbarer Ansprechpartner verfügbar war.
Zahnärzte auf dem Land fühlen sich oft alleine
Viele der Befragten wünschen sich eine Entstigmatisierung psychischer Probleme. Einige schlugen vor, dass „zahnmedizinische Fakultäten die Konzepte der psychischen Gesundheit, Bewältigungsstrategien und Stressbewältigungsfähigkeiten in den Lehrplan aufnehmen sollten“ sowie „eine stärkere Einbindung der zahnmedizinischen Fakultäten in die Vorbereitung der Studierenden auf die Realität der Praxisführung und die damit verbundenen Belastungen“.
Einige, besonders Frauen, gaben an, dass für sie der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in Gemeinschaften oder Netzwerken hilfreich wäre, etwa über WhatsApp-Gruppen oder berufliche Organisationen und Verbände. Auch ein Mentoringprogramm für frisch approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte könnte eine wertvolle Unterstützung bieten.
Als Limitationen dieser Studie werden selbstberichtete Daten, die lokale Begrenzung auf Kanada und die potenzielle Verzerrung durch die Freiwilligkeit der Befragung angeführt. Dennoch liefert die Studie nach Ansicht der Autoren wichtige Einblicke in die psychische Gesundheit von Zahnärztinnen und Zahnärzten und unterstreicht die Notwendigkeit, strukturelle und geschlechtsspezifische Belastungsfaktoren zu berücksichtigen.
Die Untersuchung untermauert die Bedeutung von Unterstützungsangeboten auf mehreren Ebenen. Für die Praxis bedeutet dies: Eine bewusste Auseinandersetzung mit den Belastungen des Berufs, die Implementierung unterstützender Strukturen, ein offener Austausch über psychische Gesundheit und Integration des Themas psychische Gesundheit bereits im Studium könnten sowohl das Wohlbefinden der Fachkräfte als auch die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig verbessern.
Gleichzeitig zeige die Studie, dass weitere Forschung notwendig ist – insbesondere zu unterschiedlichen Gender-Identitäten, zur Wirksamkeit bestehender Unterstützungsprogramme und zu Maßnahmen, die gezielt weibliche Zahnärztinnen stärken.
Maragha T, Atanackovic J, Adams T et al. Dentists' Mental Health: Challenges, Supports, and Promising Practices. JDR Clin Trans Res. 2025 Apr;10(2):100-111. doi: 10.1177/23800844241271664. Epub 2024 Sep 20. PMID: 39301941; PMCID: PMC11894879.