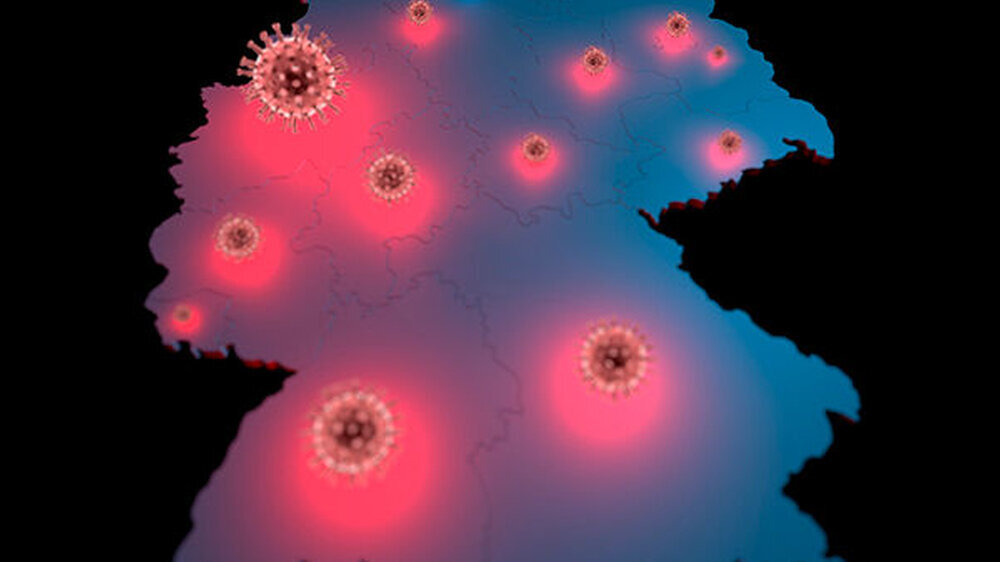"Länderspezifische Belastungsgrenze ist entscheidend"
Für das Zi sind die von der Bund-Länder-Konferenz zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie kürzlich festgelegten Maßnahmen nicht spezifisch genug. Bund und Länder hatten am 6. Mai 2020 beschlossen, dass eine Obergrenze von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen zu konsequenten Beschränkungen führen muss. Hinzu kommt die täglich aktualisierte Reproduktionszahl.
Ein stärkerer Regionalbezug ist zielführender
Für das Zi wäre aber ein stärkerer Regionalbezug zielführender. Um die Ausbreitung des Coronavirus besser länderspezifisch beobachten zu können, schlägt das Institut jetzt ein eigenes Modell vor, das auf zwei Kennzahlen beruht:
einer länderspezifischen Belastungsgrenze des Gesundheitswesens bei Intensivmedizin,
und eine sich daraus bei steigenden Fallzahlen ergebende Vorwarnzeit bis zum Erreichen dieser Belastungsgrenze.
„Diese Kennzahlen sollen helfen, die Dringlichkeit weitergehender Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu bewerten und gegenüber Grundrechtseinschränkungen abzuwägen“, erklärt der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried.
Die Belastungsgrenze leitet das Zi ab aus den für die Versorgung von COVID-19-Patienten verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungsplätzen (25 Prozent aller registrierten Intensivplätze), dem Anteil von intensivmedizinisch behandlungspflichtigen Patienten an allen gemeldeten Infektionsfällen (fünf Prozent) und der mittleren Behandlungsdauer der Patienten auf Intensivstationen (10 Tage).
Wie das Zi anführt, standen laut Register der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am 7. Mai 2020 insgesamt 32.828 Intensivbetten in Deutschland zur Verfügung. Somit liegt die rechnerische Belastungsgrenze des Gesundheitswesens an diesem Tag bei 16.414 täglichen Neuinfektionen bundesweit. Die von Bund und Ländern fixierte Interventionsgrenze liegt bei 5.930 täglichen Neuinfektionen (36 Prozent der rechnerischen Belastungsgrenze).
Die länderspezifische Belastungsgrenze ist entscheidend
Das Zi argumentiert so: Je mehr die länderspezifische Belastungsgrenze durch die Interventionsgrenze ausgeschöpft ist (zum Beispiel in Baden-Württemberg bei 42,2 Prozent gegenüber dem Saarland bei 20,2 Prozent), desto kürzer ist folglich die verbleibende Zeit bis zur Belastungsgrenze - bezogen auf die im jeweiligen Bundesland verfügbaren intensivmedizinischen Ressourcen.
Das Zi rechnet nun vor: Wenn man pauschal Zeitverluste bis zum Wirksamwerden von Maßnahmen unter der Annahme berücksichtigen würde, dass sich die Vorwarnzeit hierdurch um 21 Tage verkürzt, betrüge die verbleibende Zeit in einigen Bundesländern zwei bis drei Wochen, in anderen jedoch nur noch ein bis drei Tage.
Es braucht klare, epidemiologisch fundierte Grenzwerte
Laut Zi zeigt die Modellbetrachtung des Instituts, dass es notwendig ist, neben der Interventionsgrenze auch die rechnerische Belastungsgrenze und die voraussichtlich verbleibende Zeit bis zum Erreichen dieser Belastungsgrenze zu berücksichtigen. Dies könnte helfen, die Anzahl und die Art der notwendigen Interventionen zu bewerten.
Das Fazit des Instituts: „Um Maßnahmen, die mit tiefgreifenden Einschränkungen für die Bevölkerung einhergehen, abzuwägen, braucht es klare, epidemiologisch fundierte Grenzwerte, die der Politik einen sicheren Kompass beim Pandemie-Management an die Hand gibt, um eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens auszuschließen, wenn die Neuinfektionen wieder ansteigen sollten.“
Mehr zum Thema: COVID-19-Pandemie
Das neu identifizierte Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht die "Corona virus disease 2019" (Covid-19) und ist Auslöser der COVID-19-Pandemie.