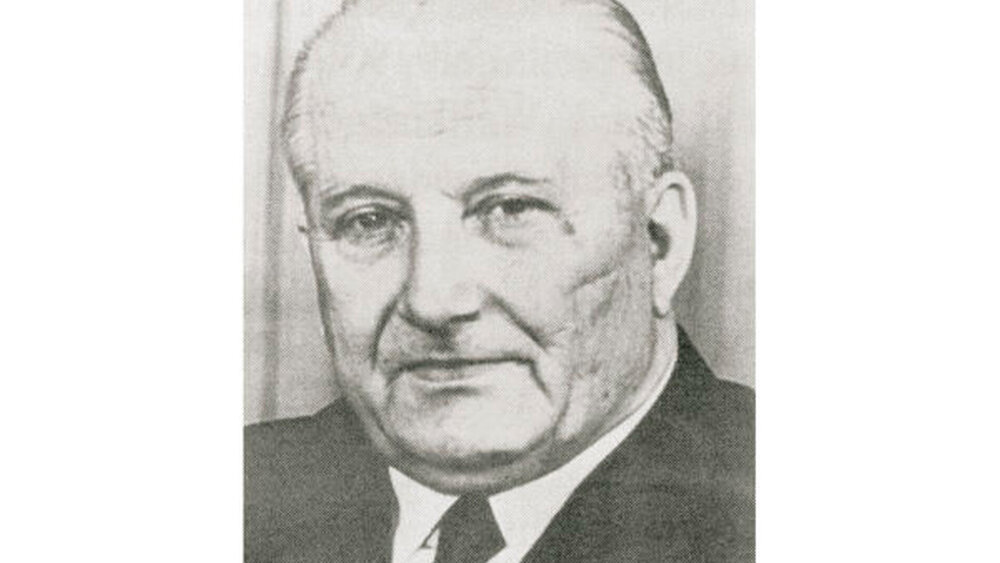Karl Friedrich Schmidhuber – NS-Dozentenführer mit Nachkriegskarriere
Schmidhuber wurde am 21. Februar 1895 in Stuttgart als Sohn eines Schreiners und Betriebsleiters geboren.1 Nach dem Abitur an der Oberrealschule im schwäbischen Esslingen schrieb er sich 1914 für die Studienfächer Medizin und Zahnheilkunde ein. Allerdings musste er seine Ausbildung nach Beginn des Ersten Weltkriegs unterbrechen: Er wurde als Frontsoldat eingesetzt und diente zuletzt als Leutnant d. R. 1918 konnte er dann sein Studium fortsetzen. Im Juni 1921 legte er die ärztliche Prüfung ab und im Januar 1922 erhielt er die ärztliche Approbation. Während er sein Studium in Göttingen und Tübingen absolviert hatte, brachte er die Promotion zum Dr. med. im Januar 1922 in Bonn zum Abschluss.2 Bereits im November 1922 folgten die zahnärztliche Prüfung und die Approbation, wiederum in Bonn. Damit war Schmidhuber mit 26 Jahren bereits doppelapprobiert.
Zunächst wurde er Assistent bei dem Chirurgen Adolf Henle in Dortmund. 1925 wechselte er als planmäßiger Assistent an die Klinik für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten der Universität Bonn zu dem renommierten jüdischen Hochschullehrer Alfred Kantorowicz. 1927 wurde Schmidhuber ebenda zum „Hilfslehrer für Zahnheilkunde“ befördert. Im Dezember 1928 erlangte er die Habilitation3 und nachfolgend die Ernennung zum Privatdozenten und Oberarzt. Mit Wilhelm Balters4 1893–1973, Habilitation 1926) und Gustav Korkhaus5 (1895–1978, Habilitation 1929) verfügte Kantorowicz in jenem Zeitraum noch über zwei weitere habilitierte Mitarbeiter. Als Kantorowicz im Frühjahr 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Staatsdienst entlassen und zeitweise in KZ-Haft überführt wurde, wurde Schmidhuber zum kommissarischen Direktor ernannt. Diese Aufgabe nahm er bis zur Berufung von Erwin Hauberrisser6 im Frühjahr 1934 wahr. Nur ein Jahr später, im April 1935, konnte Schmidhuber dann selbst eine planmäßige außerordentliche Professur an der Universität Heidelberg antreten.
Im Zweiten Weltkrieg übernahm er die Leitung einer Reservelazarett-Abteilung für Kiefer- und Gesichtsverletzte, die in der eigenen Heidelberger Klinik eingerichtet wurde, sowie einer „Außenstelle“ in der nahe gelegenen Wilckensschule. Wenige Monate nach Kriegsbeginn – im Mai 1940 – arrivierte Schmidhuber in Heidelberg zum ordentlichen Professor und Direktor der Universitätsklinik. In dieser Zeit erwirkte er mehrere Vergrößerungsbauten der Zahnklinik sowie einen Ausbau der Bettenstation.
Aus seiner Gesinnung hat er nie einen Hehl gemacht
Ende März 1945 geriet Schmidhuber dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Er wurde unter anderem im Internierten-Krankenhaus Nr. 2 Karlsruhe festgesetzt, wo er bis Februar 1947 zugleich als Lagerarzt tätig war. Erst im Herbst 1947 kam er aus der Haft frei, nachdem er bereits im Oktober 1945 aus dem Hochschuldienst entlassen worden war. Er eröffnete zunächst eine Praxis in Heidelberg. Doch bereits im Oktober 1951 wurde er von der Universität zu Köln wieder zum ordentlichen Professor und Direktor der dortigen Universitätszahnklinik berufen. 1963 erfolgte die offizielle Emeritierung; er blieb jedoch noch bis Juli 1965 als (nunmehr kommissarischer) Klinikleiter im Amt.
Schmidhuber war in erster Ehe (seit 1918) mit Ottilie Schlott (*1898) und in zweiter Ehe (seit 1941) mit Dr. rer. pol. Ilse Dingerdissen (*1910) verheiratet; mit Gisela Rasmus hatte er ein 1961 geborenes außereheliches Kind.7 Er verstarb am 23. August 1967 in Köln.
Wie aber war nun Schmidhubers Verhältnis zum Nationalsozialismus?8 Tatsächlich gehörte er – wie die in dieser Reihe bereits behandelten Professoren Heinrich Fabian9, Fritz Faber10 und Hans Fliege11 – zu den wenigen zahnärztlichen Hochschullehrern mit nachweislicher Waffen-SS-Mitgliedschaft: Er trat am 1.6.1933 der SS bei (Nr. 204.869), wurde 1935 Sturmbannarzt, 1937 Oberscharführer und zuletzt Obersturmbannführer. Seit dem Frühjahr 1933 war er zudem NSDAP-Mitglied (Antrag April 1933, Aufnahme 1.5.1933, Nr. 3.512.460). 1935 trat er dem NS-Studentenbund bei. 1935/36 wurde er in Heidelberg zum Führer des NS-Dozentenbundes sowie im Mai 1937 zum Gaustellenleiter ernannt. 1939 schloss er sich noch dem NS-Ärztebund an – Eckart et al. vermuten nicht ohne Sarkasmus, dass diese späte Mitgliedschaft bei Schmidhuber zunächst „im Beitritts- und Laufbahnabsicherungstrubel ganz in Vergessenheit geraten“12 war.
Schmidhuber gehörte überdies zum Kreis der 38 zahnärztlichen Hochschullehrer, die sich nach Hitlers Machtübernahme zur „Einheitsfront der Zahnärzte“ und zu „völliger Anerkennung einer einheitlichen Führung und des Autoritätsprinzips“ bekannten.13
Schmidhubers Hochschulkarriere nahm nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten rasch Fahrt auf. Wie erwähnt, wurde er schon im Frühjahr 1933 in Bonn nach der Entlassung von Kantorowicz mit der kommissarischen Klinikleitung betraut. Bemerkenswerterweise hatte Kantorowicz selbst Schmidhuber und Balters (nicht aber Korkhaus) als mögliche kommissarische Nachfolger ins Gespräch gebracht, um schlussendlich festzustellen: „Beide Herren dürften politisch auf einem Standpunkte stehen, der etwa dem der deutschnationalen Partei entspricht.“ Schmidhuber genieße jedoch das besondere „Vertrauen der Studentenschaft“ und habe als „Arzt und Zahnarzt“ den „besseren Blick“ für die „Gesamtaufgaben der Fakultät“.14 1950 äußerte sich Kantorowicz im Rahmen eines Gutachtens dann erneut zur damaligen Situation. Dabei führte er aus, dass Schmidhuber bereits vor 1933 „der einzige gewesen war, der, auch als dies keinerlei Vorteile bot, niemals ein Hehl aus seiner weit nach rechts neigenden Gesinnung gemacht hat, die ihm in seiner Studentenzeit und als Kriegsteilnehmer von seiner Umgebung aufgeprägt war. Der Übergang zum Nationalsozialismus war für Schmidhuber [...] kein grosser Schritt.“15
Beim Bewerbungsverfahren um die Professur in Heidelberg hatte Schmidhuber sich unter anderen gegen Erwin Reichenbach16 durchsetzen können, weil man ihn für den „entwicklungsfähigeren“ Bewerber hielt.17 1940 erreichte er dann in Heidelberg mit dem Ordinariat den Höhepunkt der Professorenlaufbahn. Als Leiter des NS-Dozentenbundes nahm er an der Universität Heidelberg zu diesem Zeitpunkt längst eine wichtige Position ein, in der er etwa über die politische Linientreue der Habilitanden befand. So lehnte er etwa 1940 den Habilitationsantrag des Rechtshistorikers Otto Gönnenwein an der Juristischen Fakultät trotz bester fachlicher Beurteilungen ab mit dem Argument, dass die Partei ihn „außerordentlich ungünstig“ beurteile. Tatsächlich gab er sich Gönnenwein gegenüber freundlich und wertschätzend, gelangte jedoch schriftlich zu einem negativen Urteil („Es wäre besser, wenn Sie Ihre Fakultät nicht mit dem Genannten belasten würden“).18 Auch „im Falle des HNO-Dozenten Wirth“ setzte Schmidhuber die „Hetz- und Verdrängungskampagne“ seines Amtsvorgängers fort und verhinderte so dessen „Achtungsaufstieg auf eine ao. Professur“.19 In den meisten Fällen beließ er es allerdings, so das Resümee von Eckart et al., bei den „üblichen Kleindrangsalierungen eines Dozentenschaftsführers“.20
Ein gesundes Gebiss für mehr Wehrfähigkeit
Schmidhubers nationalsozialistische Gesinnung zeigte sich auch bei den von ihm angeleiteten Promotionsthemen, wie Hans Jörg Staehle aktuell herausgearbeitet hat.21 So beschäftigte sich Schmidhubers Doktorandin Johanna Jörger mit der Zulassung von Zahnärzten zu den Krankenkassen und stellte dabei initial fest: „Im nationalsozialistischen Deutschland haben die Fragen der Volksgesundheit und der Gesundheitsführung des deutschen Volkes eine besonders große Bedeutung, denn die Gesundheitsführung bildet einen Teil der Menschenführung. [...] Der Nationalsozialismus kennt keine Wissenschaft um ihrer selbst willen. Alles unterliegt der zwingenden Parole: Was dem deutschen Volke dient, was seine Gesundheit erhält und fördert, ist gut.“ Weiter heißt es dort, die Leistung eines Volkes könne „nur bei Überwachung seines gesamten Lebens, all seiner Lebensäußerungen, seines Tuns und Handelns“ gesteigert werden.22 Einem anderen Doktoranden übergab er das Thema „Die Bedeutung des Gebisses für die Wehrfähigkeit“. Dieser befand 1941, dass „ein gesundes und kaufähiges Gebiß militärisch von größter Bedeutung ist“. Nicht das individuelle Patientenwohl, sondern das „Volksinteresse“ und die Stärkung der „Kampfkraft“ standen im Mittelpunkt des Promotionsprojekts.23
Seine „Erfahrung“ sichert die Nachkriegskarriere
Ende März 1945 wurde Schmidhuber durch die Amerikaner verhaftet und festgesetzt. Aufgrund seiner vielfältigen Funktionen in NS-Organisationen musste er sich einer Entnazifizierung unterziehen.24 Auch an seinem Fall lässt sich – wie bei den bereits vorgestellten Zahnärzten Hermann Euler25, Hermann Pieper26 und Reinhold Ritter27 – die Entwicklung der Spruchkammerverfahren zu „Mitläuferfabriken“28 veranschaulichen: So war er 1946 zunächst als Hauptschuldiger angeklagt worden. Am 25.7.1947 wurde er dann in die Bewährungsgruppe und am 22.7.1948 schließlich in die Gruppe der Mitläufer eingeordnet. Schmidhuber brachte im Verfahren eine „Flut positiver ‚Persilscheine‘“29 bei, die ihm eine ideologische Distanz zum Nationalsozialismus bescheinigten.30
Wie viele ehemalige Nationalsozialisten konnte Schmidhuber seine Hochschulkarriere in der Nachkriegszeit fortsetzen: 1950 zählte er bei der Nachbesetzung des Lehrstuhls und Direktorats der Westdeutschen Kieferklinik in Düsseldorf bereits zum Favoritenkreis – hier fiel die Wahl allerdings letztlich auf Karl Häupl31 . Doch nur kurze Zeit später – im Oktober 1951 – arrivierte Schmidhuber zum ordentlichen Professor an der Universität zu Köln. Bemerkenswert war diese Berufung vor allem deshalb, weil er seit 1932(!) nicht mehr wissenschaftlich publiziert hatte32 – was in Köln durchaus bekannt war. In diesem Punkt weist Schmidhubers Karriere deutliche Parallelen zu dem in dieser Reihe bereits behandelten Kölner Hochschullehrer Wilhelm Gröschel33 auf.
Schmidhubers Nachfolger in Heidelberg, Reinhold Ritter, hatte noch Anfang 1950 auf Schmidhubers fehlende Publikationen hingewiesen und gemutmaßt, dass dieser es schwer haben dürfte, „an eine andere Universität berufen zu werden“.34 Selbst Schmidhubers früherer akademischer Mentor Kantorowicz vermerkte in einer gutachterlichen Stellungnahme im Mai 1951 wahrheitsgemäß, dass dieser kaum publiziert habe. Kantorowicz war erst in der Nachkriegszeit aus seinem Exil in Istanbul zurückgekehrt und notierte: „Ich will jedoch nicht verfehlen, noch einmal zu betonen, dass ich über Schmidhubers wissenschaftliche Leistungen und das Ansehen, das er sich durch diese erworben hat, nicht zu urteilen in der Lage bin. Seitdem ich die deutsche zahnärztliche Literatur verfolge, also seit etwa 5 Jahren, liegen keine wissenschaftlichen Publikationen von ihm vor.“35
Doch die Kölner legten andere Kriterien zugrunde. Zwar nahmen sie zunächst neben Schmidhuber auch die wissenschaftlich überlegenen Mitbewerber und späteren Ordinarien Ewald Harndt36 sowie Martin Herrmann37 in die engere Wahl, entschieden sich schlussendlich jedoch für Ersteren. Sie begründeten dies ausgerechnet mit Schmidhubers reichen Erfahrungen und Aktivitäten als Heidelberger Hochschullehrer in den Jahren bis 1945.38 Ganz reibungslos verlief Schmidhubers Berufung dennoch nicht: Der scheidende Ordinarius der Kölner Zahnklinik, Karl Zilkens39, hatte gemeinsam mit drei weiteren Professoren ein „Sondervotum“ eingereicht, das für die Hausberufung von Zilkens’ Oberarzt Hans von Thiel plädierte – allerdings ohne Erfolg.
Liest man die späteren Laudationes zu Schmidhuber, so fällt auf, dass dessen dürftige Publikationsleistungen dort entweder nicht thematisiert oder aber beschönigt wurden: So stellte einer seiner Schüler 1996 fest, Schmidhuber habe seine Erkenntnisse vor allem „in dem von seinem Lehrer Alfred Kantorowicz herausgegebenen Handbuch niedergelegt“.40 Damit räumte er indirekt ein, dass der Schwerpunkt von Schmidhubers wissenschaftlichem Wirken in der Zeit der Weimarer Republik lag, denn Kantorowiczs Handbuch erschien in den Jahren 1929 bis 1931 und umfasste ohnehin lediglich lexikalische Kurzbeiträge. Auch Elsbeth von Schnizer41 äußerte sich 1955 entschuldigend zu Schmidhubers Publikationsleistungen: „Die verbreitete Weise, eines Menschen wissenschaftlichen Wert danach einzuschätzen, welche Menge an Literatur er von sich gegeben [...] hat, dieser Maßstab wird Schmidhubers Wirken als Hochschullehrer nicht gerecht“.42 Euler wiederum hob in seiner Laudatio stark auf Schmidhubers organisatorische Leitungen ab, indem er die „Ausgestaltung der Kölner Klinik für Zahn- und Kieferkranke“ durch Schmidhuber als dessen eigentliche „Glanzleistung“ herausstellte.43
In der Summe dokumentiert der Fall Schmidhuber auf eindrucksvolle Weise, dass (zumeist im „Dritten Reich“ gewonnene) Leitungserfahrungen bei universitären Berufungen im Nachkriegsdeutschland vielfach stärker wogen als eine politische Distanz zum Nationalsozialismus oder nachweisliche Forschungsleistungen. Vor diesem Hintergrund kann es auch nicht überraschen, dass Schmidhuber 1955 zum Dekan der Heidelberger Medizinischen Fakultät aufstieg – ohne sich zuvor wieder der wissenschaftlichen Arbeit zugewandt zu haben.
Prof. Dr. Dr. Dr. Dominik Groß
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der RWTH Aachen
Universitätsklinikum Aachen, MTI 2 Wendlingweg 2, 52074 Aachen
dgross@ukaachen.de
Fußnoten:
1 Für die folgenden biografischen Ausführungen vgl. (sofern nicht anders ausgewiesen): BArch Berlin PERS 6/15532; Drüll, 2009, 543f.; Euler, 1955, 145–147; Forsbach, 2006, 291–293, 299–302, 333, 338–340; Köhler, 1965, 141f.; Langsch, 1992, 26–28; Schnizer, 1955, 85f.; Voß, 1996, 227–243;
2 Schmidhuber, 1922;
3 Schmidhuber, 1929;
4 Kramp, 1983;
5 Groß, 2018, 43–44;
6 Greiselmayer, 1952, 718;
7 BArch PERS 6/15532; LA NRW, NW 172, Nr. 174;
8 Für die folgenden NS-bezüglichen Ausführungen zu Schmidhuber vgl. (sofern nicht anders ausgewiesen): BArch PERS 6/15532; BArch R 9361-III/180321; BArch R 9361-III/553550; BArch R 9361-VI/2661; BArch R 9361-VIII/20000079; BArch R 9361-IX/38470173; GStA PK, I. HA Rep. 76 Va Sekt. 3 Tit. IV Nr. 39, Bd. 16; LA Baden-Württemberg 465 q, Nr. 34956; LA NRW, NW 172, Nr. 174; StA Düsseldorf, V 42213; UA Bonn, PA 8812; UA Heidelberg, PA 1155 sowie 5677. Für Hintergrundinformationen zum Themenfeld NS-Zahnmedizin vgl. Groß, 2018c, 164–178; Groß, 2019, 157–174; Groß/Krischel, 2020, 24–27; Gross et al., 2018a; Schwanke et al., 2016, 2–39;
9 Groß, 2020a, 72–74;
10 Groß, 2020b, 72–74;
11 Groß, 2020f, im Druck;
12 Eckart/Sellin/Wolgast, 2006, 42;
13 Bitterich/Gross, 2020a, 103–125;
14 UA Bonn, MF 79/183; Forsbach, 2006, 340;
15 LA NRW, NW 172, Nr. 174;
16 Groß, 2020j, im Druck;
17 Langsch, 1992, 27;
18 Schäfer, 2015, 105;
19 Eckart/Sellin/Wolgast, 2006, 43;
20 Ebenda;
21 Staehle, 2020;
22 Jörger, 1939, 5; vgl. hierzu auch Staehle, 2020;
23 Krause, 1941, IX; vgl. hierzu auch Staehle, 2021;
24 LA Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 465 q, Nr. 34956;
25 Staehle/Eckart, 2005, 677–694; Groß, 2018b, 92–93; Groß, 2020e, 66–68;
26 Groß, 2020c, 90–92;
27 Gross et al., 2018b, 285–321; Groß/Schmidt, 2020, 68–70;
28 Niethammer, 1982;
29 Eckart/Sellin/Wolgast, 2006, 46;
30 UA Heidelberg, PA 5677;
31 Groß, 2020g, 95–101; Groß, 2020h, 226–233;
32 Ebendies betont auch Staehle, 2020;
33 Groß, 2020d, 66–68;
34 LA NRW, NW 172, Nr. 174;
35 Ebenda;
36 Groß, 2020i, 131–141;
37 Ritter, 1965, 1–2,
38 LA NRW, NW 172, Nr. 174. Vgl. auch Staehle, 2020;
39 Kraft, 1982;
40 Voß, 1996, 227–243;
41 Türck, 2008, 8–12;
42 Schnizer, 1955, 85–86;
43 Euler, 1955, 145–147.
Literaturliste
1. Bundesarchiv (BArch) Berlin PERS 6/15532
2. Bundesarchiv (BArch) Berlin R 9361-III/180321
3. Bundesarchiv (BArch) Berlin R 9361-III/553550
4. Bundesarchiv (BArch) Berlin R 9361-VI/2661
5. Bundesarchiv (BArch) Berlin R 9361-VIII/20000079
6. Bundesarchiv (BArch) Berlin R 9361-IX/38470173
7. Bitterich/Gross (2020): Lisa Bitterich, Dominik Gross, The signatories of the “Einheitsfront der Zahnärzte” (United Front of Dentists) during the Third Reich and after 1945. An in-depth study, Sudhoffs Archiv 104/1 (2020), 101-132, insb. 103-125, https://doi.org/10.25162/sar-2020-0004
8. Drüll (2009): Dagmar Drüll, Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803-1986, Berlin u.a. 2009, 543-544
9. Eckart/Sellin/Wolgast (2006): Wolfgang U. Eckart, Volker Sellin, Eicke Wolgast (Hrsg.), Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus, Heidelberg 2006
10. Euler (1955): Hermann Euler, Professor Dr. med. Karl Friedrich Schmidhuber zum 60. Geburtstag, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 10 (1955), 145-147
11. Forsbach (2006): Ralf Forsbach, Die Medizinische Fakultät der Universität Bonn im „Dritten Reich“, München 2006, 291-293, 299-302, 333, 338-340
12. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 76 Va Sekt. 3 Tit. IV Nr. 39, Bd. 16
13. Greiselmayer (1952): Helmut Greiselmayer, Professor Dr. Edwin Hauberrisser zum 70. Geburtstag, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 7 (1952), 718
14. Groß (2018a): Dominik Groß, Gustav Korkhaus – 29 Jahre Präsident der DGKFO, Zahnärztliche Mitteilungen 108 (11) (2018), 43-44
15. Groß (2018b): Dominik Groß, Hermann Euler – der enttarnte DGZMK-Präsident, Zahnärztliche Mitteilungen 108 (12) (2018), 92-93
16. Groß (2018c): Dominik Groß: Zahnärzte als Täter. Zwischenergebnisse zur Rolle der Zahnärzte im „Dritten Reich“, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 73 (2018), 164-178
17. Groß (2019): Dominik Groß: Die Geschichte des Zahnarztberufs in Deutschland. Einflussfaktoren – Begleitumstände – Aktuelle Entwicklungen, Berlin 2019
18. Groß (2020a): Dominik Groß, Heinrich Fabian (1889-1970) – Nachkriegskarriere trotz NS-Vergangenheit, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (4) (2020), 72-74
19. Groß (2020b): Dominik Groß, Fritz Faber (1887-1961) – zwischen Universität und Waffen-SS, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (5) (2020), 72-74
20. Groß (2020c): Dominik Groß, Karl Pieper (1886-1951) – Vom NS-Führer zum „Mitläufer“, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (6) (2020), 90-92
21. Groß (2020d): Dominik Groß, Die späte Karriere des Nationalsozialisten Wilhelm Gröschel (1907–1972), Zahnärztliche Mitteilungen 110 (11) (2020), 66-68
22. Groß (2020e): Dominik Groß, Hermann Euler (1878-1961) – Ein Nationalsozialist der leisen Töne, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (15-16) (2020), 66-68
23. Groß (2020f): Dominik Groß, Hans Fliege (1890-1976) – früher Nationalsozialist und Denunziant, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (18) (2020), im Druck
24. Groß (2020g): Dominik Gross, Karl Häupl (1893-1960). His life and works with special consideration of his role in the Third Reich, DZZ International 2 (3) (2020), 95-101, doi.org/10.3238/dzz-int.2020.0095-0101
25. Groß (2020h): Dominik Groß, Karl Häupl (1893-1960) – Leben und Werk unter besonderer
Berücksichtigung seiner Rolle im „Dritten Reich“, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 75 (4) (2020), 226-233, doi.org/10.3238/dzz.2020.0226-0233
26. Groß (2020i): Dominik Gross, A complex case: Ewald Harndt (1901-1996) and his relationship to National Socialism, DZZ International 2 (4) (2020), 131-141, doi.org/10.3238/dzz-int.2020.0131-141
27. Groß (2020j): Dominik Groß, Erwin Reichenbach (1897-1973). Leben und Werk unter besonderer Berücksichtigung seiner politischen Rolle im „Dritten Reich“ und der DDR, Der MKG Chirurg 13 (4) (2020), im Druck
28. Groß/Krischel (2020): Dominik Groß, Matthis Krischel, Zahnärzte als Täter und Verfolgte im „Dritten Reich“. Hintergründe und Erläuterungen zur neuen zm-Reihe, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (1-2) (2020), 24-27
29. Groß/Schmidt (2020): Dominik Groß, Mathias Schmidt, Reinhold Ritter (1903-1987) – Verfechter von Zwangssterilisationen bei Patienten mit LKG-Spalten, Zahnärztliche Mitteilungen 110 (10) (2020), 68-70
30. Gross et al. (2018a): Dominik Gross, Jens Westemeier, Mathias Schmidt, Thorsten Halling, Matthis Krischel (Hrsg.), Zahnärzte und Zahnheilkunde im „Dritten Reich“. Eine Bestandsaufnahme, Berlin 2018
31. Gross et al. (2018b): Dominik Gross, Jens Westemeier, Mathias Schmidt, „Die Grundfarbe der Geschichte ist grau“. Reinhold Ritter (1903-1987) und seine Rezeption vor und nach 1945, in: Dominik Gross, Jens Westemeier, Mathias Schmidt, Thorsten Halling, Matthis Krischel (Hrsg.), Zahnärzte und Zahnheilkunde im „Dritten Reich“. Eine Bestandsaufnahme, Berlin 2018, 285-321
32. Jörger (1939): Johanna Jörger, Zeitgemäße Betrachtung der „Verordnung über die Zulassung von Zahnärzten und Dentisten zur Tätigkeit bei den Kassen“, Diss. Med. Fak. Heidelberg 1939
33. Köhler (1965): Josef Andreas Köhler, Professor Dr. Med. Karl Friedrich Schmidhuber. Zum 70. Geburtstag Am 21. Februar 1965, Zahnärztl. Welt Zahnärztl. Reform ZWR 66 (1965), 141-142
34. Kraft (1982): Horst Kraft, Karl Zilkens (1876-1967) und die Kölner Zahnklinik, Diss. Med. Fak. Köln 1982
35. Kramp (1983): Martin Kamp, Wilhelm Balters (1893-1973). Leben, Werk und Wirken unter besonderer Berücksichtigung zahnmedizinisch-psychologischer Aspekte, Diss. Med. Fak. Mainz 1983
36. Krause (1941): Ernst-Günther Krause, Die Bedeutung des Gebisses für die Wehrfähigkeit, Diss. Med. Fak. Heidelberg 1941
37. Landesarchiv (LA) Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe 465 q, Nr. 34956 (Entnazifizierungsakte Karl Friedrich Schmidhuber)
38. Landesarchiv (LA) Nordrhein-Westfalen, NW 172, Nr. 174 (Personalakte Karl Friedrich Schmidhuber)
39. Langsch (1992): Karin Langsch, Die Etablierung der Zahnmedizin an der Universität Heidelberg seit 1895, Diss. Med. Fak. Heidelberg 1992, 26-28
40. Niethammer (1982): Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, 2. Aufl., Bonn 1982
41. Ritter (1965): Reinhold Ritter, Martin Herrmann zum 70. Geburtstag am 8. Februar 1965, Deutsche Zahn-Mund- und Kieferheilkunde 44 (1-2) (1965), 1-2
42. Schäfer (2015): Joachim Schäfer, „Es wäre besser, wenn Sie Ihre Fakultät nicht mit dem Genannten belasten würden“ – Die NSDAP verhindert die Habilitation des Rechtshistorikers Otto Gönnenwein an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, in: Heidelberger Geschichtsverein: Heidelberg – Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 2016, Heidelberg 2015, 105-128
43. Schmidhuber (1922): Karl Friedrich Schmidhuber, Ueber den Befund von Askariden in den Gallenwegen und dessen Diagnose, Diss. Med. Fak. Bonn 1922
44. Schmidhuber (1929): Karl Friedrich Schmidhuber, Experimentelle Untersuchungen über den Anteil der Zähne und des Kiefergelenkköpfchens am Längenwachstum des Unterkiefers des Hundes (Habilitationsschrift), Bonn 1929
45. Schnizer (1955): Elsbeth von Schnizer, Prof. Dr. med. Karl Friedrich Schmidhuber zum 60. Geburtstag am 21. Februar 1955, Zahnärztliche Welt 10 (4) (1955), 85-86
46. Schwanke et al. (2016): Enno Schwanke, Matthis Krischel, Dominik Groß, Zahnärzte und Dentisten im Nationalsozialismus: Forschungsstand und aktuelle Forschungsfragen, Medizinhistorisches Journal 51 (2016), 2-39, https://www.jstor.org/stable/24895839
47. Stadtarchiv (StA) Düsseldorf, V 42213 (Personalakte Karl Häupl)
48. Staehle (2020): Hans Jörg Staehle, Erfolge und Rückschläge der universitären Zahnmedizin in Deutschland. Anekdotische Darstellung am Beispiel der 125-jährigen Geschichte Heidelbergs, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 75 (2020), im Druck
49. Staehle/Eckart (2005): Hans Jörg Staehle, Wolfang U. Eckart, Hermann Euler als Repräsentant der zahnärztlichen Wissenschaft während der NS-Zeit, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 60 (2005), 677-694
50. Türck (2008): Verena Türck, Weibliche Lehrkräfte in den Personal- und Vorlesungsverzeichnissen der Universität Heidelberg von 1900 bis 1945, in: Susan Richter (Hrsg.), Wissenschaft als weiblicher Beruf? Die ersten Frauen in Forschung und Lehre an der Universität Heidelberg, Heidelberg 2008, 8-12
51. Universitätsarchiv (UA) Bonn, PA 8812 (Personalakte Karl Friedrich Schmidhuber)
52. Universitätsarchiv (UA) Bonn, MF 79/183
53. Universitätsarchiv (UA) Heidelberg, PA 1155 sowie 5677 (Personalakte Karl Friedrich Schmidhuber)
54. Voß (1996): Rudolf Voß, Die Geschichte der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und der Universität zu Köln, Deutscher Zahnärzte-Kalender 55 (1996), 227-243