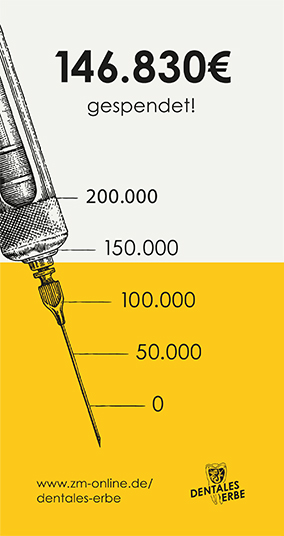Vorsorge mit Fragezeichen
Zuerst hieß es „2003“. Dann: „bis Ende 2005“. Und jetzt sieht es so aus, als wäre das Ziel erst 2007 erreicht. Wer die Einführung der Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs mitverfolgt, hat inzwischen aufgehört, die Terminplanungen allzu ernst zu nehmen. Denn das Projekt, etwa zehn Millionen Frauen alle zwei Jahre eine kostenlose Röntgenuntersuchung der Brust zukommen zu lassen, entpuppt sich im zersplitterten deutschen Gesundheitswesen als deutlich schwieriger als gedacht. An mangelndem Druck von außen liegt es nicht. Bereits im Juni 2002 hatte der deutsche Bundestag beschlossen, Frauen zwischen 50 und 69 kostenlose Röntgenuntersuchungen zur Früherkennung von Brustkrebs anzubieten. Innerhalb von 18 Monaten sollten Ärzte und Krankenkassen das Angebot einführen, sonst wollten die Parlamentarier sie per Gesetz dazu zwingen. Weil die Frist von vorneherein illusorisch war, haben Ärzte und Krankenkassen das Tempo mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung etwas gedrosselt: Bis Ende 2005 sollte das Früherkennungsprogramm „flächendeckend“ eingeführt sein. Doch auch dieser Termin ist nicht zu halten. Von der Umsetzung „sind wir leider weit entfernt“, sagt Hilde Schulte, Bundesvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs. Ziel ist, in den 16 Bundesländern 86 so genannte Screening-Einheiten aufzubauen. „Bis zum Jahresende werden voraussichtlich zehn der Einheiten gestartet sein oder an den Start gehen“, schätzt Dr. Bernhard Gibis von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), bis Ende 2006 sollen es etwa 70 sein. Am besten vorbereitet sind Bremen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus-Kreis und Weser-Ems in Niedersachsen. In den Regionen fanden in den letzten Jahren bereits Modellprojekte zur Erprobung der Mammographie statt, die jetzt als Beispiele für den Aufbau des nationalen Netzwerks gelten. Relativ weit sind auch Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern; Baden-Württemberg und Thüringen wollen im kommenden Jahr beginnen. In Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt stehen die Termine noch in den Sternen. Die Schwierigkeiten bei der Einführung der Mammographie haben auch mit dem Räderwerk des deutschen Gesundheitswesens zu tun. Denn für deutsche Mediziner ist das Programm zur Früherkennung von Brustkrebs eine historische Premiere. Zwar gibt es seit 1971 das Angebot der kostenlosen Krebsvorsorge für Männer ab 45 und Frauen ab 20, aber bislang hat man zur Bestimmung von Haut-, Brust-, Gebärmutter-, Prostata- oder Darmkrebs eher auf einfache Untersuchungen wie Abtasten, Anschauen und Abstriche gesetzt.
Aggressive Methoden
Jetzt werden die Methoden aggressiver: 2002 wurde die Koloskopie zur Ermittlung von Darmkrebs eingeführt; derzeit beraten Experten des Gemeinsamen Bundesausschusses auch darüber, die Suche nach Haut- und Gebärmutterhalskrebs zu reformieren. Und auch beim Aufspüren von Prostatakrebs sind Urologen mit dem Abtasten der Vorsteherdrüse durch den After längst nicht mehr zufrieden: Viele Experten fordern, dass die Krankenkassen zusätzlich einen Bluttest – den PSA-Test – bezahlen sollen. Auch die Mammographie fügt sich in den Trend zur intensiveren Suche. Hinzu kommen jedoch weitere Besonderheiten. Denn bisher war das Interesse an der Früherkennung nie besonders groß. Man ging entweder aus eigenem Entschluss zum Arzt oder wurde von ihm angesprochen, wenn man ohnehin in der Sprechstunde saß. Im Jahr 2000 hat sich nur etwa jeder fünfte Mann und jede zweite Frau untersuchen lassen. Außerdem gab es keinerlei Qualitätskontrolle, so dass niemand weiß, ob das angestaubte Programm wie erhofft die Zahl der Krebstoten verringert hat. Die Massenuntersuchung per Mammographie soll jetzt aber die Zahl der Brustkrebstoten zwischen 50 und 70 Jahre um fast ein Drittel senken. Doch das kann nur gelingen, wenn mindestens 70 Prozent der älteren Frauen regelmäßig ihre Brüste durchleuchten lassen. Um diese hohe Teilnahmequote zu erreichen, sollen jedes Jahr fünf Millionen Frauen im entsprechenden Alter eine schriftliche Einladung zur Röntgenuntersuchung erhalten. „Dazu müssen wir eine völlig neue Bürokratie aufbauen“ sagt Dr. Leonard Hansen, Chef der KV-Nordrhein.
Kopfzerbrechen bereiten den Medizinern insbesondere die strengen Qualitätsvorschriften. Die Anforderungen sind in telefonbuchdicken „Europäischen Leitlinien“ zusammengefasst. Der Katalog legt nicht nur die Qualität der Röntgengeräte fest, sondern auch die Anforderungen an Ausbildung und Erfahrung des Personals: „Die übliche Ausbildung von Radiologen und Frauenärzten genügt bei weitem nicht“, urteilt Brustkrebsexpertin Prof. Ingrid Schreer von der Universität Lübeck.
Diagnose Krebs – oft Fehlalarm
Dass die normale Ausbildung der Ärzte für die Mammographie-Früherkennung nicht ausreicht, liegt daran, dass Brustkrebs aus Sicht einer Frau keineswegs eine Massenerkrankung ist. Die Planungen gehen davon aus, dass auf Dauer nur vier von 1 000 Frauen, die zur Mammographie gehen, Brustkrebs haben. Erfahrungen aus den Niederlanden, die neben England und Skandinavien zu den Vorbildern in Deutschland zählen, zeigen, dass die Mammographie bei der Suche nach diesen vier Frauen immer wieder ein bis zwei übersieht, die dann später doch irgendwann selbst einen Knoten tasten. Andererseits liefern die Aufnahmen bei etwa 50 von 1 000 Frauen einen falschen Krebsverdacht, der sich erst nach weiteren Untersuchungen als Fehlalarm herausstellt.
Um die Rate solcher Fehler so klein wie möglich zu halten, müssen beteiligte Ärzte laut Europäischen Leitlinien pro Jahr mindestens 5 000 Bilder beurteilen. „Ein Arzt, der wie bislang in Deutschland üblich, nur ein paar hundert Frauen untersucht, sieht in der Regel gar nicht of genug einen Tumor, um Erfahrungen sammeln zu können“, sagt die Professorin. Um die Fehlerrate weiter zu verringern, müssen zudem alle Bilder von zwei Spezialisten begutachtet werden, bei Unstimmigkeiten muss ein Dritter hinzugezogen werden. Doch die Anforderungen erfüllt im Moment nur ein Bruchteil der deutschen Ärzte. Derzeit bessern Radiologen, Gynäkologen und Pathologen in Wochend-Crashkursen ihre Qualifikation auf. Mancher Experte setzt darauf, dass diese Kurse der gesamten Brustkrebsmedizin einen Schub geben. „Die Einführung des Mammographie-Programms wird die gesamte Qualität der Versorgung von Brustkrebspatientinnen verbessern“, hofft der Pathologe Prof. Werner Böcker von der Universität Münster. Doch selbst wenn das System schnell aufgebaut würde, wachsen die Zweifel, ob der Nutzen so deutlich ausfallen wird, wie der Bundestag ihn erwartet. 3 500 von 17 000 Brustkrebs-Todesfällen „könnten pro Jahr vermieden werden“, prognostizierten die Politiker. Das setzt aber voraus, dass fast alle Frauen am Programm teilnehmen. In den Modellprojekten in Bremen und Wiesbaden folgt nur die Hälfte der Frauen den Einladungen, in Bayern gar nur ein Drittel. Epidemiologe Dr. Klaus Giersiepen vom Bremer Krebsregister zweifelt noch aus einem weiteren Grund an der Prognose: „Diese Abschätzungen beruhen auf älteren Daten, die mittlerweile nicht mehr auf Deutschland übertragbar sind“. Zusammen mit Kollegen rechnete er im Deutschen Ärzteblatt vor, dass durch die „graue“ Mammographie schon heute in Deutschland so viele kleine Tumore entdeckt würden, wie es die Niederlande erst einige Jahre nach Einführung ihres Mammographie-Programmes erreicht haben. „Wenn wir in Deutschland nicht mehr bei Null beginnen“, sagt Giersiepen, „können wir nicht mehr von einer Verringerung von 30 Prozent durch das Programm ausgehen.“
Tests in der Kritik
Parallel mit der Einführung neuer Methoden ändert sich auch die Bewertung mit Früherkennung. Während die Suche nach Krebs bislang den Ruf hatte, zwar etwas lästig, ansonsten aber sinnvoll oder zumindest harmlos zu sein, beginnen nun Verbraucherschützer wie Stiftung Warentest sich um das Thema zu kümmern. Denn Früherkennungstests sind keineswegs ganz harmlos. Hinzu kommt, dass viele Ärzte die Suche nach Krebs als Geschäftsfeld entdeckt haben. Nach Recherche der Stiftung Warentest bieten deutsche Ärzte mindestens 50 Methoden zur Krebsfrüherkennung an, von denen die meisten als Individuelle Gesundheitsleistung (IGel) auf Privatrechnung bezahlt werden müssen. Während Mediziner diese Tests anpreisen, fallen die in einem neuen Buch zusammengefassten Bewertung der Stiftung unterschiedlich aus. Es gibt nur wenige Tests, die das Geld oder den Zeitaufwand wert sind: Viele andere sind schlicht nutzlos – andere richten sogar mehr Schaden als Nutzen an.
„Grundsätzlich gilt, dass die Entscheidung wohl überlegt sein will“, rät der Urologe Prof. Fritz Schröder, der sich an der Universität Rotterdam auf die Früherkennung von Prostatakrebs konzentriert: „Niemand sollte sich zur Früherkennung drängen lassen.“ Auch die Suche nach Prostatakrebs zeigt, dass man sich bei der Abwägung Zeit lassen sollte. Denn die Bilanz ist zweischneidiger als viele Ärzte es beschreiben: Auf der einen Seite besteht die Hoffnung, dass die Früherkennung tatsächlich Männer vor einem vorzeitigen Tod durch Prostatakrebs bewahren kann. Auf der anderen Seite stehen Männer, die erst durch die Suche nach Krebs ihre Gesundheit verlieren.
Solche Nachteile sind indes um einiges schwerer zu entdecken als die Vorteile. Doch gerade Prostatakrebs ist ein Beispiel dafür, dass die weit verbreiteten Vorstellungen darüber, wie sich Krebs verhält, zu simpel sind. Man stellt sich gängigerweise vor, dass ein Tumor einige Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte heranwächst. Schließlich ist er so groß, dass er per Früherkennung entdeckt und dann geheilt werden kann. Wird er jetzt aber nicht gefunden, wächst er nicht nur weiter, sondern beginnt dann auch Beschwerden zu machen. Und wird unheilbar. Diese Art von Krebs ist aber eher die Ausnahme. Die häufigste Variante des Prostatakrebs verhält sich ganz anders: Aus Untersuchungen an Unfallopfern weiß man, dass wahrscheinlich die Hälfte bis zwei Drittel der Männer zwischen 60 und 70 einen Tumor in der Vorsteherdrüse tragen. Das ist keine schlechte Nachricht: Diese Karzinome werden für die meisten Männer nie zu einem Problem, weil die Betroffenen an etwas anderem sterben, bevor ihr Tumor Beschwerden verursacht.
Krank behandelt
Zum Problem werden diese harmlosen Krebse erst, wenn sie etwa bei einem PSA-Test entdeckt werden: Fachleute gehen von aus, dass ein Drittel bis die Hälfte der durch den PSA-Test entdeckten Prostatatumore, solche sind, von denen die Männer ohne Früherkennung nie erfahren hätten.
Wenn diese Tumore durch Früherkennung entdeckt werden, verändern sie nicht nur die Statistik. Sie prägen auch persönliche Schicksale: Das Problem ist nämlich, dass Ärzte bislang bei der Diagnose nicht in der Lage sind, das Verhalten eines individuellen Tumors sicher vorherzusagen. Diese Unsicherheit löst zu oft eine fatale Automatik aus: Tückischerweise werden die eigentlich harmlosen Veränderungen von Ärzten oft nicht als harmlos erkannt, sondern ebenso aggressiv behandelt wie ein gefährlicher Krebs. Zum Beispiel per radikaler Prostata-Entfernung, die einen Teil der Männer impotent macht und ihnen die Fähigkeit nimmt, das Wasser zu halten.
Beweis fehlt
Die Frage ist nun: Sind Operation und Folgekomplikationen ein annehmbares Risiko, dadurch aufgewogen, dass Männern das Leben gerettet wird? Die Antwort ist bislang offen, weil der Beweis fehlt, dass der PSATest das Leben verlängert.
Auch wenn bei der Früherkennung von Brustkrebs die Wissensgrundlage besser ist, kann die Entscheidung für oder gegen die Mammographie individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Hilfestellung bietet neben Büchern auch eine neue Broschüre zur Mammographie, die das „Nationale Netzwerk Frauen und Gesundheit“ herausgegeben hat. Sie erläutert aus Sicht einer Frau im Alter zwischen 50 und 70, wie groß das Risiko ist, an Brustkrebs zu sterben. Und die Gefahr ist begrenzt: Von 1 000 Frauen müssen etwa acht innerhalb von zehn Jahren damit rechnen, an Brustkrebs zu sterben. Wenn alle 1 000 Frauen zehn Jahre lang regelmäßig zur Mammographie gingen, dann würde sich die Zahl der Brustkrebstoten auf sechs verringern. „Dass letztlich nur zwei von 1000 Frauen von der Teilnahme an der Mammographie profitieren, wirkt auf den ersten Blick enttäuschend“, sagt Prof. Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg, die die Broschüre wissenschaftlich begleitete: „Doch nur solche Zahlen erlauben einer Frau, die Alternativen neutral zu bewerten.“
Klaus KochFreier WissenschaftsautorHerseler Str 2850321 Brühl