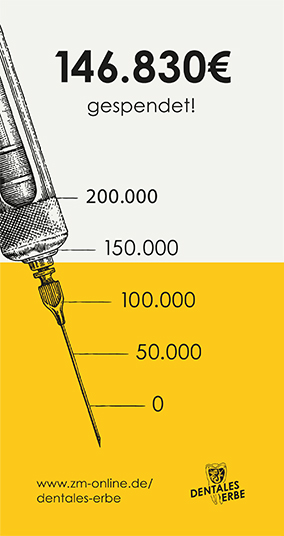Pflege 2011
Meine Oma starb 2003 – zwei Tage vor ihrem 92. Geburtstag. Zuvor erlitt sie zwei Schlaganfälle. Nach dem letzten lag sie im Bett und musste gepflegt werden. Ab dann kam zur Betreuung durch meine Mutter zusätzlich eine Frau vom Pflegedienst ins Haus, die sie wickelte und wusch.
Alt und dement
So wie uns damals ergeht es den meisten Familien. Noch 2009 wurden mehr als 69 Prozent der insgesamt 2,25 Millionen Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden versorgt. Davon übernahmen, so steht es im Familienreport der Bundesregierung, in zwei Dritteln der Fälle die – in der Regel weiblichen – Angehörigen die anfallenden Arbeiten ganz allein, in einem Drittel half ein ambulanter Pflegedienst.
Doch wir, die kommenden Alten, waren in Sachen Fertilität leider weniger produktiv, und falls wir Töchter haben, sind sie meist berufstätig. Entscheidend ist jedoch, dass wir im Unterschied zu unseren Eltern und Großeltern später nicht nur körperlich abbauen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch geistig.
Schon heute leiden in Deutschland rund eine Million Menschen unter Demenz, jährlich kommen 250 000 neu dazu. Im Jahr 2050 wird es in unserem Land voraussichtlich 2,62 Millionen Alzheimer-Kranke geben. Die Pflege daheim: ein Auslaufmodell? Richtig ist, dass es sich Experten zufolge immer weniger rechnet, wenn Familienmitglieder diese Aufgabe selber stemmen. Gerade, weil die Zahl der Pflegebedürftigen unaufhaltsam steigt. 2030 werden es 3,4 Millionen sein – 50 Prozent mehr als noch 2007, wie das Statistische Bundesamt ausrechnete. 2050 endet jeder Dritte als Pflegefall.
Großes Geschäft
Zahlen, die zumindest den Pflegediensten und -heimen zupass kommen: Eine solche Prognose verheißt viele Kunden. Auch wenn die vorrangig gemeinnützigen und kirchlichen Träger das Thema Geld gern aussparen: Die Pflege ist eben auch ein Geschäft. Wir sprechen von einem Markt, einem Wachstumsmarkt. Auch die privaten Firmen haben diesen Markt entdeckt: Mittlerweile befindet sich jeder dritte Pflegeplatz in privater Hand. Die blühende Wirtschaft ist freilich nur die eine Seite. Wie der Pflegealltag aussieht, eine ganz andere.
Beißender Uringeruch, abgestandene Luft: Mit dem Wechseln der Windeln beginnt normalerweise der Arbeitstag im Heim. Nicht selten ist eine Pflegefachkraft für 30 Bewohner zuständig. Zwölf bis 15 Minuten darf das Waschen des Unterkörpers dauern, zum Haare kämmen müssen ein bis drei Minuten reichen, für das Anziehen werden maximal acht bis zehn Minuten eingeräumt. Mit anderen Worten: Mobilisiert der Pfleger eine Schlaganfallspatientin etwas länger als es die Norm erlaubt, fällt das Haare waschen bei dem nächsten Bewohner flach. Jemand klagt über starke Schmerzen, ein Mann ist gerade gefallen, und nebenan liegt ein anderer einsam im Sterben. Wem soll der Pfleger in seiner Schicht gerecht werden? Er hetzt von einem zum nächsten. Minutenpflege par excellence. Demenz und die damit einhergehenden Probleme haben in dieser strikten Einteilung keinen Platz. Auf der Strecke bleibt der Mensch. Wer dem Job trotzdem treu bleibt, braucht eine Menge Idealismus.
Das Gehalt scheint jedenfalls kein Grund zu sein: 1 950 Euro brutto pro Monat verdient ein Pfleger im ersten Jahr – nach dreijähriger Ausbildung. Im Durchschnitt liegt der Tariflohn zwischen 1 700 und 2 700 Euro brutto. Kein Wunder, dass das Gros sich über kurz oder lang beruflich anders orientiert. Oder?
Notstand in der Pflege
Auf 50 000 fehlende Pflegekräfte beziffert der Präsident des Deutschen Pflegerats, Andreas Westerfellhaus, die Lücke heute. Das Statistische Bundesamt prognostiziert, dass 2025 insgesamt 152 000 Pflegekräfte in Krankenhäusern sowie ambulanten und (teil-)stationären Einrichtungen fehlen. Bernd Meurer, der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter, geht sogar von einem Mangel von 400 000 bis 2020 aus. Steigt die Zahl der Pflegefälle in den nächsten 20 Jahren wirklich auf über drei Millionen, droht eine dramatische Zuspitzung. Dass eine Reform der Pflegeversicherung dringend ansteht, haben deshalb längst alle begriffen – ob Politiker, Pflegeverbände oder Kassen. Wie diese aussehen soll, ist freilich strittig.
Neudefinition gesucht
Konsens herrscht allenfalls darüber, dass Demenz bislang nur unzureichend berücksichtigt wird. Der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen soll darum in Zukunft als Maßstab für die Pflegebedürftigkeit gelten. Ausschlaggebend dabei: die Weiterentwicklung des Pflegebegriffs. Ein großes Manko der jetzigen Pflegeversicherung besteht Fachleuten zufolge nämlich darin, dass sich die Leistungen strikt danach bemessen, wie viel Zeit die Hilfe am Patienten in Anspruch nimmt: etwa das Waschen, das Umbetten, die Verabreichung von Medikamenten. Schon der von der großen Koalition – genau: von Ulla Schmidt – eingesetzte Pflegebeirat hatte festgestellt, dass das heutige Raster weder den pflegenden Angehörigen noch den professionellen Kräften gerecht wird. Und gefordert, Pflegebedürftigkeit nicht länger ausschließlich anhand körperlicher Gebrechen zu bestimmen, sondern auch Geisteszustand, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe mit einzubeziehen. Statt der Verengung auf medizinischsomatische Einschränkungen sei eine ganzheitliche Orientierung erforderlich. Eine, die auch die psychisch-kognitiven Schwächen erfasst. Und damit die Realität abbildet, in der bekanntlich Demenz einen immer größeren Raum einnimmt. „Die Pflege soll dazu beitragen, die Selbstbestimmung älterer Menschen zu verbessern“, erläutert Jürgen Gohde, Vorsitzender des Beirats und des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, das Ziel des neuen Pflegebegriffs. Wie kompetent und selbstständig ein Pflegebedürftiger ist, will der Beirat in den Mittelpunkt rücken und daraus den typischen Aufwand ableiten. Er plädierte zudem dafür, aus den heute fünf Pflegestufen drei zu machen, um von der Minutenpflege wegzukommen und der Altersdemenz besser gerecht zu werden.
Finanzierung am Ende
Nachdem diese Vorschläge bislang auf Eis lagen, überraschte Rösler Ende 2010 die Gesundheitspolitik mit seinem Vorhaben, den Schmidtschen Beirat wieder zu aktivieren. Seine Aufgabe: „die Pflege attraktiver zu gestalten und umfassend zu reformieren“. „Wir wollen das Jahr 2011 zum politischen Pflegejahr in der Koalition machen“, kündigte Rösler in dem Zusammenhang an. Geplant ist eine Reform, bestehend aus drei Bausteinen. In einem ersten Schritt will der Minister das Berufsbild von Pflegekräften verbessern, danach die Pflegebegutachtung, also den Pflege-Tüv, neu gestalten. Erst Ende 2011, wenn der künftige Pflegeaufwand und der Finanzierungsbedarf abzuschätzen sind, beginnt demzufolge der Aufbau einer kapitalgedeckten Komponente – „verpflichtend, individualisiert und generationengerecht“. Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Regierung steht bereits, dass die umlagefinanzierte Pflegeversicherung um einen Kapitalstock ergänzt werden soll.
Dieses privat angesparte Geld dient demnach dazu, die vermeintlich drohenden Milliardenlöcher in den Pflegekassen zu stopfen. Einig ist man sich in der Regierung im Übrigen darin, die Alten, Kranken- und Kinderkrankenpflege als einheitliches Berufsbild zusammenzufassen. Verbandsvertreter und Experten plädieren zudem dafür, die aus dem Konjunkturpaket finanzierte Umschulung von Arbeitslosen zu Pflegekräften fortzusetzen.
Fraglich ist nun, ob Rösler das Projekt in der Form überhaupt durchziehen kann. Laut einer Prognose seines eigenen Ministeriums wird sich nämlich der Anteil, den Arbeitnehmer in die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen, bis 2014 lediglich auf 2,1 Prozent des Monatseinkommens erhöhen. Spätestens dann müsse der Beitragssatz freilich steigen, selbst wenn es keine zusätzlichen Leistungen geben soll.
Klar ist aber auch: Die Demografieprobleme fangen erst 2040 an. Weil dann statistisch jeder dritte der über 80-Jährigen ein Pflegefall ist. Deckungsgleich dazu kommt der Sachverständigenrat zu dem Schluss, dass der Satz bis 2050 auf 3,5 Prozent steigt, wenn man sich an der Preis- und Lohnentwicklung orientiert. Bernd Raffelhüschen, Ökonom der Universität Freiburg, denkt sogar, dass aufgrund steigender Pflegelöhne und dementer Patienten selbst 4,5 Prozent optimistisch gerechnet sind. Die FDP setzt daher auf individuelles Sparen, sprich auf ein Polster, mit dem der wachsende Finanzbedarf abgedeckt wird. Parallel dazu, gehöre der aktuelle Beitragssatz eingefroren.
Umlage oder Kaptalstock
Bedenken gegen diese kapitalgedeckte Zusatzversicherung äußerte derweil Koalitionspartner CSU. Für einen „Minimalbeitrag“ lohne sich der Aufwand einer kapitalgedeckten Finanzierungssäule nicht. Die Bürokratiekosten müssten in einem angemessenen Verhältnis stehen, sagte der CSU-Politiker und Unionsvorsitzende im Bundestag Johannes Singhammer. Falle der Beitrag höher aus, müsse wiederum ein Sozialausgleich für Geringverdiener greifen – der aber sei kompliziert. Außerdem entließe man bei einer Pflegeprämie die Arbeitgeber aus der Pflicht zur Mitfinanzierung.
Auch die Opposition lehnt den Kapitalstock ab. Zusatzbeiträge, die für später angespart werden, würden der umlagefinanzierten gesetzlichen Pflegeversicherung de facto Geld entziehen, heißt es in einem Positionspapier der SPD. Ihr Konzept für eine Pflegereform: via „Pflegebürgerversicherung“ alle Versicherten einzubeziehen, die je nach Höhe ihres Einkommens einzahlen. Die Sozialdemokraten sind ohne Wenn und Aber dafür, das Umlageverfahren zu stärken. Aufheben will man dagegen die heutige Trennung zwischen privater und gesetzlicher Pflegekasse. Zwingend sei, dass die Pflegeleistungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch finanziert werden, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Auf der SPDKlausur in Potsdam stimmte der Vorstand einstimmig für ein Sechs-Punkte-Papier:
• Die SPD will einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführen, um die Pflegequalität zu erhöhen und auf die Bedürfnisse Dementer auszurichten.• Sie will die Situation der häuslichen Pflege verbessern, indem pflegende Angehörige stärker unterstützt werden.• Sie plant, die Arbeitsplatzsituation und Ausbildung in der Pflege zu verbessern.• „Prävention und Rehabilitation vor Pflege“, das Versorgungsmanagement soll gepuscht werden.• Stärkung der solidarischen Finanzierung mit der Bürgerversicherung in der Pflege• Die Reform der Pflege sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und in der Zuständigkeit der Kommunen.
Ungleiches Risiko
Für die Grünen gilt die Einführung einer Bürgerversicherung ebenfalls in der Pflege als gesetzt. Eine private Zusatzversicherung „wäre nicht nur der Anfang vom Ende der Solidarität in der Pflegeversicherung“, betont die pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Elisabeth Scharfenberg, vielmehr „ökonomisch fragwürdig“ und verursache „erhebliche zusätzliche Bürokratie und Schnittstellenprobleme“. Auch die Linke nimmt gemäß ihrer Pflegeexpertin Kathrin Senger-Schäfer an, dass eine Kapitaldeckung in der Pflege „keines der Probleme löst, sondern nur neue schafft“. Eine Pflegezusatzpolice wäre darüber hinaus jeder politischen Kontrolle entzogen und bedeute eine „weitere Entsolidarisierung, Privatisierung und Individualisierung sozialer Sicherung“. Gute Pflege dürfe aber „nicht vom privaten Geldbeutel abhängig“ sein. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden und der Grad der Hilfsbedürftigkeit seien ungleich in der Bevölkerung verteilt, hält auch Gernot Kiefer, Vorstandsmitglied im GKV-Spitzenverband, dagegen. Nur mit einem kollektiv aufgebauten Kapitalstock lasse sich der erwartete Beitragsanstieg für alle Versicherten abfedern. Kiefer: „Ein individuelles Ansparen würde dem solidarischen Gedanken der Pflegeversicherung nicht gerecht werden!“ Auf Seiten der Privaten unterstützt man hingegen die Pläne Röslers: In der Pflege sei der sofortige Einstieg in die Kapitaldeckung unausweichlich. „Notwendig wäre eine verpflichtende kapitalgedeckte Zusatzversicherung, da die umlagefinanzierte gesetzliche Pflegeversicherung ihre Grenzen erreicht hat“, argumentiert PKV-Chef Reinhold Schulte. Dass er diesen Stock bei der PKV ansiedeln will, ist logisch. Ihm zufolge wäre es ordnungspolitisch falsch, diese Police bei der GKV anzudocken, weil nur in der PKV der lebenslange Schutz gelte. Vor allem aber seien Kapitalrücklagen nicht sicher vor Zugriffen der Politik. Schulte: „Finanzminister Hans Eichel hat zweimal Pensionsrückstellungen für Postbeamte in Milliardenhöhe verscherbelt!“ Die Idee der Pflege- Bürgerversicherung hält er für „Wirklichkeitsverweigerung“. Schulte: „Es verharmlost die absehbaren demografischen Probleme der Pflegeversicherung und wiegt die Bürger in einer fatalen Schein-Sicherheit.“ Durch die demografische Entwicklung werde sich der Beitrag zur gesetzlichen Pflege bis 2060 mehr als verdoppeln – die angekündigten Ausweitungen der Pflegeleistungen noch nicht eingerechnet.
Die Einbeziehung der PKV löse überdies kein einziges Finanzierungsproblem. „Die große Mehrheit der heute Privatversicherten würde keineswegs den Höchstbeitrag in einer Pflege-Bürgerversicherung zahlen“, so Schulte. „Aber sie würde lebenslang die gleichen Kosten verursachen wie alle anderen – nur ohne kapitalgedeckte Vorsorge.“ Das Ausgabenproblem bliebe davon völlig unberührt und würde sich nur um die Kosten für 9,5 Millionen weitere Versicherte verschärfen. Die ergänzende kapitalgedeckte Pflegeversicherung – für Schulte ein zentrales Projekt „für eine Gesellschaft, die in Würde altern will“.
Rationierte Zuwendung
Studierende des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs Pflege an der Fachhochschule Hannover stellten indessen Röslers fachliche Einordnung in Frage. Sie wehren sich gegen die Einschätzung, der Umgang mit Leid, Sterben und Tod sei die größte Belastung in dem Job. Das Kernproblem, weswegen die meisten kaum länger als acht Jahre im Beruf bleiben, sei vielmehr, dass auch Pflegekräfte täglich Entscheidungen über Rationierungen von pflegerischer Versorgung und Zuwendung zu treffen haben, die sie mit ihrem Gewissen aushandeln müssen. Auch dass Rösler die Bürokratie eindampfen will, stößt auf Ablehnung. An der Dokumentation dürfe nicht gespart werden, da sie Grundstein professioneller Pflege sei. Auch nicht, indem man sie Hilfskräften überlässt: Ein Bruch in der Versorgungskontinuität und ein höherer Zeitaufwand seien die Folgen.
Kritik übte auch der geschäftsführende Vorstand der Hospiz Stiftung, Eugen Brysch. Demenzkranke erhielten immer noch zu selten die Pflege, die sie benötigen. Nötig sei ein „nationaler Demenzplan“, der nicht nur Pflegekräfte im Blick habe, sondern insbesondere Ärzte, die oft zu wenig über Diagnose und Therapie wüssten. Mittlerweile sei recht gut erforscht, welche Pflege und welche medizinischen Therapien den Kranken helfen, fügte Brysch hinzu. In der Praxis werde dieses Wissen jedoch zu selten angewandt. „Stattdessen erhält jeder dritte Patient Beruhigungsmittel, obwohl bekannt ist, wie gefährlich diese Medikamente sind.“ Sie könnten zu Lungenentzündungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen führen.