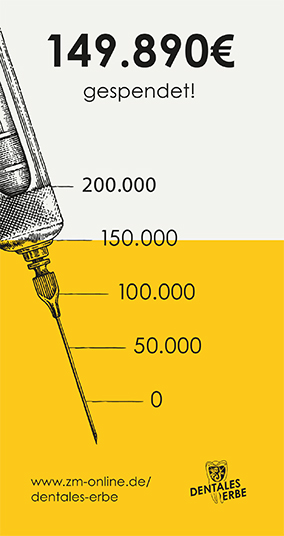Im Schatten des Geldes
Eric Bauer
Es klingt wie die Story eines modernen Finanzthrillers um Geld, Macht und Einfluss: Ein großer Konzern will einen kleineren Konkurrenten übernehmen und setzt dafür Milliardenbeträge ein. Im letzten Augenblick wird die Übernahme noch gestoppt – durch die Intervention eines anderen Konkurrenten, der um seine Pfründe fürchtet.Doch diese Geschichte ist nicht der Feder eines Drehbuchautors entsprungen, sondern hat sich in den vergangenen Monaten hier in Deutschland abgespielt. Genauer gesagt: auf dem Klinikmarkt. Ende April bereitet der Gesundheitskonzern Fresenius, Besitzer der Helios-Kliniken, eine Übernahme der Rhön Klinikum AG vor und unterbreitet den Aktionären ein Angebot in Höhe von 22,50 Euro je Aktie und damit um gut 50 Prozent über dem damaligen Aktienkurs. Transaktionsvolumen insgesamt: über drei Milliarden Euro. Der Rhön-Vorstand empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Der europaweit größte private Klinikbetreiber würde entstehen, zudem könnten 75 Prozent der Bevölkerung in Deutschland durch den Zusammenschluss innerhalb von einer Stunde erreicht werden, heißt es aus beiden Unternehmen. Alles scheint auf die Fusion hinauszulaufen, bis Asklepios, Nummer drei auf dem Markt privater Klinikbetreiber, auf den Plan tritt. Das Unternehmen deckt sich mit fünf Prozent der Rhön-Aktien ein – und macht es Fresenius somit unmöglich, die für strategische Entscheidungen notwendigen 90 Prozent der Rhön-Anteile zu erwerben. Die Fusion ist vorerst geplatzt.
Die Geschichte zeigt: Der deutsche Klinikmarkt ist in Bewegung. Vor allem die privaten Player mischen die Krankenhauslandschaft ordentlich auf.
Private auf dem Vormarsch
Insgesamt stellt sich die finanzielle Lage in der stationären Versorgung in Deutschland heute prekär dar. Laut des aktuellen „Krankenhaus Rating Report“ des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) steht jedes sechste Haus vor der Pleite. Die Zahl der von Insolvenz bedrohtenKrankenhäuser ist seit 2010 von zehn auf 15 Prozent gestiegen. Und nur gut die Hälfte erwirtschaftet ausreichend hohe Erträge, um ihre Unternehmenssubstanz zu erhalten. Gerade diese finanzielle Enge eröffne privaten Krankenhauskonzernen die Möglichkeit zur Expansion, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Auch der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) sieht in den Finanzproblemen und fehlenden Investitionsmitteln vieler Kliniken den Grund für die fortschreitende Privatisierung.
Für manche Klinik ist die Übernahme durch einen Privaten die letzte Rettung vor der Pleite. Klinikunternehmen haben in den letzten Jahren einige defizitäre Krankenhäuser übernommen. Wenn möglich werden sie in kürzester Zeit in die Gewinnzone geführt. Da wundert es nicht, dass Privatein der stationären Versorgung wirtschaftlich am besten dastehen. Nur zwei Prozent von ihnen liegen laut „Rating Report“ finanziell im „roten Bereich“ – im Vergleich zu neun Prozent der freigemeinnützigen und 18Prozent der öffentlich-rechtlichen. Denn private Träger sind sehr gute Umsatzmaximierer. „Direkt nach einer Übernahme konzentrieren sie sich auf eine Senkung der Kosten“, sagt Prof. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg. „Danach stehen Umsatzsteigerung und Spezialisierung im Vordergrund.“ Der Gesundheitsökonombeschreibt exemplarisch, wie ein privater Klinikbetreiber nach einer Übernahme vorgeht: Zuerst werden Personalüberhänge in Servicebereichen reduziert. Weitere Kostensenkungen werden bei Sachmitteln erreicht, beispielsweise indem sie zentralisiert eingekauft werden. Nach zwei bis drei Jahren findet dann ein Outsourcing von Bereichen wie Wäscherei oder Catering statt.
Was die Übernahme durch einen Privaten bedeuten kann, zeigt das Beispiel des Uni-klinikums Gießen-Marburg (UKGM). Im Jahr 2006 übernahm die Rhön-Klinikum AG das Krankenhaus. Die neue Leitung führte das UKGM aus den roten Zahlen und ab 2009 in die Gewinnzone, Millioneninvestitionen in Gebäude und Großgeräte wurden getätigt. Doch seit Anfang des Jahres befindet sich das Klinikum in finanziellen Schwierigkeiten, weil es die Kredite für die vorher getätigten Investitionen zurückzahlen muss. Die Geschäftsleitung forderte den Abbau von 500 Stellen. Verhandlungen zwischen ihr und Betriebsräten, Universitätsvertretern und Landesregierung verliefen wenig fruchtbar, so dass der Medizinische Fakultätentag sogar die Rückübernahme des Hauses durch das Land Hessen empfahl. Durch das Mischangebot aus Patientenversorgung, Forschung und Lehre sei es ein sehr schwieriges Unterfangen, ein Uniklinikum auf Gewinnausschüttung zu trimmen, erklärt Schreyögg. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass ein privater Betreiber auf Dauer mit einem solchen Haus seine Ziele erreichen könne.
Die Ärzteschaft steht privaten Krankenhausunternehmen nicht nur deshalb eher reserviert gegenüber. Im Zuge des geplanten Zusammenschlusses von Helios und Rhön forderte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB), dass Fusionen einer strengen wettbewerbsrechtlichen Prüfung unterliegen sollten. Geprüft werden müsse insbesondere, ob in einzelnen Regionen und für einzelne Fachdisziplinen eine marktbeherrschende Stellung entstehe. „Zu den Kennzeichen der Krankenhausversorgung in Deutschland gehören die Vielfalt und das gleichberechtigte Nebeneinander verschiedener Trägerorganisationen“, erklärten die MB-Delegierten auf ihrer Hauptversammlung im Mai in Nürnberg. „Nur dort, wo sich Patientenim Rahmen ihrer freien Krankenhauswahl zwischen unterschiedlichen Trägern entscheiden können, bleibt die Qualität der Versorgung auch langfristig gewahrt.“
Der Interessenverband Kommunaler Krankenhäuser (IVKK) kritisiert, dass privateKlinikbetreiber nicht primär gemeinwohlorientiert agieren. „Die Kosten der Krankenhäuser tragen sich zum größten Teil aus öffentlichen Mitteln, nämlich den Beiträgen der Krankenversicherung“, erklärt der IVKK-Vorsitzende Bernhard Ziegler gegenüber den zm. „Bei einem Klinikunternehmen in privater Trägerschaft wird die Dividende aus eben diesen Mitteln finanziert, um Anlegerinteressen zu befriedigen und werden somit dem Gesundheitssystem entzogen.“ Das gehe auf Kosten der Beschäftigten und derPatienten.
Versorgung mit reduziertem Personal
Wie steht es nun um die Versorgung in privaten Kliniken? Wird trotz eines Gewinnstrebens eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Patientenversorgung bereitgestellt?
"Natürlich muss der Gesundheitsunternehmer vorrangig sein Unternehmen im Auge haben. Hierzu zählt auch das Ziel, eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften“, heißt es in einer Stellungnahme des BDPK. So ist es nicht verwunderlich, dass das aktuelle Faktenbuch „Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschaft“ des RWI, das im Auftrag des BDPK erstellt wurde, zu dem Schluss kommt, dass Krankenhäuser in privater Trägerschaft im Durchschnitt wirtschaftlicher arbeiten als andere Kliniken. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch eine Studie des HCHE, die Krankenhäuser verschiedener Trägerschaften untersuchte: Ab dem zweiten Jahr nach der Privatisierung gibt es einen signifikanten Anstieg in der Effizienz.
Nach Meinung des RWI geht die Gewinnorientierung aber nicht auf Kosten der medizinischen Versorgung der Patienten. „Wenn ein Krankenhaus eine schlechte Qualität anbietet, wird sich das herumsprechen, so dass weniger Patienten kommen“, urteilt Dr. Boris Augurzky vom RWI, einer der Studienautoren. „Kliniken müssen eine gute Qualität anbieten, sonst gehen sie langfristig pleite. Private Träger schaffen die Verbindung von Gewinnorientierung und guter Patientenversorgung, weil sie Abläufe und Organisation optimieren und ihr Kapital für größere Investitionen nutzen können.“ Vorteile für den Patienten können eine bessere Abstimmung zwischen Akut- und Rehamaßnahmen beziehungsweise bessere Übergänge zwischen stationärer und ambulanter Versorgung sein, da alles aus einer Hand kommt.
Schreyögg konstatiert, dass die Effizienzgewinne nach einer Privatisierung vor allem durch Senkung der Sachkosten und Outsourcing, aber auch dadurch erreicht werden, dass die Zahl der Pflegekräfte reduziert wird. Fünf Jahre nach einer Übernahme gebe es im betroffenen Haus durchschnittlich zehn Prozent weniger Pflegepersonal. „Auch wenn eine Steigerung der Effizienz gesamtgesellschaftlich erwünscht ist, kann eine Reduktion des Pflegepersonals durchaus problematisch sein “, sagt der Gesundheitsökonom. „Studien aus den USA zeigen, dass eine hohe Anzahl von Pflegekräften besonders entscheidend für eine hohe Versorgungsqualität ist.“ Schreyögg sieht die Privatisierungswelle insgesamt eher positiv, da so die Effizienz des gesamten Krankenhaussektors gesteigert wurde, fordert aber mehr Studien, die den Einfluss von Privatisierung auf die Qualität in deutschen Krankenhäusern untersuchen.
Kapazitäten von Medizinern werden nach Erkenntnissen des HCHE nach einer Privatisierung nicht abgebaut. Allerdings wird oftmals das Gehaltssystem umgestaltet. Ärzte in privaten Krankenhäusern erhalten häufig Bonuszahlungen, die an bestimmte Leistungen gekoppelt sind. Damit werden vor allem extrinsisch motivierte Mediziner angezogen. Die intrinsisch motivierten scheiden teilweise aus, weil solche Anreizsysteme nicht ihrer Motivationslage entsprechen. Dieser Selektionsprozess nach einer Privatisierung dauert oft Jahre. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass Ärzte aufgrund des Bonussystems ihren Patienten Leistungen andingen, die sie nicht zu 100 Prozent benötigen. Eine stärkere Qualitätskontrolle im stationären Bereich durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen könnte hier helfen.
Eine Herausforderung, der sich private Klinikbetreiber langfristig stellen müssen, ist die Vollversorgung in der Fläche. Teilweise sind sie schon in ländlichen Räumen aktiv. Nach RWI-Angaben lassen sich 19,3 Prozent der Krankenhäuser in privater Trägerschaft in ländlichen Regionen verorten. Bei den freigemeinnützigen Trägern sind es 7,4 Prozent, bei den kommunalen 23,6 Prozent. Ausgehend von diesen Zahlen kommt Augurzky zu dem Schluss, dass es für private Träger auf Dauer möglich ist, in der Vollversorgung in der Fläche erfolgreich zu sein, wenn sich die Krankenhausstrukturen – auch politisch geplant – verbesserten. Dazu müssten größere Klinikeinheiten zugelassen werden, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein und die Versorgung sicherstellen zu können. So etwas könnten sowohl private als auch freigemeinnützige Träger leisten. Allerdings müsse man aber auch die Schließung eines kleinen Hauses hinnehmen, dessen Betrieb sich wirtschaftlich nicht mehr lohne. Dadurch könnten zwar die Distanzen für Patienten zum nächsten Krankenhaus größer werden, so der RWI-Experte. Im Gegenzug könnte die Qualität steigen.
Ob eine Vollversorgung in der Fläche gelingen erfolgreich gelingen kann, ist allerdings fraglich. Private Anbieter sind häufiger in Ballungsräumen aktiv. In ländlichen Gebieten sind öffentlich-rechtliche Krankenhäuser relativ erfolgreich, weil sie eine Monopolstellung in ihrer Region habenund kostengünstig arbeiten. Deshalb stehen diese Häuser auch seltener zum Verkauf.
Der Wettbewerbsdruck steigt
Der Wettbewerbsdruck in der stationären Versorgung nimmt für alle Träger zu. Insgesamt 81 Prozent von 150 von Ernst & Young befragten Krankenhausmanagern sehen sich einem hohen wettbewerblichen Druck ausgesetzt. Gut drei Viertel erwarten, dass dieser Druck in den nächsten Jahren noch steigen wird.
Nach Einschätzung der Beratungsfirma entwickelt sich der Kliniksektor zunehmend zu einem Markt im eigentlichen Sinne. „Denn anders als in früheren Jahren bewegen sich die Gesundheitsdienstleister heute immer mehr in einer echten Wettbewerbssituation: Kritische Patienten informieren sich, vergleichen Leistungen und stimmen mit den Füßen ab – Kliniken mit unzulänglichem Renommee rutschen rasch in die Existenzgefährdung ab“, heißt es in der Studie.
Der Wettbewerb wird vor allem angefacht von Kliniken, die sich durch Spezialisierungen, durch das Anwerben herausragender Mediziner oder durch eine ansprechende Einrichtung einen guten Ruf aufbauen wollen. Der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Krankenhauses beim Kampf um seine „Kunden“ ist die gelungene Marktpositionierung.
Dazu gehört neben dem Aufbau eines positiven Renommees natürlich auch die Qualitätssteigerung der medizinischen Leistung – entweder durch die Stärkung von Fachbereichen, durch eine Spezialisierung oder durch die Kooperation mit anderen Kliniken. Wichtig für die Häuser ist zudem, die Kosten zu senken. Bei stetig steigenden Ausgaben der Krankenhäuser wird cleveres Wirtschaften zum Erfolgskriterium. Hierbesteht allerdings die Gefahr, dass dies zulasten der Versorgungsqualität geht – durch übertriebene Personaleinsparungen oder durch die Verzögerung notwendiger Investitionen. Ein nicht unbedeutenderErfolgsfaktor kann auch die selektive Angebotserweiterung sein. Dabei kann es sich um medizinische Angebote wie eine Stroke Unit handeln oder um nicht-medizinische wie Hotelleistungen für Angehörige.
Doch eines ist bei allen möglichen Verbesserungsmöglichkeiten klar: „Um ihre Wettbewerbsfähigkeit (wieder)herzustellen, muss die Mehrheit der Krankenhäuser heute um jeden Euro kämpfen“, konstatiert Ernst & Young.
Trend zur Ökonomisierung geht weiter
Manche Experten rechnen in Zukunft nur noch mit einer überschaubaren Zahl an Playern auf dem Klinikmarkt. Der „Krankenhaus Rating Report“ geht davon aus, dass sich in absehbarer Zeit „schließlich fünf große überregionale Klinikverbünde herauskristallisieren mit insgesamt rund 60 Prozent Marktanteil“, die sich in privater oder frei-gemeinnütziger Trägerschaft befinden.
Auch Ernst & Young prophezeit in seiner Studie eine Marktkonzentration. Das Krankenhaussterben und der Vormarsch privater Anbieter würden sich fortsetzen und temporär noch an Intensität zunehmen. Der Riss, der schon heute durch die deutsche Krankenhauslandschaft gehe, werde weiter wachsen: auf der einen Seite die Kliniken in privater Trägerschaft, die ihre Expansion und ihre Investitionen aus eigener Kraft und über den Kapitalmarkt finanzieren und die mit neuen Angeboten ihre Attraktivität weiter steigern können, auf der anderen Seite die öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser, zumeist getragen von Kommunen und Kreisen, deren Finanzen unter den Lasten des Sozialsystems vielfach dahinschmelzen und kaum mehr Spielräume für die Krankenhausentwicklung lassen. Dazwischen bewegten sich die freigemeinnützigen Träger.
Anders sieht die Entwicklung Moritz Quiske, Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die die Gesamtheit aller Kliniken in Deutschland vertritt. Der Rückbau von Krankenhäusern sei an sein Ende gekommen, jetzt gehe es um Erhalt. „Die Leute vor Ort setzen sich für ihre Kliniken ein und drängen dadurch auch die Politik dazu, sich für einen Erhalt stark zu machen“, so Quiske. Vielmehr werde es in Zukunft verstärkte Synergieeffekte zwischen einzelnen Häusern geben, beispielsweise indem gemeinsame Apotheken gebildet werden. Zudem werde es verstärkt Kooperationen zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten geben.
Obwohl laut Schreyögg die Privatisierungswelle viele Innovationsimpulse für den Krankenhausmarkt erbracht hat, sieht er das Modell der gemeinnützigen GmbH (gGmbh), das nach seinen Angaben seit drei bis fünf Jahren den Trend zur Privatisierung abbremst, auf dem Vormarsch. Dabei sind die Kommunen weiterhin die Träger des Krankenhauses, weil sie – anders als bei der Abgabe an einen privaten Träger – die Kontrolle der Klinik nicht vollständig aus der Hand geben wollen.
Der Trend zur Ökonomisierung gilt letztlich aber für alle Krankenhäuser – unabhängig von der Trägerschaft. Alle Häuser müssen sehen, wie sie sich refinanzieren. Der Umgang mit wirtschaftlichen Zwängen und deren Vereinbarkeit mit einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung wird das beherrschende Thema für die nächsten Jahre bleiben.
INFO
Die größten privaten Klinikbetreiber
• Helios: Die zum Dax-Konzern Fresenius gehörenden Helios-Kliniken GmbH erwirtschaftete 2011 einen Jahresumsatz von 2,7 Milliarden Euro. Durch Zukäufe in letzter Zeit, beispielsweise der Damp-Gruppe, ist Helios zur Nummer eins der Krankenhausunternehmen aufgestiegen. Zu Helios gehören 75 Krankenhäuser.
• Rhön: Die fränkische Rhön-Klinikum AG ist im M-Dax notiert und kam 2011 auf einen Jahresumsatz gut 2,6 Milliarden Euro. Zu Rhön gehören gut 50 Kliniken.
• Asklepios: Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist mit einem Umsatz von circa 2,5 Milliarden Euro die Nummer drei der Branche. Asklepios ist im Besitz von 36 Krankenhäusern.
Insgesamt gibt es ein knappes Dutzend private Klinikbetreiber in Deutschland.
INFO
Die deutsche Krankenhauslandschaft
Zurzeit gibt es gut 2 050 Krankenhäuser in Deutschland. Damit ist die Zahl der Häuser seit Anfang der 1990er-Jahre um fast 350 zurückgegangen. Die Zahl der Patienten stieg seitdem von 14,6 Millionen auf 18 Millionen. Auf öffentlich-rechtliche, frei-gemeinnützige und private Träger fallen jeweils ungefähr ein Drittel der Krankenhäuser. Betrachtet man jedoch die Bettenzahl, so liegen die Privaten mit knapp 17 Prozent am Ende der Liste. Auf öffentlich-rechtliche Häuser entfallen 44 Prozent der Betten, auf freigemeinnützige 39 Prozent. Private Betreiber sind seit Anfang der 1990er-Jahre auf dem Klinikmarkt auf dem Vormarsch und konnten ihren Marktanteil seitdem kontinuierlich steigern. Etliche Städte und Landkreise haben von ihnen betriebene, kostspielige Krankenhäuser verkauft.