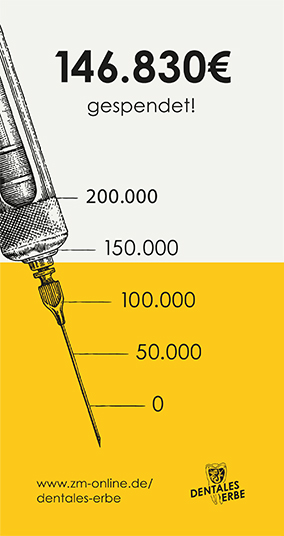Der Kunsthallen-Direktor
Herr Neumann, Sie sind jetzt seit sieben Jahren Direktor der Rostocker Kunsthalle, vermissen Sie noch manchmal die Arbeit als Zahnarzt?Dr. Jörg-Uwe Neumann:
Ja, tue ich. Einer der ganz großen Vorteile der Zahnmedizin ist aus meiner Sicht diese unglaubliche Direktheit der Arbeit. Es ist ganz klar, dass die eigenen Einschätzungen und Handlungen essenziell für die Qualität der Arbeit sind. Hier in der Kunsthalle arbeite ich in einem viel größeren Team als Dienstleister für die Künstler – zumindest sehe ich mich als solcher – und weiß manchmal abends gar nicht mehr, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Das ist in der Zahnmedizin ganz anders, egal, ob man Menschen Schmerzen genommen oder eine tolle Frontzahnbrücke eingesetzt hat. Die damit verbundene unmittelbarere Rückmeldung zur eigenen Arbeit vermisse ich schon. Aber die Arbeit hier ist für mich so spannend und vielschichtig, dass ich die eigentliche zahnärztliche Tätigkeit nicht vermisse.
Verfolgen Sie weiterhin die Entwicklungen der Zahnmedizin?
Ich versuche schon, immer noch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Eine Zeit lang habe ich auch Weiterbildungen mitgemacht, im Moment komme ich aber zeitlich nicht mehr dazu. Ich versuche auch regelmäßig Fachtexte zu lesen, damit ich nicht komplett den Anschluss verliere. Ich bin ja schließlich immer noch Zahnarzt. Und wenn ich zu irgendetwas gefragt werde, möchte ich wenigstens eine Haltung dazu haben – und zwar eine fundierte.
Wie ist es mit der handwerklichen Praxis, verlernt man das?
Absolut. Ich könnte heute nicht mehr behandeln. Das müsste ich wieder üben. Aber dafür gibt es im Moment keinen Grund.
Ein Jahr vor Ihrer Entscheidung 2007, die Praxis abzugeben, ist ihr älterer Bruder gestorben. War dieser Vorfall mit ein Auslöser für die Entscheidung?
Nein. Ich habe ihn damals begleitet und das Erlebnis war für mich einfach die deutliche Erinnerung daran, was uns allen ja grundsätzlich klar ist, wir aber nicht immer vor Augen haben – nämlich, dass unser Leben sehr begrenzt ist. Da ist mir wieder bewusst geworden, dass man Entscheidungen nicht endlos vor sich herschieben darf. So hat sich meine grundsätzliche Fragestellung ’mache noch einmal etwas anderes’ durch die Zäsur mit meinem Bruder noch einmal verschärft. Die Praxis abzugeben habe ich aber lange überlegt, das war keine spontane Entscheidung.
Wie hat es sich angefühlt, die eigene Praxis – für viele ein Lebenswerk – schon mit Ende 40 abzugeben?
Das war gut. Die Praxis aufzugeben, war ja sehr gewollt. Ich habe 15 Jahre meine eigene Praxis gehabt, die auch sehr gut gelaufen ist. Ich habe sie gut entwickelt, zuletzt waren noch eine Kieferorthopädin und eine Zahnärztin mit in der Praxis, wir haben auch Vorbereitungsassistenten ausgebildet. Es war alles gut, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass es für mich beruflich ausgereizt ist. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, aber es war keine neue Herausforderung mehr für mich da, die wirklich spannend gewesen wäre. Zum Geldverdienen wäre es natürlich gut gewesen, das weiter zu machen, aber das war eben nicht mein Antrieb. Darum habe ich gedacht, dann lieber jetzt verkaufen als in ein paar Jahren. Ich wollte nicht in meinem heutigen Alter, mit 55 – was vielleicht ein üblicheres Abgabe- alter ist – den völligen beruflichen Neustart wagen, weil man dann vielleicht nicht mehr kann, auch nicht mehr nachgefragt wird. Deswegen war das Alter für mich perfekt, auch wenn ich damals noch nicht die Idee im Kopf hatte, Museumsdirektor zu werden. Mein Ziel war nur: Ich will die Praxis abgeben und mir Zeit nehmen, um eine neue berufliche Perspektive für mich zu entwickeln.
Wie haben ihre damaligen Kollegen die Entscheidung aufgenommen?
Die meisten haben mich gefragt, ’Bist Du jetzt völlig verrückt geworden?’. Aber vielen hat es auch Achtung oder Respekt abgefordert. Ich habe auch oft zu hören bekommen ’Ich würde mich das nicht trauen’. Klar, die meisten wollen es auch gar nicht tun, aber selbst wenn sie es wollen würden, hätten sie es sich nicht getraut.
Als dann die Stadt plante, 2008 die Kunsthalle zu schließen, entwickelten Sie mit Freunden ein Betreiberkonzept auf Basis eines privaten Fördervereins und boten kurzerhand an, das Haus weiterzuführen. Als Sie den Job schließlich antraten, waren Sie aber fachfremd.Wie wurde Ihr Engagement in dieser für Sie neuen Branche aufgenommen?
Das gab natürlich sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Hier im Haus wurde ich auch nicht direkt mit offenen Armen empfangen, was ich auch verstehen kann. Wenn bei mir einer in meine Praxis kommen würde, der nicht einmal Zahnarzt ist, und mir sagen will, wie es geht, kann das ja nicht richtig sein. Es war aber leider so, dass das Haus wirklich Schließungstendenzen hatte. Das lag an den verschiedenen Gründen, zum Beispiel der Unterfinanzierung. Und natürlich gab es auch von Künstlern und Museumskollegen anderer Häuser kritische Rückmeldungen. Ich kann schon nachvollziehen, dass die dachten, wenn jetzt jeder kommen könnte, wäre das ja auch blöd. Aber am Ende ist meine persönliche Geschichte ja kein Dammbruch gewesen. Außerdem habe ich Wissen aus einer Marketing-Ausbildung mit eingebracht und mich inhaltlich gut eingearbeitet. Mittlerweile habe ich zwei Kunsthistoriker und Museologen mit hier im Haus, dessen Chef ich bin. Ich habe den Überblick und die Intendanz, entscheide also, welches Programm gefahren wird. Aber über die Jahre, in denen ich sehr viele Ausstellungen und viele Messen besucht habe, habe ich sicher einen sehr guten Überblick über zeitgenössische Kunstentwicklung und kann vieles auch sehr gut einschätzen. Trotzdem kann ich verstehen, wenn man mich kritisch beäugt.
Seit der Aufnahme Ihrer Tätigkeit konnten Sie die jährlichen Besucherzahlen verdoppeln und erreichten 2015 mit rund 70.000 Gästen den besten Wert seit 1990. Wo stehen Sie heute?
Wir hatten in diesem Jahr bis jetzt 50.000 Besucher, das ist ein sehr guter Wert. Es kommen ja auch noch ein paar Sachen und die aktuelle Ausstellung läuft auch sehr gut. Das ist eine gute Zahl, da bin wirklich stolz drauf.
Konnten Sie letztlich von Ihren Erfahrungen als Praxischef bei Ihrer neuen Arbeit profitieren?
Ja, meine Praxis war 1992 eine Neugründung, und ich habe von Anfang an ein patientenorientiertes Praxiskonzept verfolgt, so wie das heute üblich ist. Damals war das neu und auch für manche Mitarbeiter ungewohnt. Und genauso war das hier in der Kunsthalle eben auch. Ich habe sofort eine Besucherorientierung eingeführt und diese losgelöste, an dem hehren Kunstbegriff orientierte Ausrichtung aufgeben. Insofern gibt es Parallelen. Und in beiden Fällen muss man Mitarbeiter führen und vermitteln, was wichtig ist und was erreicht werden soll. Das hat man in der Praxis genauso wie in einem Museum. Wenn man diese Ziele dann einmal gemeinsam definiert hat, kann man versuchen, sie gemeinsam umzusetzen.
Hat dieser Anspruch, ein ungefiltertes Feedback von den Besuchern bekommen zu wollen, seinen Ursprung vielleicht auch ein bisschen in Ihrer früheren beruflichen Betätigung?
Ja, das war vielleicht damals auch einer meiner Ansätze, als ich die Kunsthalle mit übernommen habe. So wie ein Patient ja auch nicht in eine Zahnarztpraxis, sondern zu seinem Behandler Herr X oder Y geht, habe ich mir gedacht, dieses Museum muss wieder ein Gesicht bekommen. Es brauchte einen der sagt, ich präge dieses Haus, gebe ihm eine Struktur und stehe auch in der Verantwortung für das Programm. Das war mir wichtig und das wollte ich nach außen tragen. Deswegen bin ich auch relativ präsent gewesen, indem ich erst einmal das Programm vorgegeben habe.
Mittlerweile haben wir auch Kuratoren, die sehr gute Arbeit leisten. Jetzt – als Team – ist es wesentlich einfacher zu agieren. Aber am Anfang musste es erst einmal jemanden geben, der sagt, ich übernehme die Verantwortung und stehe dazu. Und ich liebe es, ins Gespräch mit unseren Besuchern zu kommen, um herauszukriegen, was deren Bedürfnisse sind und wie unser Programm ankommt. Und so wie man eine Praxis nicht ohne Patienten führen kann, ist es hier auch: Wenn wir die Menschen nicht erreichen, haben wir ein Problem.
Um viele Menschen zu erreichen, decken Sie thematisch ein breites Spektrum ab – von der erwähnten Hobbykünstler-Ausstellung bis hin zu Formaten wie die Porträtserie Sterbender „Nochmal Leben“ oder die Ausstellung „Brain Painting“ der vollständig gelähmten Künstlerin Angela Jansen, die Sie für zwei Monate nach Rostock einluden, damit sie hier mit ihren Hirnströmen Kunst schaffen konnte. Wie fiel das Feedback der Besucher aus?
Das war natürlich unterschiedlich. Es gibt Ausstellungen, die ein größeres Publikum ansprechen, wie zum Beispiel die von Werner Tübke, ein großer Maler in der ehemaligen DDR, oder andere, die das nicht tun. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel Sean Scully ausgestellt, das ist ein großer bekannter Künstler, aber eben abstrakt. Das kommt nicht so in der breiten Masse an aber auch das müssen wir natürlich machen, weil wir die Kunst in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Aber ich glaube, die Menschen vertrauen mittlerweile unserer Arbeit und sagen: Komm, wir gucken uns das mal an! Es gibt heute auf jeden Fall mehr Besucher als früher, die das so machen und sich dann mit dem Gezeigten beschäftigen. Man muss ja nicht alle erreichen – mich erreicht ja auch nicht alle Kunst.
Was sind Projekte, die Sie als Leiter noch haben?
Mein Ziel ist, ein Kunstzentrum am Schwanenteich zu entwickeln. Neben dem Schaudepot kommen irgendwann vielleicht auch einmal noch Länderpavillons dazu. Denn eine neue Profilinie unseres Hauses soll der Aufbau eines Zentrums für osteuropäische Kunst sein. Wir wollen uns dabei als einziger Kunstmuseumsneubau der ehemaligen DDR dem Phänomen widmen, dass es in den ehemaligen Ostblockstaaten bis 1989 durch die Sowjetunion geprägt eine relativ homogene Kunstentwicklung gab.
In diesen temporären Pavillons soll dann jeweils ein Land hervorgehoben und der Außenbereich so zu einer größeren Verweilzone entwickelt werden. Meine Vision ist, dass wir das Zentrum für zeitgenössische Kunst in Mecklenburg werden mit einer schönen Strahlkraft nach Berlin, nach Hamburg und auch in den skandinavischen Raum.
Es gibt ein Zitat von Ihnen im Internet, dass Zahnarzt Ihr Traumberuf sei – und Kunst eine Leidenschaft. Heute ist Kunst Ihr Beruf, wahrscheinlich Ihr Traumberuf. Gibt es eine weitere Leidenschaft, aus der sich eine zukünftige berufliche Perspektive ableiten ließe? Sie haben zum Beispiel selbst einmal gemalt.
Richtig, aber es war nie mehr als ein ambitioniertes Hobby, nicht einmal großartig ambitioniert. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Es gibt natürlich Museumsleute, die selbst Künstler sind, aber ich sehe mich eher als Dienstleister. Und ja, es gibt eine weitere Leidenschaft (lacht). Aber dazu sage ich weiter nichts.