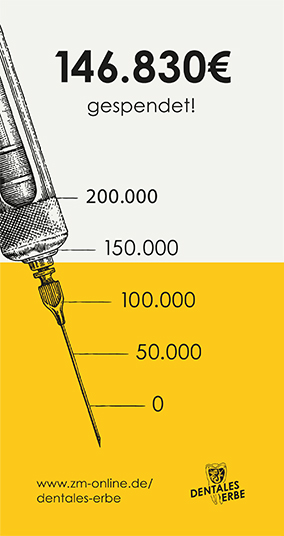Im Netz der Kassen
Im Grunde scheint die Sache ja ganz einfach und logisch zu sein. Statt alleine und jeder für sich zu arbeiten, schließen sich Ärzte zusammen, um eine bessere Versorgung ihrer Patienten zu gewährleisten. Keine unnötigen Doppel- und Dreifachuntersuchungen, keine überflüssigen Überweisungen, keine ungewollten Klinikaufenthalte. Netz-Mediziner sollen Netz-Patienten schneller, besser, günstiger behandeln. Die integrierte Versorgung macht’s möglich.
Rechtlich ist die Sache seit Jahren beschlossen. Nach Paragraph 140a SGB V ermöglicht die integrierte Versorgung eine Versorgung der Versicherten, die auf verschiedene Leistungssektoren übergreift. Die Begründung zum Gesetzentwurf sah vor, Versorgungsformen zu schaffen, die „zwischen Haus- und Fachärzten, zwischen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringern und zwischen dem ambulanten und stationären Bereich“ liegen.
Bei näherem Hinsehen ist die integrierte Versorgung aber viel mehr als ein System zur besseren Koordination ambulanter und stationärer Patientenversorgung, mehr als eine ablaufoptimierte Zusammenarbeit zwischen Facharzt und Krankenhaus. Integrierte Versorgung setzt die Vernetzung der Einzelpraxen voraus – und ist damit ein Türöffner für das Einzelvertragssystem. Die Kassen gehen auf Ärztefang und ziehen sich genau jene Mediziner in ihre Netze, von denen sie sich die größte Kosteneffizienz versprechen (siehe zm 5/2000).
Ärzte als Angestellte von Krankenkassen – für die meisten deutschen Mediziner wohl ein Horrorszenario. Andere Länder, andere Sitten: In den USA und auch in der Schweiz ist „Health Maintainance Organization“ (HMO) ein verbreitetes Modell – welches allerdings scharf kritisiert wird. Gemeinschaftspraxen schließen sich dem HMO-System an, erhalten jährliche Pauschalen für jedes Versicherungsmitglied und müssen damit alle Leistungen abdecken, von der ambulanten Diagnose bis zur stationären Therapie. Dadurch sollen überflüssige Untersuchungen vermieden und bis zu 40 Prozent der Ausgaben eingespart werden.
Auf Versichertenfang
„Integrierte Versorgung bietet ungekannte Wachstumsmöglichkeiten“, meint Diplom- Volkswirt Christof Mutter von der Freiburger Unternehmensberatung CMK. Allerdings sei ein Erfolg nur dann möglich, wenn Patienten das integrierte Versorgungsangebot der Kassen annehmen. „Es muss einem Netzwerk gelingen, für Krankenversicherte attraktive Angebote zu finden und zu präsentieren.“ Wenn den Kassen die Ärzte erst ins Netz gegangen sind, gehen sie auf Versichertenfang.
Um integrierte Versorgung zu realisieren, wären „nicht nur Verträge zwischen Leistungsanbietern und Kassen“ nötig. Auch könne man den Aufbau integrierter Versorgungsnetze nicht deterministisch planen, so Mutter. „Solche Zusammenschlüsse müssen sich entwickeln und man kann lediglich die Entwicklung zu steuern versuchen.“
Den Krankenkassen ist die integrierte Versorgung überaus angenehm. Seit den Seehofer-Reformen müssen sie um ihre Versicherten kämpfen – und über den Beitragssatz ist dieser Kampf nicht zu gewinnen. Mutter: „So wird gerade für jene Krankenkassen, die im Konkurrenzkampf keinen anderen Wettbewerbsvorteil aufweisen können, der Anreiz bestehen, integrierte Versorgungsformen als neue Angebote zu präsentieren.“
Wie zum Beweis hatte der AOK-Bundesverband bereits im Sommer 2000 über die Integrationsversorgung gejubelt. „Der Alltag des deutschen Gesundheitswesens ist noch immer von starren Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung geprägt, zu Lasten des Patienten“, hieß es da in einer Pressemitteilung. „Um die Gräben zu überwinden, setzt die AOK auf integrierte Versorgung.“ Da ein eigenes Budget für diese Projekte zur Verfügung stünde und sich die Beteiligten „von den Vergütungskriterien lösen dürfen, die für Mediziner außerhalb der Netze gelten“, sei es möglich, „andere Schwerpunkte zu setzen“. Von ihren Leistungserbringern erwarte die AOK, dass sie sich vertraglich verpflichten, die Versicherten „qualitätsgesichert, wirksam, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ zu behandeln. Für die willigen Netz-Patienten wiederum stellte die Kasse einen „Beitragsbonus“ in Aussicht. Ein kleiner Köder für die große Beute.
„Die Krankenkassen besitzen allein nicht genügend Expertenwissen, um zu entscheiden, welcher Arzt für welche Aufgabe geeignet ist“, meint Dr. Manfred Richter-Reichhelm, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Geeinigt hatten sich die KBV und die GKV-Spitzenverbände aber bereits im Sommer 2000. Mit einer Rahmenvereinbarung verständigten sich beide Seiten über die Grundlagen einer integrierten Versorgung. Im Frühjahr dieses Jahres hatten die Vertreter der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) nach Gesprächen mit den Kassenverbänden hingegen festgestellt, „dass sie angesichts der Haltung der Krankenkassen keine Möglichkeit sehen, einen Konsens über eine Rahmenvereinbarung zur integrierten Versorgung zu finden“.
Ungleichmäßig versorgt
Zwar teilen KZBV und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Auffassung des Runden Tisches, dass „eine sektorenübergreifende Versorgung im Interesse einer patientenorientierten Behandlung anzustreben“ ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass die integrierten Versorgungsformen, so wie sie in Paragraph 140a SGB V festgelegt sind, begrüßt werden. Besonders kritisch sehen KZBV und BZÄK, dass die sektorenübergreifende Versorgung nur „unter sehr eng begrenzten Voraussetzungen“ ermöglicht wird; nämlich nur für Patienten, die an einer integrierten Versorgung teilnehmen und nur für Ärzte, die mit bestimmten Krankenkassen Verträge abschließen. „Damit ist aber eine gleichmäßige, allen Versicherten zugängliche Versorgung nicht gewährleistet“, so die Stellungnahme von KZBV und BZÄK.
Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Zahnärzten scheiterten: Die GKV-Spitzenverbände hatten gefordert, dass integrierte Versorgung nicht nur sektorenübergreifend, sondern auch innerhalb des zahnärztlichen Sektors möglich sein soll. Das allerdings sei, so KZBV und BZÄK, durch das Gesetz nicht gedeckt. Hier ist lediglich eine Aufteilung in haus- und fachärztliche Versorgung für den ärztlichen, nicht aber für den zahnärztlichen Bereich vorgesehen.
Wann und wo macht integrierte Versorgung im zahnmedizinischen Bereich überhaupt Sinn? Nach Ansicht von BZÄK und KZBV besitzt sektorenübergreifende Versorgung in diesem Bereich „keine große Relevanz“. Nur bei wenigen zahnärztlichen Behandlungen ist auch der ambulante ärztliche oder stationäre Sektor betroffen. Schnittstellen werden etwa bei der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie gesehen oder auch bei der Behandlung von Behinderten. Gerade hierbei, so KZBV und BZÄK, sei aber die integrierte Versorgung auf Grundlage von Paragraph 140 SGB V „kein geeignetes Instrument zur Verbesserung sektorenübergreifender Maßnahmen für alle betroffenen Patienten“.
Einkaufsmodelle
Für den KZBV-Vorsitzenden Dr. Karl-Horst Schirbort stellen die gesetzlichen Regelungen zur integrierten Versorgung aber aus anderen Gründen eine Gefahr dar – sie sind, so der KZBV-Vorsitzende, „die ersten Einfallstore für Einkaufsmodelle“. Die KZBV lehnt die heiß diskutierten Einkaufsmodelle eindeutig ab. „Sie bringen weder Kostenvorteile noch Qualitätsverbesserungen in der medizinischen Versorgung“, so Schirbort. „Im Gegenteil, sie bringen allein einen Macht- und Kompetenz-Zuwachs auf Seiten der Krankenkassen.“ Schirbort befürchtet Preisdumping auf Kosten der Versorgungsqualität. Die freie Arztwahl des Patienten wäre eingeschränkt und die Souveränität, eigene Entscheidungen hinsichtlich seiner Behandlung zu treffen, wäre verloren. Die Pläne von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die freie Arztwahl einzuschränken und Einzelpraxen durch Versorgungsnetze zu verdrängen, belegen für Schirbort eindeutig den „Marsch auf den Kassenversorgungsstaat mit einem vollständig gegängelten und entmündigten Patienten.“
In einem Positionspapier zum Runden Tisch hatte die KZBV im Sommer deutlich gemacht, dass sie in Einkaufsmodellen „keine Lösungen der gravierenden Probleme im Gesundheitswesen“ sieht. Sie stünden nicht nur in einem „eklatanten Widerspruch“ zum System der Sozialen Marktwirtschaft, sondern bedeuteten auch eine Oligopolisierung der Nachfrageseite. „Die Ärzte haben in Einkaufsmodellen keinen Einfluss auf die Verträge.“ Krankenkassen würden aus ihrer dominanten Rolle heraus die Bedingungen diktieren. Wer ein Netz erst in der Hand hält, der will damit unter Garantie auch etwas fangen.
„Die Politiker sehen in den Einkaufsmodellen geradezu eine Heilslehre“, so BZÄKPräsident Dr. Dr. Jürgen Weitkamp. „Fragt man etwas näher nach, so wird bald klar, dass diese Einkaufsmodelle, wenn sie Realität würden, in ihrem Umfeld und in ihren Auswirkungen überhaupt noch nicht durchdacht sind.“ Die deutschen Zahnärzte wären sehr gut beraten, Einkaufsmodelle im derzeitigen System grundlegend abzulehnen – „und zwar ohne Wenn und Aber“.
Für ein „geordnetes und sinnvolles Miteinander kollektiv- und einzelvertraglicher Gestaltungsmöglichkeiten“ spricht sich hingegen die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) aus. Sollte es zu einem Ausbau des Einzelvertragssystems kommen, müssten aber zunächst einige zentrale Punkte geklärt werden. So fragt die DKG etwa, wie sich bei immer differenzierteren Angeboten der Krankenkassen eine einheitliche Versorgung für alle GKV-Versicherten aufrecht erhalten lässt. Auch dürften Qualitäts- und Bedarfsaspekte nicht aufgrund zunehmenden Wettbewerbs und dem Ziel, Kosten zu senken, vernachlässigt werden. Zudem müsse feststehen, wem der Sicherstellungsauftrag zuzuordnen ist, wenn Einkaufsmodelle zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Die Kompetenz zur Ausgestaltung einzelvertraglicher Lösungen“, so die DKG, „darf nicht allein bei den Kassen liegen.“
Modellprojekte
„Schon heute ist es möglich, eine integrierte Versorgung des Patienten zu gewährleisten“, so Schmidt. Entsprechende Modellprojekte laufen bereits. „Wenn es trotzdem noch hapert, so mag das nicht nur daran liegen, dass alte Gewohnheiten gerade in der Selbstverwaltung schwer zu überwinden sind, sondern auch daran, dass das Vertragsrecht sich als Hemmnis auswirkt.“
Ulla Schmidt möchte die Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen neu definieren. Ärzte sollen, so der Wille der Ministerin, mit den Krankenkassen alleinverantwortlich Verträge abschließen dürfen. „Ich neige dazu, jedem Arzt und jeder Ärztin selbst das Recht einzuräumen, mit den gesetzlichen Kassen Verträge über Leistungen abzuschließen.“ Das „Kartell der Kassenärztlichen Vereinigungen“ müsse aufgebrochen werden. Und: „Das Geld der Beitragszahler muss der medizinischen Leistung folgen und nicht dem kleinsten gemeinsamen Nenner einer regionalen Kassenärztlichen Vereinigung.“
Eine Sichtweise, die manche sogar teilen; etwa Andreas Hoffmann von der Süddeutschen Zeitung. „Die Selbstverwaltung von Kassen und Ärzten in der heutigen Form ist überholt“, schreibt er in einem Kommentar seines Blattes, „sie blockiert mehr als sie fördert. Auch die Monopole der Kassenärztlichen Vereinigung sind Dinosaurier der Sozialpolitik.“
Für einige, so Schirbort, scheint das Gesundheitswesen wohl nur „an der Allmacht der Ärzte und Zahnärztekartelle“ zu leiden. „Bezeichnenderweise sollen die Oligopole der Krankenkassen dabei unangetastet bleiben.“ Um Qualität und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, müssen Arztpraxen mehr kooperieren, sagt die Gesundheitsministerin. Fragt sich nur, ob die Ärzte das auch wollen. Nach einer Umfrage der Freiburger Unternehmensberatung CMK können sich immerhin drei Viertel der befragten Ärzte vorstellen, Mitglied eines Netzes im Sinne der integrierten Versorgung zu werden. Bereits heute gibt es in Deutschland mehr als 300 Praxisnetze und Qualitätsgemeinschaften. Bei einem ausgebauten Netzwerk, so eine Schätzung, sei mit Sparmöglichkeiten von 20 bis 25 Prozent zu rechnen – durch kooperative Nutzung von Geräten, durch Laborgemeinschaften oder durch gemeinsamen Einkauf. „Wir müssen Schluss damit machen, dass Ärzte Einzelkämpfer sind“, so Schmidt. „Die Ärzte der Zukunft behandeln in vernetzten Strukturen.“ Und die sollen nach Schmidts Willen dadurch erreicht werden, dass niedergelassene Mediziner in verschärfte Konkurrenz und damit unter Preisdruck geraten – und ihnen de facto nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich zusammenzuschließen. Schmidt: „Die Vergütung ärztlicher Leistungen ist eine Stellschraube, mit der womöglich noch mehr bewegt werden kann.“
Sicherstellungsauftrag
Fragt sich nur, was. „Wer den Sicherstellungsauftrag vollständig den Krankenkassen übergeben will“, so Schirbort, „der erreicht damit, dass die Preise für die ärztliche und zahnärztliche Behandlung und damit die Qualität nach unten gedrückt werden.“
Das Problem betrifft vor allem diejenigen, die derzeit auch am Kollektivvertragssystem unmittelbar beteiligt sind: die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Bundesvereinigungen der Ärzte und Zahnärzte. Im Rahmen des Runden Tisches haben diese Akteure eine Arbeitsgruppe gebildet, um zu prüfen, wie die integrierte Versorgung weiterentwickelt werden kann und was eine Öffnung des Kollektivvertragssystems bedeuten würde.
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe fallen durchaus divergent aus. Darüber, dass eine sektorenübergreifende Versorgung sowohl die Qualität als auch die Wirtschaftlichkeit der Behandlung steigern soll, besteht Konsens. Auch herrscht Einigkeit darüber, dass es keinen vollständigen Wechsel – weg von Kollektivverträgen, hin zu Einzelverträgen – oder eine Streichung der integrierten Versorgung geben dürfe. „Möglichst soll es zu einem geordneten Nebeneinander oder Miteinander beider Vertragssysteme kommen“, stellt die Arbeitsgruppe fest. Als Begründung wird angeführt, dass sowohl Kollektivverträge als auch Einzelverträge ihre Vor- und Nachteile haben (siehe Tabelle).
Hindernisse für eine integrierte Versorgung sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe in der Bedarfsplanung, dem Zulassungsrecht und der sektoralen Budgetierung zu sehen. Denn diese führen „zur Abschottung zwischen den verschiedenen Leistungssektoren“. Auch fehle derzeit die gesetzliche Grundlage zur kollektivvertraglichen Regelung der integrierten Versorgung. Probleme bereitet es der Arbeitsgruppe zudem, festzustellen, inwieweit Ärzte und Zahnärzte durch ihren Zulassungsstatus beschränkt sind, wenn im Rahmen der integrierten Versorgung Verträge gestaltet und abgeschlossen werden. Fazit für den „Runden Tisch“: Die Diskussion zu Kollektiv- und Einzelverträgen sollte „auf einer verbreiterten ordnungspolitischen Ebene fortgeführt werden“ – unabhängig von etwaigen Finanzierungsfragen.
„Wir dürfen nicht warten, bis uns die Realitäten überrollt haben“, sagt Schirbort, „und den Oligopolen der Krankenkassen der Einzelne von uns hilflos gegenüber steht.“ Und auch BZÄK-Präsident Weitkamp warnt vor den Tücken der Netze: „Zum Einkaufen gehören immer zwei – derjenige, der einkauft, und derjenige, der sich einkaufen lässt.“
\n
wesentliche Vorteile
wesentliche Nachteile
\n
Kollektivvertragssystem
\n
\n
gleichmäßige, flächendeckende
Abschottung der
\n
Versorgung
Sektoren
\n
Ordnungsfunktion
fehlende Flexibilität
\n
Ermöglichung einheitlicher
unzureichende Kapazitätssteuerung
\n
Qualitätsanforderungen (Standards)
Verzögerung von Innovationen
\n
Marktungleichgewichte
\n
Einzelvertragssystem
\n
\n
stärkere Versichertenorientierung
Zersplitterung der Versorgung
\n
ökonomische Anreize zur Verbesserung
keine globale Steuerung
\n
der Versorgungsqualität
Einschränkung der
\n
Flexibilisierung der Vertragsgestaltung
freien Arztwahl
\n
bedarfsgerechte Vertragsgestaltung
Machtungleichgewichte
\n