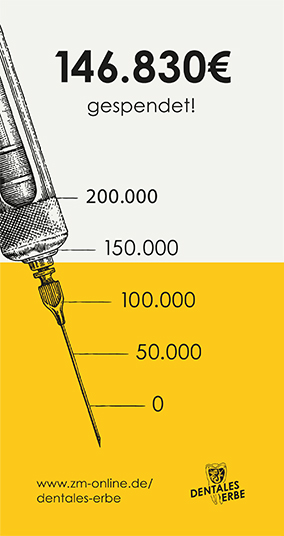Der dritte Weg
Es ist „die ewig alte Leier“: Ebbe in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherungen. Und das trotz der in den letzten zwei Jahren umgesetzten Einsparungen und wachsenden Zusatzleistungen der Bürger durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG). Die Sparansätze haben selbstverständlich nicht gereicht.
Die neue Zwischenbilanz: Rund vier Millionen GKV-Versicherte sollen schon in diesem Jahr höhere Beiträge zahlen. Keine Rede mehr von den noch vor zwei Jahren zugesagten Beitragssatzsenkungen. Ohne eine weitere Reform, so rechnet das Gesundheitsministerium inzwischen ganz forsch hoch, klafft bis Ende der Legislaturperiode ein Finanzierungsloch von zehn Milliarden Euro. Kritiker setzen das Defizit sogar bei 13 bis 14 Milliarden Euro an.
Wirklich überraschen kann das eigentlich Niemanden. Denn steigende Kosten im Gesundheitswesen sind nun mal keine Eigenart des deutschen Systems. Sie steigen weltweit. So schätzt beispielsweise der internationale Unternehmensberater PriceWaterhouseCoopers (PWC), dass in allen OECDLändern die Gesundheitskosten von 2,7 Billionen US-Dollar (2002) voraussichtlich auf über zehn Billionen US-Dollar in 2020 steigen werden. Das Angebot zum Gegensteuern liefern die Berater in ihrer Studie gleich mit: Drei von vier Gesundheitsexperten dieser Welt plädieren, so PWC, für Versicherungssysteme, die sich aus Grund- und Zusatzversorgungselementen zusammen setzen. Aber auch diese Idee ist nicht neu.
In Deutschland tut man sich trotzdem weiterhin schwer. Da hilft es kaum, dass der inzwischen zum Verbraucherminister gekürte ehemalige Chef-Unterhändler für das GMG Horst Seehofer (CSU) der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) vorhält, die Finanzierungsproblematik sei „hausgemacht“, weil die für das GMG getroffenen Vereinbarungen nicht richtig umgesetzt wurden. Seehofer monierte die Zugeständnisse dieser und früherer Regierungen an die Pharmaindustrie, aber auch den ab 2007 reduzierten Bundeszuschuss aus der Tabaksteuer.
Wer aber meint, hier sei schon der Streit zwischen den Koalitionären vorprogrammiert, hat sich getäuscht. Ein Anruf der Ministerin beim Minister habe, so hieß es einen Tag nach dem Vorwurf lapidar, das durch Seehofers öffentliche Ausführungen bei Ulla Schmidt entstandene „Unverständnis“ beseitigt.
Nahe an der Pleite
Aber allen Querelen zum Trotz: Diese Regierung muss handeln. Denn es fehlt – deutlich – an Geld. Die Wahrheit sprechen Deutschlands Regierungsvertreter – immer noch – allenfalls leise oder hinter vorgehaltener Hand aus: Ohne nachhaltige, wirklich richtungsweisende Änderungen wird das deutsche Gesundheitssystem neben Arbeits- und Rentenmarkt das ökonomische Sorgenkind der Nation bleiben.
SPD-Generalsekretär Hubertus Heil formulierte es vorsichtig: „Früher oder später wird diese Gesellschaft mehr Geld für Gesundheit mobilisieren müssen.“
Früher oder später? Deutschlands Heilberufler – sie und ihre Patienten müssen die immer drastischeren Einsparungen zum großen Teil ausbaden und haben hier deshalb ein besonders ausgeprägtes Gedächtnis – reagieren zunehmend mit massiven Protesten. Angefangen bei den Krankenhausärzten machen inzwischen landauf landab tausende im Gesundheitswesen Beschäftigte auf die sich immer mehr zuspitzende Lage aufmerksam.
Zwar stagniert die Beschäftigtenzahl des immer wieder einhellig als potenzieller „Wachstumsmarkt“ eingestuften Gesundheitswesens noch bei 4,2 Millionen Beschäftigten. Aber die Warnsignale sind unübersehbar: Laut Statistischem Bundesamt verzeichneten Deutschlands Arzt- und Zahnarztpraxen im vergangenen Jahr wieder „Pleite“-Rekorde. Dabei sind die von Januar bis September registrierten 93 Arzt- und 82 Zahnarztpraxis-Insolvenzen nur die berüchtigte „Spitze eines Eisbergs“.
Unhaltbare Arbeitszustände in den Krankenhäusern, Versorgungslücken in strukturschwachen Gebieten und teilweise drastische Fallzahlen-Einbrüche durch verunsicherte Patienten rütteln empfindlich am noch qualitativ hochwertigen deutschen Gesundheitssystem. Für den 18. Januar haben Heilberufsorganisationen zur nationalen Protest-Aktion nach Berlin eingeladen.
Ausgesprochen harsch und emotionalisiert fallen derzeit auch die Worte aus, die die Diskussion bestimmen.
„Wir werden von uns aus die Diskussion über die Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft, die Abschaffung des Sicherstellungsauftrages und die Entbindung von allen hoheitlichen Aufgaben aufnehmen,“ sollte die Politik weiterhin versuchen, die Unterfinanzierung zu zementieren und die Vertragsärzte noch stärker zu knebeln, drohte beispielsweise jüngst der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Dr. Andreas Köhler. Ungewohnt heftig reagiert auch Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe auf die aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel auf die geplanten Einschnitte durch das Arzneimittel- Gesetz: „Wir dürfen es nicht zulassen, dass eine Geiz-ist-geil-Mentalität auch in der Arzneimittelversorgung Platz greift.“ Die Bonus- Malus-Verordnung sei die „Einführung eines Provisionsgedankens, wie man ihn sonst nur bei Versicherungsvertretern kennt“. Ulla Schmidt betreibe „politisches Marketing, mit dem staatlich verordnete Rationierung als Qualitätssicherung verkauft wird“, schimpfte Hoppe in der Ärztezeitung. Und die Aufforderung der Gesundheitsministerin, er solle aufhören, „das Verhältnis zwischen Politik und Ärzten weiter zu vergiften“ – konterte Hoppe schlicht, aber heftig: „Ich wüßte nicht, welches Gift noch wirken sollte.“
Nagelprobe der Koalition
Volker Kauder (CDU) sieht die Gesundheitsreform entsprechend ganz richtig als „Nagelprobe“ der großen Koalition. Der Vorsitzende der Unionsfraktion wie auch sein SPD-Pendant Peter Struck – „Wir helfen uns gegenseitig, ... überfordern uns aber nicht“ – wissen um den Druck zur Einigung und erklärten die anstehende Reform zur „Chefsache“. Leicht wird es in der Tat nicht, denn schon die Koalitionsvereinbarung zeigte genau in dieser Frage keine konkreten Ergebnisse.
Die Ausgangspositionen Bürgerversicherung – alle zahlen in ein System mit einheitlichem Leistungskatalog gestaffelt nach Einkommen und Kapitaleinkünften – und Gesundheitsprämie – jeder Versicherte zahlt eine Pauschale, Geringverdiener und Kinder erhalten Zuschüsse aus Steuermitteln – gelten nach wie vor nahezu als dogmatische Grundpositionen der beiden Parteien.
Und gerade SPD-Politiker – unter ihnen auch die Bundesgesundheitsministerin – halten nicht damit hinter dem Berg, dass man etwaige Kompromisse so gestalten muss, dass für die Zeit nach der „Zwangsehe“ zwischen CDU/CSU und SPD der Weg zur Bürgerversicherung weiter offen bleibt. Angela Merkel, Spiritus rektor dieser Allianz, weiß um diese auch in ihrer Partei kursierende Denkhaltung und beschwört die Suche nach Wegen, „die richtig und besser als das heutige System wären. Einen solchen Weg suchen wir.“ Prinzipiell eine Chance für einen neuen Pragmatismus. Doch wo führt der Dritte Weg hin?
Fachleute mit Rezepten zur Vereinbarkeit der beiden Modelle finden sich in so einer Phase politischer Unentschlossenheit in der Regel schnell. Ausführlich diskutiert wird das Kompromissmodell des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Schaffung einer „Bürgerprämie“. Deren Rezept scheint leicht nachvollziehbar: Man nehme alle gesetzlich und privat Versicherten, schaffe eine Versicherungspflicht, erhalte die Privatkassen, erhebe eine von Versicherung zu Versicherung unterschiedliche Pauschalprämie von im Schnitt 170 Euro, beteilige die Arbeitgeber durch eine „Wertschöpfungsabgabe“, finanziere den Sozialausgleich und die Versicherung der Kinder über Steuermittel – und schon hat man beide Modelle – Bürgerversicherung und Gesundheitsprämie – in einem Topf.
„Eine Kopfpauschale für alle“, beeilt sich SPD-Parlamentarier Karl Lauterbach mit der Kritik an diesem Kompromissmodell. Was den Kölner Professoren und ehemaligen Top-Berater von Ulla Schmidt an den Vorschlägen stört, ist die vom DIW über die Wertschöpfungsabgabe implementierte Verabschiedung der einkommensabhängigen Versicherung.
Eine Denkweise der SPD, die wiederum der CDU-Fraktion überhaupt nicht gefällt. Die C-Parteien waren mit der Maxime angetreten, den Arbeitgeberanteil einzufrieren und, so Unions-Fraktions-Vize und Gesundheitsexperte Wolfgang Zöller (CSU), „die Gesundheitskosten in Zukunft nicht nur über die Arbeitskosten zu finanzieren“. Das Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge, so meint auch der eigentlich für Verbraucherfragen zuständige Minister Horst Seehofer gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel, sei schon sinnvoll.
Holland ohne Not?
Aufmerksam verfolgt wird dieser Tage auch das seit Jahreswechsel neu gestaltete Gesundheitssystem der Niederlande. Kernstück der frisch gültigen Reform ist eine mindestens zu 50 Prozent einkommensunabhängige Basispflichtversicherung. Sie wird über Steuertöpfe sozial flankiert. Hinzu kommt ein geringer lohn- oder einkommensabhängiger Anteil. Alle Versicherungen sind zur Schaffung einer kapitaldeckenden Demografiereserve verpflichtet und in einen Risikostrukturausgleich eingebunden. Wettbewerb zwischen Versicherungen und Leistungsträgern sowie eine freie Auswahl unterschiedlicher Zusatzversicherungsarten und -tarife gehören zum neuen System wie ein Kontrahierungszwang zu einer Pflichtprämie in Höhe von etwa tausend Euro pro Jahr. Kinder sind beitragsfrei mitversichert.
Das niederländische Modell setzt auf die Beibehaltung der von privaten und öffentlichen Stellen angebotenen verpflichtenden Grundversicherungen. Ein Modell für Deutschland?
Hier beginnt der Grabenkampf zwischen den rot/schwarzen Koalitionspartnern: Während die christlichen Parteien die Trennung von privaten und gesetzlichen Krankenkassen im Prinzip aufrecht erhalten wollen, plädieren die Sozialdemokraten für die Vereinheitlichung der Krankenversicherungen nach ein- und demselben Leistungsprinzip. Also: Minuspunkte bei der SPD für die niederländische Lösung.
Aber die Gräben ziehen sich nicht nur durch die Parteien, sondern auch quer zwischen Sozialund Steuerpolitikern beider Fraktionen: Während die Sozialressorts mit der Idee einer steuerfinanzierten Versicherung von Kindern liebäugeln, wollen die Finanzexperten hier den Riegel vorschieben. SPDFinanzexperte Joachim Poss gegenüber dem Handelsblatt: „Wer das fordert, muss auch sagen, welche Steuer er dafür zusätzlich zu der schon beschlossenen Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 anheben will.“ Auch Unions-Haushaltsexperte Steffen Kampeter (CDU) warnt: „So falsch kann kein Taschenrechner rechnen.“ Eine Zwickmühle, mit der sich die Regierungspartner schwer tun werden.
Insgesamt scheint allerdings der „kleinere“ Koalitionspartner gar nicht schlecht aufgestellt. Denn das eigentliche Ziel der SPD erweist sich im Vorgeplänkel zu den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner als ausgesprochen sattelfest: Ob gesetzlich oder privat versichert, jeder Patient soll für die gleiche Lösung den gleichen Preis zahlen. Mit diesem großen Auftrumpfen des „Kleinen“ – der eigentlichen Kampfansage an die Leistungsträger des Systems und die private Versicherungswirtschaft – scheint die CDU/CSU aber inzwischen durchaus leben zu wollen.
„Lex Ulla“ ohne Folgen
Dabei war der von Ulla Schmidt im Alleingang gestartete Vorstoß, die privaten Krankenversicherer in die GKV-Finanzierung einzubeziehen, für die im Regierungsgeschäft um Souveränität bemühte CDU hartes Brot – und Grund für die erste Auseinandersetzung zwischen den frischgebackenen Koalitionären: Der laut CDU/CSU nicht durch die Koalitionsvereinbarungen abgesegnete und in den Reihen abgestimmte Plan zwang die politischen Lebensabschnittspartner zur „Lex Ulla“. Die verballhornte Vereinbarung sieht vor, dass unabgestimmtes Vorgehen einzelner Ministerien künftig zu unterbleiben habe.
Aber die Forderung der SPD-Ministerin steht nach wie vor im Raum. Ulla Schmidt poltert mit ihrem Vorhaben weiterhin unabgestimmt durch die gesundheitspolitische Landschaft – nimmt daran aber keinerlei Schaden. Kanzlerin Angela Merkel, so wird kolportiert, rüffelte – oder „adelte“, wie manche meinen – sie nur als „meine renitenteste Ministerin“.
Ausgerechnet die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Annette Wiedmann-Mauz – sie hätte Ulla Schmidt am liebsten gar nicht am Verhandlungstisch gesehen – glänzt inzwischen mit Einschätzungen, die den PKVen wie auch den Leistungsträgern des Systems kaum Freude bereiten können: „Ich halte eine systemübergreifende Reform für denkbar, die nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die privaten Krankenkassen umfasst.“ Vorstellbar wäre, so die CDU-Politikerin, „den im Koalitionsvertrag vereinbarten Finanzausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung auf die Krankenversicherung zu übertragen“. Also ein Zuschlag der privat Versicherten, der dann den GKVen zu Gute käme.
Was hier unter dem Deckmantel gesellschaftlicher Solidarität daher kommt, öffnet dem SPD-Modell „Bürgerversicherung“ zumindest eine Hintertür. Ein innerhalb des deutschen Gesundheitswesens in seiner Bedeutung für die Privatversicherer und auch die Leistungsträger des Systems fataler Eingriff. Denn laut wissenschaftlichem Institut der PKV stützen die Privatpatienten das Gesundheitswesen jährlich mit einem zusätzlichen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro (Berechnungsbasis 2003). Für die niedergelassenen Ärzte geht es um eine Kompensationsmasse von fast 3,66 Milliarden Euro, die als Honorare bisher indirekt das marode System der GKV abgestützt haben.
Nach unten nivelliert
Die im Prinzip im Koalitionspapier bereits angedeutete Nivellierung zwischen GKV und PKV (siehe zm-Info) ist letztlich ein gefährliches Signal für Ärzte und Zahnärzte. „Ein falscher Ansatz“, warnt Bundeszahnärztekammerpräsident Dr. Dr. Jürgen Weitkamp: „Der im Koalitionspapier vorgezeichnete Weg endet in einer Einheitsversicherung mit Behandlungspflicht zu eingeschränkten Konditionen. So wird das Gesundheitswesen nicht wieder auf die Beine kommen.“ Der verzweifelte Versuch, das System mit aller Gewalt finanzierbar zu halten, widerspreche der geltenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ohne Zweifel seien die Auswirkungen einer solchen Regelung im privatzahnärztlichen Bereich für viele Praxen verheerend.
Das ist „staatliche Haushaltssanierung auf dem Rücken der Patienten und der zahnärztlichen Praxen“, mahnt auch der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung Dr. Jürgen Fedderwitz: „Ärztliche Einheitshonorierung ist der falsche Weg.“ Wer die Weichen Richtung „Einheitshonorare und Einheitsversicherung“ stelle, riskiere, „dass das Gesundheitssystem endgültig zusammenbricht“.
Und gerade auch für die PKV selbst gerät dadurch „Holland in Not“: Schon die vor zwei Jahren drastisch angehobene Versicherungspflichtgrenze hat die Zahl der neu abgeschlossenen Krankenvollversicherungen um die Hälfte reduziert. Die jetzt angestrebte politische Verhandlungsmasse ist allerdings noch weit drastischer. Selbst wenn die Gesundheitsministerin beschwichtigt, dass es um Gleichbehandlung und nicht um eine Nivellierung nach unten gehe, gibt es wenig Anlass zur Hoffnung. Schließlich heißt der Ansatz nicht umsonst „Sparen“.
Bleibt zu hoffen, dass ein Gedanke der Gesundheitsexpertin Annette Widmann-Mauz in den anstehenden Verhandlungen allen bewusst wird, damit zukunftsweisende Ansätze nicht endgültig verbaut werden: „Es ist eine Illusion zu glauben, das Gesundheitswesen könnte allein aus sich heraus reformiert werden.“