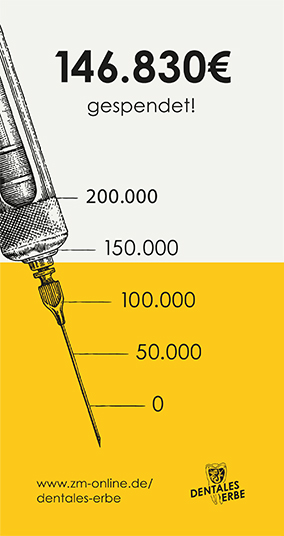Gesellschaft ist gefordert
Familienplanung einmal ganz anders: Als im November vergangenen Jahres in einigen Kreisen im westfälischen Münsterland tagelang der Strom ausfiel, animierte dies offensichtlich viele Paare zur Fortpflanzung. Das Ergebnis: Gut neun Monate nach dem Schneechaos, das den Stromausfall verursacht hatte, verzeichneten die Krankenhäuser in der Region einen ungewöhnlichen Babyboom.
Ob die gestiegene Geburtenrate tatsächlich auf den Vorfall zurückzuführen ist, lässt sich nicht einwandfrei belegen. Auch ist eine solche Maßnahme sicherlich nicht dazu geeignet, das Bevölkerungswachstum in der gesamten Republik anzukurbeln.
Dennoch haben nicht nur die Paare, sondern auch die betroffenen Kreise allen Grund zur Freude. Denn Deutschland mangelt es an Nachwuchs. Aus der einstigen Alterspyramide, deren unterste Balken am dicksten waren, weil es mehr Kleinkinder und Teenager als Erwachsene gab, wird mehr und mehr eine Tanne mit verhältnismäßig schlankem Stamm und breiter Spitze. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 2050 wird ein Drittel der europäischen Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Das bedeutet eine Zunahme von rund 44 Prozent gegenüber heute. Der Anteil der unter 16- Jährigen an der Gesamtbevölkerung hingegen wird dann voraussichtlich nur noch 13 Prozent betragen.
Geringer Kinderwunsch
Solcherlei Prognosen bauen in der Regel auf Hochrechnungen aktueller Fertilitäts- und Mortalitätsraten auf. Neuste Zahlen stammen zum Beispiel aus einer von der Europäischen Union (EU) finanziell unterstützen Befragung von mehr als 34 000 Europäern aller Altersstufen aus 14 Ländern. Ein Fazit der Herausgeber lautet: Vor allem in Deutschland zeichnet sich eine Besorgnis erregende Entwicklung ab. Der Wunsch, Kinder in die Welt zu setzen, ist hier nämlich besonders schwach ausgeprägt. Im Schnitt wollen deutsche Paare nur noch 1,75 Kinder haben. Auch in Österreich, Belgien, Tschechien und sogar im Land der heiß und innig geliebten Bambinis, Italien, ist der Wunsch nach einer Zwei-Kind-Familie inzwischen eher eine Seltenheit. Lediglich in Zypern oder Polen können sich noch mehr als ein Drittel aller Frauen und Männer vorstellen, drei und mehr Sprösslinge großzuziehen.
Schlimmer noch, so ein weiteres Ergebnis der Befragung: Selbst in den Ländern, in denen sich zahlreiche Paare nach wie vor viele Kinder wünschen, wie in den osteuropäischen Staaten, klafft zusehends eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Inzwischen gelingt es keiner europäischen Nation mehr, den für die Reproduktion einer Generation notwendigen Schnitt von 2,1 Kindern pro Frau zu erzielen. Der EUDurchschnitt liegt gerade mal bei 1,5 Kindern. Am fortpflanzungsfreudigsten sind noch die Iren (2) und Franzosen (1,9). Eingesetzt hat der Trend zu immer weniger Kindern in den meisten westlichen EU-Ländern bereits in den 70er Jahren. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: In Schweden beispielsweise stagnieren die Geburtenraten seit Jahren. Nach Meinung von Charlotte Höhn, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), liegt dies vor allem daran, dass die Regierung schon seit Jahren eine aktive und erfolgreiche Politik der Geschlechtergleichstellung betreibt, eingebettet in einen Mix von Maßnahmen, bestehend zum Beispiel aus Kinderbetreuungshilfen sowie steuerlichen Erleichterungen.
In Mittel- und Osteuropa hingegen gehen die Geburtenziffern erst seit rund zehn bis 15 Jahren kontinuierlich zurück. Höhn erklärt sich das damit, dass in Ländern wie Polen mit einer hohen Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Nöten die materiellen Sorgen inzwischen schwerer wiegen als die an sich immer noch stark verankerten Familienwerte. „Die Menschen finden es schwierig, in einem sozialen Klima der Unsicherheit die Verantwortung einer Elternschaft zu übernehmen.“
Das bestätigt auch die BiB-Studie: Ein Großteil der Befragten gab Zukunftsängste als einen wesentlichen Grund für den Verzicht auf Kinder an. „Das Leben in den Großstädten und das Nachlassen der religiösen Gefühle tragen ebenfalls dazu bei, die Kinderzahl zu senken“, so der Europarat anlässlich der europäischen Bevölkerungskonferenz im vergangenen Jahr.
Bei all dem darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Wirtschafts- und Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte diesen Trend beschleunigt hat. So haben die industrielle Entwicklung, die Anhebung der sozialen Standards, der zunehmende Trend zur Individualisierung und der Wunsch zu studieren, einen Beruf auszuüben und ein gewisses Lebensniveau zu erlangen, bevor man eine Familie gründet, mit dafür gesorgt, dass es mit den Geburtenzahlen stetig bergab geht. Und dank der Mitte der 60er Jahre eingeführten Antibabypille konnten und können Paare ihre individuellen Lebenskonzepte auch gezielt umsetzen.
Verbesserte Versorgung
Hinzu kommt die verhängnisvolle Fehlannahme, „Kinder kriegen die Leute immer“, die mit Beginn der 50er Jahre zu einer massiven Ausweitung der sozialen Sicherungssysteme auf der Grundlage des Umlagemodells geführt hat. Während jedoch der Nachwuchs ausblieb, trug die jedermann zugängliche und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung mit dazu bei, dass immer mehr Menschen bis ins hohe Alter hinein ein lebenswertes Leben führen können. In den letzten einhundert Jahren sind uns dank dieser Entwicklung rund 35 zusätzliche Lebensjahre geschenkt worden (siehe Graphik).
Vollkaskomentalität
Das Gegenmodell, eine von Eigenverantwortung und privater Finanzierung geprägte medizinische Versorgung, blieb weitgehend auf der Strecke. Die Folge: Heute hat es der Staat schwer, die auf einer Vollkaskomentalität beruhende Erwartungshaltung breiter Teile der Bevölkerung auf ein von der Solidargemeinschaft finanzierbares Maß zurückzuschrauben.
Treffend skizziert der Soziologieprofessor Dr. Thomas Druyen diese Entwicklung in einem Beitrag zur Beilage der Wochenzeitung „Das Parlament“: „Mit der Einführung der Bismarckschen Sozialversicherungen wurden Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall oder Tod von der Familie auf die Gesellschaft verlagert. Mit diesem Einschnitt wurde wahrscheinlich jener ’psychologische Grundstein’ gelegt, der einerseits über Jahrzehnte hinweg zu einer steigenden Anspruchhaltung dem Staat gegenüber führte und andererseits die Bedeutung der Reproduktion für die Familie entschärfte.“ Ergebnisse der europäischen Bevölkerungsbefragung belegen, dass diese Annahme trotz ständig steigender Beiträge für die Sozialversicherungen unverändert gilt: Auf die Frage etwa, wer sich in erster Linie um die Pflege älterer Menschen kümmern soll, antwortete die überwiegende Mehrheit der Europäer, dies sei Aufgabe professioneller Dienste und nicht Sache der Familie.
Besonders ausgeprägt ist diese Haltung beispielsweise in Österreich. 95,2 Prozent der Österreicher sind der Ansicht, der Staat müsse dafür Sorge tragen, dass ausreichend ausgebildete Kräfte und Einrichtungen zur Verfügung stehen, um ältere Menschen zu betreuen. Aber auch in Deutschland sind immerhin 84,4 Prozent der Bevölkerung dieser Meinung.
Mangelware in der Pflege
Doch woher soll ausreichend qualifiziertes Personal kommen? In vielen Ländern sind professionelle Pflegekräfte längst Mangelware. In Österreich wurde der Pflegenotstand wenige Wochen vor den Nationalratswahlen am 1. Oktober sogar zu einem zentralen Wahlkampfthema erhoben. Über Wochen stritten die Parteien darüber, ob sich das Problem mit der Legalisierung von Arbeitskräften aus Osteuropa lösen lässt. Das gut acht Millionen Einwohner zählende Land rechnet immerhin mit einer Verdopplung der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2050 auf 900 000. Wirtschaftsminister Martin Bartenstein von der konservativen Österreichischen Volkspartei kündigte Anfang September an, das Thema notfalls im Alleingang zu lösen und mittels einer Verordnung die Übergangsfrist für den Zuzug von Pflegekräften aus den neuen EU-Staaten vorzeitig aufzuheben.
Ähnlich sieht es in Bezug auf die Gesundheitsversorgung aus. Auch hier erwarten viele europäische Bürger, dass der Staat die Hauptverantwortung für ein angemessenes medizinisches Angebot übernimmt. In Deutschland sind 69,3 Prozent der Befragten sogar der Ansicht, dass ihnen diese Aufgabe noch wichtiger ist als die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Verschleierung durch Politik
Für Gerd Bosbach, Professor für Statistik, Mathematik und Empirik an der Fachhochschule Koblenz, spielt eine solche Haltung allerdings nur einer Politik in die Hände, der das Argument der „demografischen Zeitbombe“ höchst willkommen ist, um eine wesentliche Ursache für die Einnahmemisere der gesetzlichen Krankenkassen zu verschleiern – nämlich die hohe Arbeitslosigkeit – und fortlaufende Eingriffe in die Renten- und Sozialversicherungssysteme zu rechtfertigen.
„Vorrangigste Aufgabe sollte es jedoch sein, die Erwerbsfähigkeit von Jung und Alt zu fördern und in die Bildung von Kindern und Jugendlichen zu investieren, damit wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können“, sagt Bosbach, der auch einige Jahre beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden und in der Abteilung für Statistik bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) gearbeitet hat.
Statistische Langfristprognosen über die Bevölkerungsentwicklung sind aus seiner Sicht zudem moderne Kaffeesatzleserei, da Berechnungen über 50 Jahre und mehr nicht alle erdenklichen Einflussfaktoren berücksichtigen können.
Auch Namkee Ahn von der spanischen Stiftung für ökonomische Studien (FEDEA) kommt im Rahmen eines von der Europäischen Union (EU) geförderten Projekts zu dem Schluss: „Demografische Vorhersagen auf der Basis traditioneller Modellrechnungen sind für die Aussagen über die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen weitgehend unbrauchbar.“ Neben Fertilitäts- und Mortalitätsraten müssten zahlreiche andere Faktoren, wie sich verändernde Preisstrukturen von Gesundheitsgütern oder auch sich wandelnde Präferenzen bei der Inanspruchnahme von Leistungen berücksichtigt werden, um einigermaßen brauchbare Prognosen treffen zu können, so der Experte.
Eine Studie des International Longevitiy Center-UK (ILC) und der Stiftung Merck Company Foundation räumt gleichfalls mit dem Vorurteil auf, der drohende Kollaps der Gesundheitssysteme in den EU-Ländern ließe sich allein mit der demografischen Entwicklung erklären.
Alter ist nicht stereotyp
„Alter an sich ist keine Krankheit“, so die Autoren, Dr. Suzanne Wait und Ed Haring vom ILC. Das stereotype Bild vom kranken und hilfsbedürftigen alten Menschen sei einfach nicht mehr zeitgemäß. Über 60- Jährige verursachten den Krankenkassen nicht zwangsläufig mehr Kosten als jüngere Menschen. Vielmehr würden die Ausgaben für die medizinische und pflegerische Versorgung eines Menschen in der Regel erst in den letzten 12 bis 18 Monaten vor seinem Tod in die Höhe schnellen – unabhängig von dessen Alter. Senioren dürfe man daher genauso wenig als homogene Gruppe betrachten, wie Menschen unter 40, was ihre medizinischen Bedürfnisse angeht, machen Wait und Haring deutlich.
Für viel wichtiger als das Alter halten die Wissenschaftler indessen die Berücksichtigung des sozioökonomischen Status eines Menschen bei der Analyse seiner Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Denn je ärmer und ungebildeter ein Mensch, desto schlechter ist es in der Regel auch um seine Gesundheit bestellt. So hätten alte Menschen aus ärmeren sozialen Schichten zum Beispiel ein um 30 bis 65 Prozent höheres Risiko, eine chronische Krankheit zu entwickeln, als Senioren aus privilegierten Kreisen, ergab die ILC-Studie. All das lässt den Schluss zu, dass die Bewältigung der Probleme, vor denen die Nationen Europas aufgrund der bevölkerungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Entwicklung stehen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ein Patentrezept gibt es zwar nicht. Geeignet erscheint nach Ansicht von Bevölkerungsexperten allerdings am ehesten ein Mix an Maßnahmen, zugeschnitten auf die kulturellen Eigenheiten und Bedürfnisse einer Nation, als da wären: Chancengleichheit am Arbeitsplatz, finanzielle Beihilfen für Familien, Steuererleichterungen, Kinderbetreuungsdienst, Wohnungsbau- und bildungspolitische Maßnahmen, eine Verschiebung der Renteneinstiegszeiten und Ähnliches mehr.
Zugleich muss in der Bevölkerung ein Bewusstsein entstehen, dass jeder Einzelne oder auch ganze Berufsgruppen dazu beitragen können, dass es sich wieder lohnt, Kinder zu kriegen und bis ins hohe Alter gesund und erwerbsfähig zu bleiben. Dazu gehört auch ein gut funktionierendes Gesundheitswesen und medizinsches Versorgungssystem. Eine große Rolle spielen dabei die Prävention und Gesundheitssförderung, die im frühen Kindesalter ansetzen und möglichst über die gesamte Lebensspanne eines Menschen reichen sollten.
Zahnärzte leisten Beitrag
In Deutschland beispielsweise hat die Zahnärzteschaft schon vor Jahren ihre Aufgabe erkannt, dass sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann und setzt daher auf eine umfassende, präventionsorientierte Zahnheilkunde. Ziel ist es, die Krankheitslast auf einen kurzen und möglichst späten Lebensabschnitt zu drängen und die Mundgesundheit bis ins hohe Alter zu fördern (siehe Kasten).
Auch die Schweizer Zahnärzte sind sich dieser Verantwortung bewusst. Beispielgebend ist unter anderem eine Idee der Klinik für Alterszahnmedizin der Universität Zürich. Mit einem MobiDent getauften Transporter, der eine mobile Behandlungseinheit für die zahnmedizinische Grundversorgung enthält, fährt ein Einsatzteam regelmäßig Senioren- und Pflegeheime an. Auf diese Weise können die mobilen Zahnärzte gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Während sie die Heimbewohner behandeln, erteilen die Assistenten dem Pflegepersonal Tipps zur Mund- und Prothesenhygiene sowie zur altersgerechten Ernährung der Patienten.
In anderen europäischen Ländern ist man indessen längst noch nicht so weit. In Schweden etwa existieren bislang keine speziellen Präventionsprogramme für Senioren. Die zahnmedizinische Versorgung für Patienten über 20 Jahre ist hier kein Teil des staatlichen Gesundheitssystems. Das soll sich allerdings ändern. Mit Beginn nächsten Jahres soll es auch für Ältere finanzielle Unterstützung für besonders aufwändige Zahnbehandlungen aus der Staatskasse geben.
Die französischen Zahnärzte hingegen sorgen sich zurzeit weniger um den sich verändernden Altersschnitt ihrer Klientel als um die Überalterung ihres eigenen Berufsstandes. Das Durchschnittsalter der französischen Kollegen liegt bei 47 Jahren. Nun soll die französische Zahnärztevereinigung CNSD auf Bitten des Gesundheitsministers Vorschläge unterbreiten, wie die zahnmedizinische Versorgung in Frankreich trotz Nachwuchsmangel dauerhaft sichergestellt werden kann.
Petra SpielbergRue Colonel Van Gele 98B-1040 Brüssel