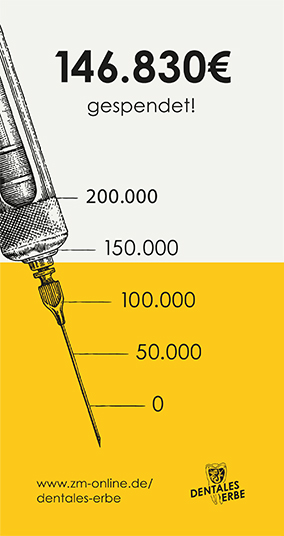Komplexe Kontroverse
Anfang 2009 hat das Großherzogtum Luxemburg als dritter EU-Staat ein Sterbehilfegesetz verabschiedet – und damit auch in Deutschland eine kontroverse Debatte erneut angefacht. Das Thema wird seit Jahren immer wieder diskutiert, ohne dass es dabei auf politischer Ebene zu substanziellen Änderungen gekommen wäre. Denn wenn es um den selbstbestimmten Tod geht, ist die Gesellschaft tief gespalten. Befürworter und Kritiker der Sterbehilfe stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Umfragen scheinen aber zu bestätigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung – laut einer Forsa-Umfrage sollen es 82 Prozent sein – sich eine klare gesetzliche Regelung der Sterbehilfe wünscht, angefangen von der Sterbebegleitung bis hin zur aktiven Sterbehilfe. Denn die juristische Einordnung der Sterbehilfe in all ihren Facetten ist in Deutschland keineswegs eindeutig. Grundsätzlich gilt: Der Suizid ist nach deutschem Recht kein Straftatbestand, somit bleibt auch die Beihilfe zum Suizid unter bestimmten Umständen straflos. Aktive Sterbehilfe, das heißt, eine Tötung auf Verlangen des Patienten, ist in Deutschland jedoch strafbar und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Die passive oder die aktive indirekte Sterbehilfe sind hingegen prinzipiell straffrei.
Anfang 2009 hat das Großherzogtum Luxemburg als dritter EU-Staat ein Sterbehilfegesetz verabschiedet – und damit auch in Deutschland eine kontroverse Debatte erneut angefacht. Das Thema wird seit Jahren immer wieder diskutiert, ohne dass es dabei auf politischer Ebene zu substanziellen Änderungen gekommen wäre. Denn wenn es um den selbstbestimmten Tod geht, ist die Gesellschaft tief gespalten. Befürworter und Kritiker der Sterbehilfe stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Umfragen scheinen aber zu bestätigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung – laut einer Forsa-Umfrage sollen es 82 Prozent sein – sich eine klare gesetzliche Regelung der Sterbehilfe wünscht, angefangen von der Sterbebegleitung bis hin zur aktiven Sterbehilfe. Denn die juristische Einordnung der Sterbehilfe in all ihren Facetten ist in Deutschland keineswegs eindeutig. Grundsätzlich gilt: Der Suizid ist nach deutschem Recht kein Straftatbestand, somit bleibt auch die Beihilfe zum Suizid unter bestimmten Umständen straflos. Aktive Sterbehilfe, das heißt, eine Tötung auf Verlangen des Patienten, ist in Deutschland jedoch strafbar und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Die passive oder die aktive indirekte Sterbehilfe sind hingegen prinzipiell straffrei.
Verwirrende Begriffe
Das juristische Problem liegt allerdings in der klaren Abgrenzung der verschiedenen Formen der Sterbehilfe (siehe Kasten Seite 25), die in der alltäglichen ärztlichen Praxis oft ineinander übergehen. Denn selbst wenn die aktive indirekte Sterbehilfe sowie die Beihilfe zum Suizid zwar offiziell nicht strafbar sind, stellen sie den beteiligten Arzt vor erhebliche Nachweisprobleme. Ein Arzt, der einem Schwerstkranken beispielsweise einen tödlichen Medikamentencocktail zur Verfügung stellt, den dieser dann selbst nimmt, kann wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz belangt werden. Außerdem droht ihm ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn er in den letzten Lebensstunden an der Seite des Patienten bleibt.
Dennoch sieht die organisierte Ärzteschaft keinen Grund für eine gesetzliche Neuregelung: Zentrale Aufgabe des Arztes sei es, das Leben des Patienten zu erhalten, seine Gesundheit zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen. Die Ärzteschaft positioniert sich gegenüber der Legalisierung von Sterbehilfe dementsprechend deutlich – in einer Entschließung des 109. Ärztetages heißt es: „Wir Ärztinnen und Ärzte lehnen es kategorisch ab, uns zum Handlanger und Vollstrecker jedweder Forderung nach aktiver Sterbehilfe machen zu lassen. Die Aufgabe von Ärzten ist und bleibt die Vorbeugung und Heilung von Krankheiten sowie Linderung von Leiden. Diese entspricht dem berufsethischen Leitbild; darauf können sich kranke, alte und gebrechliche Menschen seit jeher verlassen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist um so bedeutender, wenn der Patient machtlos seiner Krankheit ausgeliefert ist und er begleitet vom Arzt einen schweren Leidensweg beschreitet. Die hierbei häufig erfahrene Angst vor einem qualvollen Ende ist verständlich und menschlich. Ihr darf aber nicht dadurch begegnet werden, dass der aktiven Sterbehilfe das Credo der Erlösung zugesprochen wird. Statt eines Tötungsangebotes muss es ärztliche und pflegerische Aufgabe sein, die Lebensqualität unheilbar kranker Menschen bis zuletzt zu erhalten. Palliativmedizin und Hospizarbeit bieten Möglichkeiten für ein Lebensende in Würde und ohne Schmerzen. Eine angemessene Schmerztherapie und die menschliche Zuwendung für die von Leiden, Krankheit und Behinderung Betroffenen müssen daher vorrangige gesellschaftspolitische Aufgabe sein.“
Die organisierte Ärzteschaft ignoriert also keineswegs die Verzweiflung ihrer sterbenskranken Patienten und deren Wunsch nach einem würdevollen Tod. Nur ist aus ihrer Sicht die Sterbehilfe nicht die richtige Option (siehe Interview mit Ärztepräsident Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe Seite 26).
Doch während ärztliche Verbände und Standesorganisationen wie Bundesärztekammer oder Weltärztebund sich klar und deutlich für den konsequenten Schutz des Lebens einsetzen, ergibt eine anonyme Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Healthcare unter Ärzten, die als Klinikfacharzt oder Hausarzt regelmäßig Schwerstkranke behandeln, ein etwas differenzierteres Bild: Danach würde ein Drittel der befragten Ärzte eine gesetzliche Erlaubnis für den ärztlich assistierten Suizid begrüßen, über 16 Prozent der Befragten bejahten dies auch für die aktive Sterbehilfe. Fast jeder Fünfte gab an, bereits ein- oder mehrmals in seinem Umfeld von Suizidbeihilfe erfahren zu haben. Und fast jeder zweite Mediziner (44,5 Prozent) wünscht sich, dass ihm bei einer eigenen schweren Krankheit ein ärztlicher Kollege beim Suizid helfen dürfte.
Angst und Unsicherheit
Angesichts einer technisierten Hochleistungsmedizin, einer bislang in der Breite nur unzureichenden Palliativversorgung und einer pflegerischen Minimalversorgung kann sich offensichtlich selbst so mancher Arzt der unbestimmten Angst vor einem würdelosen Tod an Apparaten nicht verschließen.
Sicherlich sind die veröffentlichten Umfragewerte – ob in der Bevölkerung oder unter Ärzten – zur Legalisierung und gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe vor allem durch eine große Unsicherheit zu erklären. Denn das Sterben hat sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Immer seltener erleben schwerkranke Patienten ihr Lebensende im häuslichen Umfeld, umgeben von der Familie, von der man in Ruhe Abschied nehmen kann. Die Intensivmedizin ist heute in der Lage, Menschen über einen langen Zeitraum am Leben zu halten und das Ende hinauszuzögern. Die Frage nach der Qualität eines solchen Endes geriet dabei ins Hintertreffen.
Ein großer Nachbesserungsbedarf besteht zweifelsohne bei den spezialisierten ambulanten Versorgungsstrukturen, die palliativmedizinische und palliativpflegerische Expertisen anbieten. Bis auf wenige Modellprojekte hat sich deren Etablierung in Deutschland bisher nicht durchsetzen können, obwohl es gerade die Unterstützung durch ambulante Palliativdienste ist, die es vielen Menschen häufig erst ermöglicht, in der vertrauten Umgebung, also zu Hause, zu sterben – so wie es sich die meisten Menschen wünschen.
Gemeinsam mit der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und dem deutschen Hospiz- und Palliativverband hat die Bundesärztekammer deshalb Anfang 2009 einen runden Tisch ins Leben gerufen, der eine nationale Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen erarbeiten soll. Deren Betreuung habe in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren große Fortschritte gemacht, so die Bundesärztekammer. Aber immer noch würden viele der schwerstkranken und sterbenden Menschen von entsprechenden ambulanten und stationären Angeboten nicht erreicht; sie litten unter Schmerzen und anderen belastenden Symptomen und fühlten sich häufig an ihrem Lebensende allein gelassen. „Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft mit einem zunehmenden Anteil chronisch unheilbarer Erkrankungen müssen wir uns intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie wir mit Sterben und Tod umgehen. Die Charta kann in dieser Hinsicht auch ein wirksamer Gegenpol zu den furchtbaren Erscheinungen in jüngster Zeit sein, schwerstkranken Menschen Möglichkeiten zum assistierten Suizid anzubieten“, betonte Prof. Dr. Christoph Fuchs, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer, im Rahmen der Auftaktveranstaltung, bei der Vertreter von rund 40 Organisationen und Institutionen zur Gründung des runden Tisches zusammenkamen.
Koalition der Ablehnung
Mit ihrer Ablehnung einer Legalisierung der Sterbehilfe stehen die Ärzte in Deutschland nicht allein da. Auch die Kirchen stellen sich hinter die Ärzteschaft und deren Einsatz für den Schutz des Lebens. „Mit den Ärzten und Ärztinnen in Deutschland wissen sich die Kirchen einig in der Sorge um eine menschenwürdige Sterbebegleitung. Das Tötungsverbot, also die Unantastbarkeit des Lebens eines anderen Menschen, steht auch einer Tötung auf Verlangen und der Beihilfe zum Suizid strikt entgegen“, heißt es in einer Stellungnahme der deutschen Bischofskonferenz (siehe Statement von Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, Seite 27).
Und auch die Politik will bislang an der bestehenden Gesetzeslage nichts ändern und lehnt die aktive Sterbehilfe ab: „Ich bin absolut gegen jede Form der aktiven Sterbehilfe, in welchem Gewand sie auch immer daherkommt“, positionierte sich vergangenes Jahr die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es sei die klare Position der Union, dass keine aktive Sterbehilfe geleistet werden dürfe, so die CDU-Vorsitzende. Auch Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht keinen Handlungsbedarf: „Für die aktive Sterbehilfe aber gilt: Sie ist und bleibt verboten. Denn wer soll darüber entscheiden, wann ein Leben nicht mehr lebenswert ist?“ Außerdem, so die Ministerin in einem Interview, trage man in Deutschland aufgrund der besonderen historischen Tradition eine entsprechende Verantwortung: „Wir stehen noch im Schatten der NS-Euthanasieverbrechen.“
Doch trotz aller geschichtlichen Bürden lässt sich die Debatte in Deutschland nur schwerlich mit einer „Basta-Politik“ beenden. Denn der bestehenden gesetzlichen Regelung steht eine wachsende Zahl an Menschen gegenüber, die das Verbot der aktiven Sterbehilfe nicht hinnehmen wollen, die über ihr Lebensende selbst bestimmen wollen.
Dieses Recht auf Selbstbestimmung bis zur letzten Lebensminute steht im Fokus der Arbeit der „Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben“ (DGHS). Neben der rechtzeitigen Vorsorge mit einer Patientenverfügung fordert und fördert die DGHS nach eigenen Angaben eine Verbesserung der Hilfen und der Rahmenbedingungen für alte, schwerstkranke und sterbende Menschen und will damit eine breite gesellschaftliche Diskussion anregen, die die Grauzonen und Missstände auch in der jetzigen Sterbehilfe- Praxis benennt und die Grenzen dieser Hilfsmöglichkeiten nicht verschweigt.
Zwar grenzt sich die DGHS deutlich von den zweifelhaften Sterbehilfepraktiken ab, wie sie beispielsweise der ehemalige Hamburger Justizsenator Robert Kusch im vergangenen Jahr medienwirksam betrieben hat. Dennoch fordert die DGHS die Politik immer wieder auf, das „heiße Eisen“ Sterbehilfe aktiv anzupacken und endlich eine umfassende gesetzliche Regelung der Sterbehilfe umzusetzen (siehe Statement von Elke Baezner DGHS Seite 29).
Unterschiedliche Wege im Ausland
Klar ist: Ein prinzipieller Verzicht auf jegliche Diskussion der Sterbehilfe kann schon allein vor dem Hintergrund einer zunehmenden Liberalisierung der Sterbehilfe in europäischen Nachbarländern keine dauerhafte Lösung sein. Denn aus Angst vor einem unwürdigen Tod an Schläuchen wenden sich immer mehr Deutsche an mehr oder weniger obskure Anbieter im Ausland, wo Sterbehilfe bereits teilweise legalisiert ist.
So haben in Europa die Niederlande, Belgien, Luxemburg und die Schweiz Sterbehilfe in unterschiedlichem Ausmaß zugelassen. In den Niederlanden trat 2002 das „Gesetz zur Überprüfung bei Lebensbeendigung auf Verlangen und bei der Hilfe bei der Selbsttötung“ in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass eine Tötung auf Verlangen und die Beihilfe zum Selbstmord nicht mehr als strafbar gelten, wenn sie von einem Arzt begangen werden, der dabei besondere Sorgfaltskriterien beachtet. Dazu gehört unter anderem, dass der Arzt zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Patient freiwillig und nach reiflicher Überlegung um Sterbehilfe gebeten hat, dass der Zustand des Patienten aussichtslos und sein Leiden unerträglich war und dass es in dessen Krankheitsstadium keine andere angemessene Lösung gab.
Kurz nach den Niederlanden legalisierte auch das belgische Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Regierungsparteien die aktive Sterbehilfe. Im Herbst 2002 trat sie in Kraft. Die Gesetzgebung geht über die der Niederlande hinaus: Belgier, die um Sterbehilfe bitten, müssen nicht im Endstadium ihrer Krankheit sein. Die Rechtmäßigkeit der ärztlichen Tötung auf Verlangen wird auch hier an die Einhaltung eines bestimmten Verfahrens gebunden. So muss der Arzt den Patienten über dessen Gesundheitszustand und Lebenserwartung sowie über therapeutische und palliative Möglichkeiten informiert haben und mit diesem zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt sein, dass es in dieser Situation keine andere „vernünftige Lösung“ („solution raisonnable“) für den Patienten gibt. Der Arzt hat sich in mehreren, über eine angemessene Periode hinweg geführten Gesprächen mit dem Patienten der Dauerhaftigkeit seines physischen oder psychischen Leides sowie seines Sterbewunsches zu versichern. Hinsichtlich der Frage, ob ein anhaltendes, unerträgliches und nicht zu linderndes physisches oder psychisches Leid vorliegt, ist ein zweiter, unabhängiger und in der betreffenden Pathologie kompetenter Arzt zu konsultieren. Der Sterbewunsch des Patienten muss vom Patienten selbst schriftlich aufgesetzt und unterschrieben sein. Jede praktizierte Tötung auf Verlangen ist von einer einzurichtenden „Föderalen Kontroll- und Evaluations- Kommission“ registrieren und bewerten zu lassen. Diese hat zu beurteilen, ob die Bedingungen und die jeweils vorgesehenen Verfahrensregeln für eine legale Tötung auf Verlangen erfüllt sind. Kommt eine Zweidrittelmehrheit der 16-köpfigen Kommission (acht Mediziner, vier Juristen und vier unmittelbar mit der Problematik unheilbar Kranker befasste Personen) zu dem Schluss, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist der Fall an den zuständigen Staatsanwalt weiterzuleiten. In Belgien ist das Recht auf Schmerzbehandlung und Palliativmedizin gesetzlich verankert. Im Nachbarland hingegen nicht.
In der Schweiz ist die Sterbehilfe nicht explizit durch das Gesetz geregelt. Aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung eines Menschen zur Verkürzung seines Leidens, ist nach den Artikeln 111 (vorsätzliche Tötung), 113 (Totschlag) oder 114 (Tötung auf Verlangen) des Strafgesetzbuches zunächst strafbar. In Artikel 115 des schweizerischen Strafgesetzbuches heißt es allerdings: „Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.“ Daraus wird gefolgert, dass die Beihilfe zum Selbstmord nicht strafbar ist, wenn sie aus nicht-selbstsüchtigen Motiven geleistet wird. Vor dem Hintergrund der Gründung von Sterbehilfeorganisationen wie Dignitas und dem damit verbundenen so genannten Sterbetourismus hat auch die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK) die liberale Regelung befürwortet, dass Suizidbeihilfe legal ist, solange sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hält als zuständige standesrechtliche Instanz zwar daran fest, dass „die Beihilfe zum Suizid nicht Teil der ärztlichen Tätigkeit“ sei; sie hebt jedoch auch hervor, dass der Arzt andererseits „den Willen des Patienten zu achten“ habe, und dies auch bedeuten könne, „dass eine persönliche Gewissensentscheidung des Arztes, im Einzelfall Beihilfe zum Suizid zu leisten, zu respektieren“ sei.
Der Staat muss Leben schützen
Anfang 2002 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Klage einer Britin abgewiesen, die gerichtlich absichern wollte, dass ihr Mann nicht juristisch bestraft werden dürfe, wenn er ihr auf eigenen Wunsch beim Sterben helfe – die Sterbehilfe ist in Großbritannien unter Strafe verboten. Die Europäische Menschenrechtskonvention garantiere kein Recht auf aktive Sterbehilfe, entschied der EuGH. Das Recht auf Leben verbiete es einem Staat nicht nur, jemanden illegal und vorsätzlich zu töten. Er sei auch verpflichtet, Leben zu schützen und zu erhalten.
Trotz dieses klaren Urteils hat es in der Folge in Europa zunehmende Tendenzen gegeben, dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten oberste Priorität einzuräumen. Die entsprechenden Länder mit einem liberalen Sterbehilferecht folgen damit einer gesellschaftlichen Strömung der zunehmenden Individualisierung. Und sie setzen damit jedes andere Land in Europa unter Druck, sich mit der Frage der Sterbehilfebefürworter ebenfalls gründlich auseinanderzusetzen: Wenn ein Mensch nicht mehr leben will und dies aus einem freien Willen heraus entscheidet, er aber nicht mehr die Möglichkeit hat, eine humane Methode des Suizids selbst durchzuführen – wie kann man diesem Patienten die Hilfe dann verwehren?
Doch ist dieser Ansatz nicht möglicherweise ein wenig einseitig betrachtet? Geht es doch bei der Sterbehilfe um mehr als nur um die persönliche – und oft auch nachvollziehbare – Entscheidung eines Individuums. Die gesellschaftlichen Auswirkungen etwa, die eine Liberalisierung des Sterbehilferechts mit sich bringen würde, dürfen in einer Diskussion über einen würdevollen, selbstbestimmten Tod nicht fehlen. Hierfür lohnt sich ein Blick zurück: Im Sommer 2008 rechtfertigte der ehemalige Hamburger Justizsenator und Verfechter einer völligen Legalisierung der Sterbehilfe, Roger Kusch, seinen wie er es nannte „assistierten Suizid“ bei der 79-Jährigen Bettina Schardt. Nach Angaben von Kusch sei die Frau weder todkrank gewesen, noch habe sie unter ständigen Schmerzen gelitten. Das Motiv für die Selbsttötung der hilfebedürftigen Frau sei die Angst vor der Einsamkeit in einem Pflegeheim gewesen, so der Jurist Kusch, für den damit die Motivation der Patientin völlig ausreichend war, um ihr Sterbehilfe zu leisten.
Selbstmord als Geschäft
Ganz abgesehen von den in der Folge aufgekommenen kritischen Fragen an Kusch, ob die Bezahlung seiner Dienste den Tod zu einem einträglichen Geschäft für ihn mache, ist die zentrale Frage, die sich eine Gesellschaft in diesem Zusammenhang stellen muss: Ist jedem Wunsch nach Sterbehilfe gleich zu begegnen, völlig unabhängig vom Motiv? Wo setze ich die ethischen Grenzen? Denn die Motive für den Wunsch zu Sterben können durchaus vielfältig sein. Für Bundesärztekammer-Präsident Dr. Jörg Hoppe etwa ist jeder Wunsch nach einem Suizid in erster Linie ein Hilfeschrei. Seiner Erfahrung nach seien mehr als 90 Prozent aller Suizide durch Depressionen verursacht, bedingt durch schwere Erkrankungen mit hohem Leidensdruck und oft auch mit wirtschaftlichen Belastungen und sozialer Einsamkeit. Reicht das als Legitimation für eine aktive Sterbehilfe aus? Welche Botschaft wäre eine legale Sterbehilfe in einem solchen Fall an die vielen übrigen Alten, die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befinden? Wächst dadurch auf sie der Druck, ebenfalls möglichst sozialverträglich den Selbstmord zu wählen, statt Verwandte oder Gesellschaft mit ihrer aufwändigen Pflege zu belästigen? „Schwerstkranke und sterbende Menschen sollen sich gerade in den schwächsten Phasen ihres Lebens gewiss sein dürfen, dass sie als Person wertvoll bleiben und Unterstützung erhalten“, fordert deshalb Robert Zollitsch, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz.
Ökonomische Aspekte
Ein weiterer Punkt, der in einer offenen Diskussion nicht ausgelassen werden darf, ist der ökonomische Aspekt. Zum einen muss diskutiert werden, inwieweit eine Kommerzialisierung der Sterbehilfe akzeptabel ist, zum anderen könnte in Zeiten knapper Ressourcen und eines Gesundheitssystems, das an allen Ecken und Enden Geldmangel beklagt, irgendwann auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, ob ein Menschenleben vollumfänglich geschützt werden sollte oder nicht. Dies betrifft dann in erster Linie Patienten, die ihren eigenen Willen nicht mehr selbst bekunden können. So wies der Palliativmediziner Prof. Christof Müller-Busch von der Humboldt-Universität Berlin etwa bei einer Anhörung des Nationalen Ethikrats darauf hin, dass sich Niederländer nach Inkrafttreten des Sterbehilfegesetzes mittlerweile Patiententestamente zulegten, in denen sie jede Form der Euthanasie ablehnen – sie hätten Angst, etwa nach einem Unfall, im Krankenhaus getötet zu werden. Mit dem Gesetz, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (siehe Statement), wachse der Druck enorm, eine Entscheidung für oder gegen das Weiterleben solcher Patienten auch herbeizuführen. Und die Frage, ob dieser Druck ökonomische Gründe haben kann in Gesundheitssystemen, die immer schwerer zu finanzieren sind, wage wohl niemand zu verneinen.
Otmar MüllerGesundheitspolitischer Fachjournalistmail@otmar-mueller.de