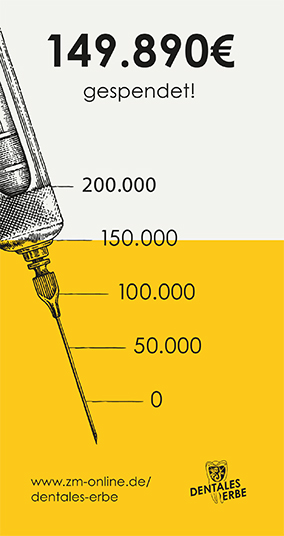Plastische Lehrstücke
Kit:Ach du meine Güte!
Vivian:Was ist denn?
Kit:Ich kenn' diesen sehnsüchtigen Gesichtsausdruck.
Vivian:Ach komm, red' Dir nichts ein.
Kit:Du hast Dich in ihn verliebt.
Vivian:Oh nein, Kit, bitte! Hör auf damit.
Kit:Du hast Dich über beide Ohren verliebt.
Vivian:Kit!
Kit:Hast Du ihn etwa auf den Mund geküsst?
Vivian:Ja, ja … hab' ich getan.
Kit:Du hast ihn auf den Mund geküsst?
Vivian:Na und, es war sehr schön.
Kit:Du verliebst Dich und küsst den Typen auf den Mund? Hast Du denn gar nichts gelernt?
Küssen ist Tabu
Dieser Dialog stammt aus dem Spielfilm „Pretty Woman“ und steht am Beginn jeder Vorlesung der „Psychosomatik in der Zahnheilkunde“ in der Uni Münster. Die Studierenden erfahren en passant, dass es ein ungeschriebenes Gesetz unter Prostituierten gibt: Mit Freiern darf man zwar Sex haben, sie aber nicht auf den Mund küssen. Ersteres ist der Job, letzteres privat.
Die Mundhöhle stellt eine der intimsten Zonen des menschlichen Körpers dar – eine Tatsache, die jedem Zahnarzt bewusst sein sollte, bevor er seinen Patienten bittet, den Mund zu öffnen.
Kino – das ist freilich nicht nur pure Unterhaltung oder reine Ästhetik. Es bietet auch einen unerschöpflichen Fundus an didaktisch wertvollem Material. Und zwar in doppelter Hinsicht, wenn es darum geht, etwas über psychische Störungen zu lernen.
Zum einen ist es immer ein Balanceakt, echte Patienten mit psychischen Erkrankungen im Hörsaal vorzustellen, zum anderen zeigt sich ein solcher Patient in der Vorlesung nur von einer bestimmten Seite – wie er sich zu Hause und in seinen Beziehungen verhält, sieht man nicht. Diese Hindernisse kann man umgehen, wenn man psychisch kranke Spielfilmhelden als kasuistisches Material nutzt. Da es sich nicht um echte Personen handelt, dürfen sie ohne Hemmungen analysiert und entblößt werden, ohne dass jemand dabei Schaden nimmt. Darüber hinaus kann man den Figuren im Film überall hin folgen, sie in intimen Momenten, allein, mit der Familie, am Arbeitsplatz, betrunken oder mit dem Partner im Bett erleben. Dadurch werden psychische Störungen außerordentlich plastisch – zeigen sich doch die Symptome vieler dieser Erkrankungen besonders dann, wenn der Betroffene mit anderen zusammen kommt und Gefühle entwickelt.
Nun könnte man einwenden, im Spielfilm würden die Personen klischeehaft dargestellt und haben nichts mit der Wirklichkeit psychisch Kranker zu tun. Das Gegenteil ist oft der Fall. Schon seit Jahrhunderten zeichnen die Dichter detaillierte und authentische Bilder psychischer Störungen – man denke nur an Kleists Michael Kohlhaas, den Prototypen einer paranoiden Persönlichkeitsstörung [siehe hierzu Köpf 2006, S. 301-309]. Uns fasziniert eben nicht so sehr das Normale, Stabile und Gesunde, vielmehr sind es die Andersartigen, die Außenseiter und die Outlaws, die in uns etwas zum Klingen bringen. Sie zeigen uns, dass unsere heimlichen Wünsche wahr werden können, sie leben unser ungelebtes Leben. Wer hat noch nie die Fantasie gehabt, wie Brad Pitt als Early Grace in „Kalifornia“ Leute, die sich ihm in den Weg stellen, einfach niederzuschießen? Wer hat nicht einmal davon geträumt, die verlorene Geliebte vor dem Traualtar dem Rivalen zu entreißen und mit ihr zu entfliehen, so wie es Ben Braddock (Dustin Hofman) mit Elaine Robertson (Katharine Ross) in „Die Reifeprüfung“ tut?
Heimliche Wünsche
Mit diesen heimlichen Wünschen arbeitet das Kino – nicht nur zufällig, nein, ganz bewusst. So verwundert es nicht, dass in vielen Filmen professionelle Berater – Psychiater oder Psychologen – den Drehbuchautoren, Regisseuren und Schauspielern zur Seite stehen und ihnen die psychischen Störungen der Protagonisten erklären.
Glenn Close als Alex Forrest wusste ganz genau, dass sie eine Borderline-Persönlichkeit spielte, als sie „Eine verhängnisvolle Affäre“ mit Michael Douglas (als Dan Gallagher) hatte. Daher war sie stinksauer, als sie den ursprünglich sehr authentischen Filmschluss – Suizid von Alex Forrest – ganz neu drehen musste (Alex will Dans Frau umbringen und wird dabei selbst getötet), nur weil der Film in der ersten Version beim sentimentalen und actiongierigen amerikanischen Publikum nicht angekommen war. Auch Daniel Brühl bereitete sich auf die Darstellung des schizophrenen Lukas in „Das weiße Rauschen“ vor. Und zwar, indem er gemeinsam mit Regisseur Hans Weingartner und dessen schizophrenem Freund eine Bergwanderung machte.
Es ist also kein Zufall, dass man in vielen Hollywoodproduktionen und europäischen Spielfilmen sehr realistische und differenzierte Darstellungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen findet. Diese Erkenntnis stand zu Beginn des Buchprojektes „Frankenstein und Belle de Jour“ [Doering und Möller 2008], in dem 38 Autorinnen und Autoren 30 Spielfilmfiguren mit verschiedenen psychischen Störungen untersuchen. Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten taten sich mit Geisteswissenschaftlern und Filmemachern zusammen, wählten ihre Lieblingsfilme aus und analysierten die psychischen Störungen ihrer Helden. Entlang der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation [2006] werden aus allen Störungsbereichen exemplarische Fälle vorgestellt. Auf diese Weise ist eine „psychiatrisch-cineastische Krankheitslehre“ entstanden, der die folgenden Beispiele entnommen sind.
Die Alzheimer-Demenz ist eine grausame Erkrankung: für die Betroffenen vor allem zu Beginn, wenn sie (noch) verstehen, was mit ihnen geschieht, und für die Angehörigen, die den geliebten Menschen Stück für Stück verlieren, obwohl er noch an ihrer Seite lebt. Dieses starke Thema wurde mehrfach verfilmt, wobei eine der anspruchsvollsten und bewegendsten Darstellungen mit Iris im gleichnamigen Film von Richard Eyre gelungen ist. Judi Dench wurde für ihre Rolle als alternde Iris für einen Oscar nominiert. Der Film zeichnet die Lebens- und Krankheitsgeschichte der Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch nach. Tief berührt uns dabei insbesondere die Darstellung ihres hingebungsvoll liebenden und leidenden Ehemanns John Bayley – Jim Broadbent erhielt zu Recht den Oscar als bester Nebendarsteller. Axel Karenberg als Medizinhistoriker und Hans Förstl als Psychiater und international ausgewiesener Demenzexperte entwickeln in ihrem Text sowohl die medizinische als auch die filmische Dynamik von Iris und lassen erahnen, welch tiefe Wunden der Morbus Alzheimer in die Seelen der Betroffenen schlägt.
Wer etwas über die Schizophrenie erfahren will, dem sei der Film „Das weiße Rauschen“ mit Daniel Brühl in der Rolle des erkrankten Lukas empfohlen. Wie bereits oben erwähnt, hat sich der Hauptdarsteller intensiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt, was ihm eine verstörend realistische Darstellung der paranoid-halluzinatorischen Psychose ermöglicht hat. Zuerst erlebt man, wie Lukas zunehmend dünnhäutiger und ängstlicher wird. Außenreize dringen immer ungehinderter in sein inneres Erleben ein, wogegen er sich verzweifelt zu schützen versucht. Bald darauf wird er misstrauischer, verdächtigt seine Mitmenschen und seine Umwelt, etwas gegen ihn im Schilde zu führen, und hört immer häufiger Stimmen. Schließlich duscht er täglich mehrere Stunden, da das Rauschen des Wassers alle Frequenzen abdeckt („weißes Rauschen“), und die halluzinierten Stimmen verdrängt. Nach dem ersten Aufenthalt in der Psychiatrie geht es ihm zunächst besser. Als er jedoch auf Anraten seines Mitbewohners die Neuroleptika ins Klo spült, setzt die Symptomatik schleichend wieder ein. Wie in wirklich guten Filmen mit psychisch kranken Protagonisten kommt es am Ende nicht zu einem Happy End mit „Wunderheilung“, sondern Lukas entdeckt, dass er lernen muss, mit der Krankheit und den damit verbundenen Einschränkungen zu leben: „Wonach ich suchte, das war ein Leben, das ich führen kann“ sind seine letzten Worte aus dem Off.
Freud und Tod in Venedig
Ein junger Professor aus Wien, in dem unschwer Sigmund Freud zu erkennen ist, sitzt 1912 in einem Café auf dem venezianischen Markusplatz und liest Goethes Faust. Dabei wird er Zeuge eines Gesprächs zwischen dem Direktor des Grand Hotels und einem venezianischen Friseur, die sich über ein prominentes Opfer der jüngsten Choleraepidemie in Venedig unterhalten: Gustav von Aschenbach. Der hatte sich in einen polnischen Jungen verguckt und dabei die rechtzeitige Abreise aus Venedig verpasst. Sie ahnen es bereits: Es geht um „Der Tod in Venedig“ in der großartigen Verfilmung von Lucchino Visconti. Psychotherapeut Michael Bruns und Komponist, Regisseur und Puppenspieler Georg Jenisch haben sich dem Film mit einem literarischen Kunstgriff genähert, indem sie Freud seine Gedanken über von Aschenbach, dessen Homosexualität und seine Depression äußern lassen. In Viscontis Film, der bekanntlich auf Thomas Manns gleichnamiger Erzählung basiert, lässt sich aber nicht nur die Entwicklung der Depression von Aschenbach, gespielt von Dirk Bogarde, differenziert ablesen. Es werden auch die Symptome der „schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome“ (F32.2 der ICD-10) sichtbar. Von Aschenbachs Choleratod ist als „passiver Suizid“ zu verstehen: Obwohl er um die tödliche Gefahr weiß, reist er nicht aus Venedig ab, sondern erwartet seinen Tod.
Im Gegensatz zu Viscontis Film handelt es sich bei „Aviator“ um Hollywood reinster Prägung. Dennoch stellt hier Leonardo di Caprio – der für diese Rolle einen Oscar erhielt – eine psychische Störung enorm eindrucksvoll dar. Er verkörpert den Millionenerben und Großindustriellen Howard Hughes, eine historische Persönlichkeit. Hughes ist von Größenfantasien getrieben, wobei er im Gegensatz zu vielen anderen Menschen die finanziellen Mittel und den Willen besitzt, diese auch umzusetzen.
Er dreht mit irrwitzigem Aufwand einen monströsen Kriegsfilm und konstruiert das bis dahin mit Abstand größte Transportflugzeug für die U.S. Air Force. Geschäftliche Fehlentscheidungen und schicksalhafte Wendungen fügen ihm empfindliche Verluste zu, die ihn vermutlich jedoch nicht die Existenz gekostet hätten, wenn er nicht unter seiner psychischen Erkrankung gelitten hätte. Seine Zwangsstörung äußert sich dadurch, dass er panische Angst vor Verunreinigungen und Infektionen hat. Er schließt sich ein, lässt niemanden zu sich und ernährt sich nur noch von Milch aus ungeöffneten Flaschen, die er nach einem festgelegten Ritual öffnet und trinkt. Bewegend stellt di Caprio die Beeinträchtigung durch die Symptomatik dar. Etwa wenn er bei einem Empfang in einem Luxushotel die Toilette aufsucht: Zum Hände waschen packt er ein eigenes Stück Seife aus und muss ein komplexes Waschritual vollziehen. Als ihn ein behinderter Mann – ebenso wie er im Smoking – anspricht und um ein Handtuch bittet, gerät er in einen dramatischen inneren Kampf: Er will höflich sein und das Handtuch reichen, gleichzeitig müsste er sein Ritual unterbrechen und seine Angst vor einer Infektion würde abrupt wachsen. So schlägt er schließlich die Bitte ab: „Ich kann nicht, es tut mir leid.“
Einer der eindrucksvollsten Filme, die in „Frankenstein und Belle de Jour“ abgehandelt werden, ist „Das geheime Leben der Worte“. Die spanische Regisseurin Isabel Coixet schildert subtil das innere Drama zweier zutiefst verletzter Seelen. Die junge Krankenschwester Hanna wurde im jüngsten Balkankrieg Opfer grausamer Folter und Vergewaltigung und leidet infolgedessen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Diese zwingt sie, sich aus allen persönlichen Kontakten zurückzuziehen, um in ihrer Arbeit sowie einem streng ritualisierten, reduzierten Privatleben das nötige Mindestmaß an Überlebensfähigkeit zu entwickeln. Als ihr Chef sie nötigt, nach Jahren erstmals Urlaub zu nehmen, bedroht sie die unstrukturierte Freizeit dermaßen, dass sie sich als Pflegerin für ein Brandopfer auf einer Ölbohrinsel verdingt. Ihr Patient, Joseph (Tim Robbins), ist schwer verletzt und hat sein Augenlicht vorübergehend verloren.
Die dadurch bedingte Distanz macht es Hanna möglich, sich ihm Stück für Stück anzuvertrauen. Als er jedoch gesünder wird, „droht“ Nähe, vor der sie flüchtet, bevor Joseph wieder sehen kann. Joseph unternimmt alles, um sie aufzuspüren, da er sie offenbar aufrichtig liebt. Dabei erfährt er erst wirklich, welchen unvorstellbaren Grausamkeiten Hanna ausgesetzt war.
Schwimmen im Tränenmeer
Als beide sich wiedersehen, fragt Joseph, ob sie mit ihm fortgehen möchte. Es entsteht folgender Dialog:
Hanna:Das wäre, glaube ich, nicht möglich.
Joseph:Warum nicht?
Hanna:Weil ich Angst habe, dass wenn wir zwei gemeinsam irgendwo hingehen, dass ich dann eines Tages, vielleicht nicht heute, und vielleicht auch nicht morgen, aber dass ich vielleicht eines Tages auf einmal anfange zu weinen, und zwar so heftig und lang, dass keiner was dagegen machen kann. Und dann füllen die Tränen den Raum, ich bekommen keine Luft mehr, ziehe Dich nach unten und dann müssen wir beide ertrinken.
Joseph:Ich lerne schwimmen, Hanna. Ich schwör´s.
Intuitiv erkennt Joseph, dass es die größte Angst der traumatisierten Hanna ist, er könnte ihr Leid auf Dauer nicht ertragen, und signalisiert seine Bereitschaft und Stärke. Dies ermöglicht ihr, auf ihn zuzugehen. Am häufigsten von allen psychischen Erkrankungen werden Persönlichkeitsstörungen in Spielfilmen dargestellt. Dies geht natürlich in erster Linie auf das Konto der so genannten antisozialen Persönlichkeitsstörung, von der ein Großteil aller Verbrecher betroffen ist. Zwei besonders dramatische Darstellungen dieses Typs finden sich in „Das Schweigen der Lämmer“ (Hannibal Lecter – Anthony Hopkins) und in „Kalifornia“ (Early Grace – Brad Pitt). Beide Protagonisten zeigen eine derartig sadistische Kaltblütigkeit, dass bei ihnen von der Extremform, der Psychopathie, gesprochen werden kann. Hannibal Lecter zeigt kannibalistische Neigungen und verspeist seine Opfer, Early Grace dagegen tötet wie nebenbei jeden, der sich ihm in den Weg stellt.
Neben der antisozialen gibt es aber auch andere Persönlichkeitsstörungen, die sich für das Kino anbieten, wie beispielsweise die narzisstische. Die Betroffenen halten sich selbst für besser und großartiger als den Rest der Menschheit, nutzen andere rücksichtslos aus und sind ständig auf der Suche nach Lob, Anerkennung und Bewunderung. Das alles brauchen sie wie die Luft zum Atmen, weil sie nicht in der Lage sind, ihr Selbstwertgefühl selbst zu stabilisieren, und so auf eine ständige Bestätigung von außen angewiesen sind. Verfügen sie über eine ausreichende Begabung, stellt ihr Narzissmus eine innere Triebfeder dar, die sie zu Höchstleistungen auf den verschiedensten Gebieten antreibt. So verhält es sich auch im Fall von Charles Foster Kane in „Citizen Kane“ und bei Truman Capote in „Capote“.
Größer als der Rest der Welt
Der Schriftsteller Truman Capote wird kongenial von Philip Seymour Hoffmann dargestellt, wie er sich einem Verbrecherduo annähert, das kaltblütig eine ganze Familie bei einem Raubüberfall umgebracht hat. In scheinbarer Freundschaft begleitet Capote die beiden bis zur Hinrichtung, wobei er immer zugleich seinen eigenen Roman im Kopf hat, der später unter dem Titel „Kaltblütig“ Literaturgeschichte geschrieben hat. Nicht weniger schillernd ist die Verkörperung des Charles Foster Kane durch Orson Welles. Dessen ungeheuerer wirtschaftlicher Erfolg war nicht zuletzt Resultat seines inneren narzisstischen Getrieben Seins. Birger Dulz, der in „Frankenstein und Belle de Jour“ den Film analysiert, hat eine doppelbödige Strategie gewählt: Er nimmt die Rolle eines narzisstisch gestörten Autors ein, der die verblüffenden biografischen Parallelen zwischen Kane, seinem historischem Vorbild William Randolph Hearst und dem Hauptdarsteller und Regisseur Welles aufzeigt. Nicht nur litten alle drei höchstwahrscheinlich unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sie hatten auch alle drei eine mehr oder weniger spezielle Beziehung zu Adolf Hitler.
Die „stilleren“ Persönlichkeitsstörungen eignen sich weniger für Hollywood, nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe sehr anrührender Filme zu diesem Thema. Beispielhaft sei „Ein Herz im Winter“ erwähnt, ein französischer Film von großer Subtilität und Schönheit. Stéphane (Daniel Auteuil) und Maxime (André Dussollier) stellen ein ungleiches Geigenbauerpaar dar. Während Stéphane der introvertierte Tüftler ist, kümmert sich der extrovertierte Maxime um das Geschäft. Als Maxime wieder einmal eine junge Freundin, die Geigerin Camille (Emmanuelle Béart), mitbringt, kommt es zwischen ihr und Stéphane zu einer spürbaren Annäherung. Jedes Mal, wenn Camille sich Stéphane nähert, stößt sie gegen eine unsichtbare Mauer, so als wäre Stéphane von einer Glaswand umgeben. Schließlich weist er sie schroff ab, obwohl er augenscheinlich von ihr beeindruckt ist. Sein Verhalten ist typisch für Menschen mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung, die aufgrund ihrer übergroßen Verletzlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen Nähe und Intimität weitgehend oder vollständig opfern, um der Angst vor Verletzung und Enttäuschung zu entgehen. Nicht selten handelt es sich dabei um Personen von großer Sensibilität. Diese bringen sie allerdings in ihre Arbeit, Handwerk oder Kunst ein, nicht in persönliche Beziehungen. Eine weitere bewegende Darstellung dieses Typus liefert Anthony Hopkins als Butler Stevens in „Was vom Tage übrig blieb“.
Last but not least stehen natürlich auch die Perversionen im Fokus der Filmemacher, da sie entweder in Verbindung mit besonders abscheulichen Formen des Verbrechens stehen oder schillernde und irritierende Varianten der Sexualität zeigen. Eine klassische Darstellung des ersteren Typs findet sich in „M – eine Stadt sucht einen Mörder“ von Fritz Lang. Der pädophile Mörder (Peter Lorre) tötet zum wiederholten Male ein Kind und wird nicht etwa von der Polizei, sondern von Großstadtganoven gejagt und gefasst, die sich durch das erhöhte Polizeiaufgebot nach seiner letzten Tat bedroht fühlen. Im Gegensatz dazu zeigen die Filme „Sex, Lügen und Video“ und „Belle de Jour“ Spielarten von Sexualität, die zwar mit einem Leiden für die Betroffenen einhergehen, nicht aber mit kriminellen Handlungen. Graham (James Spader) filmt sexuelle Geständnisse anderer mit seiner Videokamera und befriedigt dadurch seinen Voyeurismus. Sexualität auf andere Weise zu erleben ist ihm versagt. Bis schließlich eins seiner „Opfer“ – Ann (Andie MacDowell) – den Spieß umdreht und die Kamera auf ihn richtet. Der Klassiker „Belle de Jour“ von Luis Bunuel dreht sich um Séverine Sérizy (Cathérine Deneuve), eine Frau, die unter sexuellem Masochismus leidet. Sie kann Sexualität nur in einer Position der Unterwerfung und Demütigung genießen und verdingt sich zu diesem Zweck als Prostituierte. Um ihr bürgerliches Leben zunächst ungehindert weiter führen zu können, arbeitet sie nur tagsüber, was ihr den Namen „Schöne des Tages“ einträgt.
Neben Unterhaltung und bisweilen Kunsterlebnis bietet das Kino also auch psychopathologisches Lehrmaterial. Natürlich lässt sich der Ansatz auf die Darstellung von Krankheiten und der Medizin insgesamt ausdehnen. Besonders interessant und kontrovers fällt dabei die Darstellung der Zahnärzte im Spielfilm aus, die das Schicksal von Psychoanalytikern und Psychiatern teilen: Entweder werden sie als Witzfiguren oder als Psychopathen gezeichnet. Fast nie setzt sich ein Spielfilm ernsthaft und differenziert mit Angehörigen einer dieser beiden Berufsgruppen auseinander – das dürfte wohl daran liegen, dass sie für viele Menschen zugleich Faszination und Bedrohung mitbringen.
Prof. Dr. Stephan DoeringBereich Psychosomatik in der ZahnheilkundePoliklinik für Zahnärztliche Prothetik undWerkstoffkunde,Universitätsklinikum MünsterWaldeyerstr. 30, 48149 Münster