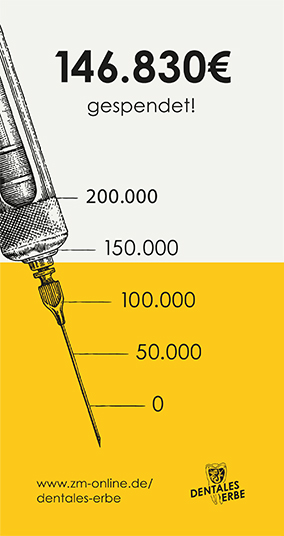Bitte bleiben Sie gesund
Eric Bauer
Ärzte stehen heute in ihrem Beruf mehr denn je unter Druck. Der Umgang mit Krankheit, Schmerz, Leid und manchmal auch Tod ist nicht einfach. Der Arzt trägt in seinem Job eine hohe Verantwortung. Stress und lange Arbeitszeiten gehören zum Alltag. Fehler dürfen nicht vorkommen und können schlimme Konsequenzen haben – Perfektion wird erwartet. Zudem müssen Mediziner mit schwindenden Ressourcen und größeren Verantwortungsbereichen umgehen. Zahnärzte sind dabei ganz eigenen beruflichen Belastungen ausgesetzt. Es gibt Ähnlichkeiten zu Ärzten – aber auch Unterschiede.
Im Jahr 2011 wurden Mediziner in einer Studie des Uniklinikums Heidelberg zu ihrer Stressbelastung im Beruf befragt. An erster Stelle stand die hohe zeitliche Beanspruchung, bedingt durch eine dünne Personaldecke und häufige Dienste, aber auch der eigene Anspruch, erreichbar und präsent zu sein. Von niedergelassenen Medizinern wurden zudem die starken bürokratischen und finanziellen Lasten beklagt. „Die Stressbelastung ist konstant hoch“, berichtet Dr. Ferdinand Klopfer, Assistenzarzt an einer Berliner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. „Neben der Patientenversorgung und den Dokumentationsaufgaben sind es auch die langen, stark unterschiedlichen Arbeitszeiten, die belasten.“
Es ist also nicht verwunderlich, dass es seltener Krankheitserreger sind, die die Gesundheit der Mediziner belasten. Vielmehr sind es psychische Probleme, die Ärzten am meisten zu schaffen machen. Doch krank sein, ein Halbgott in Weiß? Darf das überhaupt sein?
Das Problem mit sich selbst
Viele Ärzte wollen sich ihre Gesundheits-probleme nicht eingestehen aus Angst vor Stigmatisierung oder beruflichen Konsequenzen. Und selbst wenn sie das Problem zugeben, fällt es ihnen schwer, sich in die Rolle des Patienten zu begeben. „In einem viel zu hohen Prozentsatz behandeln Ärzte sich selbst, oft deutlich unter dem aktuellen Stand“, erklärt der Psychiater Dr. Bernhard Mäulen, Gründer des Instituts für Ärzte- gesundheit. Das liege an veraltetem Wissen, an der Überdosierung von Medikamenten und weil sie sich selbst nicht objektiv dia-gnostizieren können.
Viele kranke Ärzte präge eine lange und zumeist intensive Abwehr, selbst an Grenzen gestoßen oder sogar krank zu sein, berichtet Dr. Friedhelm Stetter gegenüber dem Fachjournal „Ärztliche Praxis“. Er betreute als Oberarzt der Oberbergklinik Extertal viele suchtkranke Mediziner. Kranksein stehe „im Widerspruch zu dem hohen Selbstideal des Arztes. Daher bestehen fast immer Probleme, sich als Patient zu fühlen“, weiß Stetter.
Besonders Klinikärzte sind starken Belastungen ausgesetzt, mehr noch als niedergelassene Ärzte und Zahnärzte. Im Krankenhaus herrscht ein Arbeitsklima, das durch Zeit- und Kostendruck eher rau ist. Persönliche Schwierigkeiten und Schwächen sind nicht erwünscht. Eigene Gesundheitsprobleme werden deshalb ignoriert oder kleingeredet. „Als Klinikarzt krank zu sein, ist sehr schwierig“, weiß Klopfer. „Einerseits fühlt man sich den Kollegen verpflichtet, die dann die Arbeit mit übernehmen müssen. Andererseits brauchen die eigenen Patienten Hilfe. Und wenn man aus der Krankheit zurückkommt, muss man viel Arbeit nachholen.“ Deshalb seien Krankschreibungen nur bei schwerwiegenden Problemen üblich, sagt der Psychiater. Laut einer Umfrage der kanadischen Ärztevereinigung CMA gehört zu den größten Stressfaktoren im Job einerseits die Angst, dass die Bitte um Hilfe einen negativen Einfluss auf die Karriere hat und andererseits die Erwartungen sowohl des Arbeitsumfelds als auch der Patienten, alles zu schaffen.
Für niedergelassene Ärzte und Zahnärzte stellt sich zusätzlich das finanzielle Problem bei Krankheit. Nur für behandelte Patienten bekommen sie Geld. Müssen sie ihre Praxis wegen Krankheit schließen, kommt es zu Verdienstausfällen.
Dauerhafter Stress kann zu Fehleinschätzungen, Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung und einem höheren Unfall- und Verletzungsrisiko durch verminderte Aufmerksamkeit führen. Er kann sich in Kopfschmerzen, Magen-Darm-Leiden, Schlafproblemen und emotionalen Aus- brüchen manifestieren. Auch Appetitlosigkeit, schlechte Ernährung, Mattigkeit und ein dauerhaftes Erschöpfungsgefühl sind nicht selten. Kann der Arzt mit dem Stress nicht mehr umgehen, stellen sich fast zwangsläufig psychische Probleme ein.
Der Kopf macht nicht mit
Mediziner erkranken häufiger an Depressionen, Burn-out und Angststörungen als der Durchschnittsbürger. Auch die Suizidrate ist höher. „In meiner Praxis sehe ich am meisten Kollegen mit manifestem Burn-out und Ärzte mit affektiven Störungen, meist mit depressiver Episode“, berichtet Mäulen.
Nach Ergebnissen des ÄsQuLAP-Projekts der Ludwig-Maximilians-Universität München, das die Gesundheit und die Jobbedingungen von Klinikärzten untersuchte, weisen zehn Prozent der Mediziner im Lauf ihres Arbeitslebens mindestens einmal kritische Depressionswerte auf. Eine Studie aus dem Deutschen Ärzteblatt geht von 22 Prozent der Ärzte mit Burn-out-Syndrom aus. Eine US-Studie aus dem Jahr 2004 kommt bei Assistenzärzten der Inneren Medizin sogar auf eine Burn-out-Rate von 76 Prozent. Die Selbstmordrate unter Medizinern ist bis zu 3,4-mal höher als die der Durchschnittsbevölkerung, bei Ärztinnen ist sie sogar bis zu 5,7-fach erhöht.
Mehrere Studien kommen zu dem Schluss, dass auch Zahnärzte überdurchschnittlich oft unter psychischen Problemen leiden. Nach einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ) von 2001 fühlen sich vier von fünf durch die hohen Anforderungen an die Konzentration gestresst, viele fühlen sich nach einem vollen Arbeitstag erschöpft. Zudem beklagt gut ein Drittel zu viel berufliche Verantwortung.
Ein erhöhtes Risiko zeigt auch die Studie „Burn-out-Analyse bei deutschen Zahn- ärzten“ der Universität Witten/Herdecke. „Zahnärzte leiden unter einem sehr hohen Stresserleben“, erklärt Dr. Carolin Wissel, Hauptautorin der Studie. „Durch diesen chronischen Stress steigt die Gefahr einer psychischen Erkrankung oder eines Burn-out-Syndroms.“ Bedeutende Stressfaktoren in der Praxis seien eigene Misserfolge, eigener Perfektionismus sowie die zahlreichen Verwaltungstätigkeiten. Ein weiterer Risikofaktor könne die Isolation in der Einzelpraxis sein, durch die der Austausch mit anderen Kollegen häufig fehle.
Nach Erkenntnissen der Untersuchung, die auf einer Freiwilligen-Stichprobe im Internet basiert, leiden 44 Prozent der Zahnärzte an Depressionen. „Depressionen korrelieren mit chronischem Stress, daher die hohe Zahl“, erklärt Wissel und erinnert: „Eine Depression ist geprägt durch psychische Niedergeschlagenheit, sie muss nicht immer medikamentös behandelt werden, auch eine Psychotherapie kann helfen.“ 13 Prozent geben zudem an, schon einmal Suizidgedanken gehabt zu haben. Für die Studienautorin ein alarmierendes Signal: „Wer sich als Mediziner mit Selbstmordgedanken trägt, tut dies nicht leichtfertig.“
Folgen einer Depression oder eines Burn-outs sind emotionale Erschöpfung, Müdigkeit und oftmals eine negative, zynische Einstellung der Arbeit gegenüber. Darunter leiden dann die Arbeitszufriedenheit und letztlich auch die Patienten. „In besonders schweren Fällen muss sogar die Praxis aufgegeben werden“, weiß Wissel.
Die Flucht in den Alkohol
Manche versuchen die Belastung im Job durch legale, teilweise auch illegale Mittel zu kompensieren. Insgesamt zehn bis zwölf Prozent der Ärzte benutzen in ihrer Berufslaufbahn Substanzen missbräuchlich, zeigen verschiedene US-Studien. Die amerikanische Zahnärztevereinigung ADA geht von zehn bis 15 Prozent der Zahnmediziner mit Suchtmittelproblemen aus.
Ohne effektive Bewältigungsstrategien, die helfen, mit dem Dauerstress in ihrem Beruf umzugehen, sind Ärzte und Zahnärzte anfällig für den Missbrauch von Alkohol und anderen Substanzen, die ihnen im ersten Moment Erleichterung und Trost verschaffen.
Das führt oft zu beruflichen Problemen durch Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Fehler in der Behandlung, Stimmungsschwankungen. Aber auch das Privatleben leidet. Sie leugnen lange die Schwere ihres Problems. Haben sie es erkannt, holen sie sich oft keine Hilfe aus Angst vor beruflichen Konsequenzen bis zum Jobverlust.
Der amerikanische „Physician Substance Use Survey“ kommt zu dem Schluss, dass Ärzte weniger rauchen und illegale Drogen (zum Beispiel Marihuana oder Kokain) nehmen als die Allgemeinbevölkerung, aber mehr Alkohol trinken und mehr Schmerzmittel wie Opiate und Benzodiazepine verwenden. In den Vereinigten Staaten wurden von der US-Ärztevereinigung AMA bereits 1973 Programme etabliert, die abhängigen Ärzten Hilfe bieten. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2009, die im „Journal of Substance Abuse and Treatment“ veröffentlicht wurde, hat die Hälfte der Teilnehmer an diesen Programmen eine Alkoholabhängigkeit, gut ein Drittel ist opioidabhängig.
In Deutschland etablierte als erste die Landesärztekammer Hamburg Anfang der 1990er-Jahre ein Programm für abhängige Ärzte. 1999 empfahl dann die Bundesärztekammer der Länderkammern, suchtkranken Medizinern Betreuungsmöglichkeiten anzubieten. Heute gibt es in der Bundesrepublik „effektive Hilfsprogramme in vielen Ärztekammern“, weiß Mäulen. „Hier wird das Prinzip ,Hilfe statt Strafe’ eingesetzt, das heißt, wenn die Ärztekammer Hinweise auf eine Suchtproblematik bekommt, wird der Kollege zu einem Gespräch gebeten und auf ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten hingewiesen; meist wird auch verlangt, dass der Kollege zumindest eine externe Evaluation annimmt und das Ergebnis an die Kammer weiterleitet.“
Der Arbeitsplatz als Gefahr
Gesundheitsrisiken lauern am Arbeitsplatz in der Praxis oder im Krankenhaus ständig auf Ärzte und Zahnärzte. Das reicht von Nadelstichverletzungen über Krankheits- erreger bis zu aggressiven Patienten. Auch die Arbeitszeiten, insbesondere im Krankenhaus, haben einen schlechten Einfluss auf die Gesundheit: Schicht- und Bereitschaftsdienste sowie Überstunden sind Normalität. „Ich komme durchschnittlich auf über 50 Arbeitsstunden pro Woche“, berichtet Klopfer. Müdigkeit und häufige Erkältungen infolge eines geschwächten Immunsystems sind für ihn Begleiter des Berufslebens.
Bei Zahnärzten sind vor allem Rückenschmerzen aufgrund von Wirbelsäulenbelastungen eine typische Berufskrankheit. Verkrampfte, verdrehte, krumme und lang anhaltende (sprich: unergonomische) Steh- und Sitzpositionen an der Behandlungseinheit, kombiniert mit hohen Konzentrationsanforderungen, belasten den Rücken. In der IDZ-Studie gaben knapp 38 Prozent der Zahnärzte an, aktuell unter Rückenschmerzen zu leiden. In den vergangenen zwölf Monaten waren es sogar fast 87 Prozent. Je höher die Zahnärzte ihre Stressbelastung einschätzten, desto häufiger hatten sie Rückenprobleme.
Die Ergonomieforschung beschäftigt sich im zahnmedizinischen Bereich schon seit Jahrzehnten mit der richtigen Arbeitshaltung bei der Behandlung. Fehlhaltungen zeigen erst relativ spät Wirkung, sind dann aber umso schwerer behandel- und korrigierbar. Entscheidend für ein rückenschonendes Arbeiten ist neben der richtigen eigenen Haltung des Zahnarztes, die Lagerung des Patienten, die Einstellung des Behandlungsstuhls und die Position des Helfers.
Auch Dermatosen kommen bei Zahnärzten öfter vor, 35 Prozent berichten von Hautproblemen an Händen und Unterarmen. Ausgelöst werden sie durch Latexhandschuhe, Desinfektionsmittel, Kunststoffe und häufiges Händewaschen. Juckreiz, Rötungen, Ekzeme und allergische Hautreaktionen können die Folge sein. Fast 40 Prozent der Zahnärzte vermuten in der IDZ-Studie Handschuhe als Auslöser für Hautprobleme. Desinfektionsmittel führt nach Eigenbeobachtung bei 16, Händewaschen bei zehn Prozent zu Irritationen.
Der Patient leidet mit
Die Arzt-Patienten-Beziehung ist in der modernen Medizin ein zentraler Punkt. Der Patient will dem Arzt heute auf Augenhöhe begegnen, das hierarchische Behandlungsmodell hat ausgedient, Patientenorientierung wird großgeschrieben. Der Gesundheitszustand des Arztes hat dabei einen entscheidenden Einfluss auf die Versorgungsqualität. „Als Arzt habe ich eine Vorbildfunktion und stehe vor der Herausforderung, gesundheitsförderndes Verhalten den Patienten glaubwürdig zu vermitteln“, erklärt Mäulen. „Oft können dies Kollegen, die selbst auf ihre Gesundheit achten, dem Patienten kongruenter und überzeugender erklären.“
In der Heidelberger Studie nannten die befragten Ärzte die positiven Erlebnisse aus der Arzt-Patienten-Beziehung als größte Kraft- und Freudenquelle. Die Glaubwürdigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Mäulen: „Einem trainierten und schlanken Arzt nehme ich eher ab, dass ich mein Essen einschränken und auch mehr Sport machen soll, als einem übergewichtigen, der zusätzlich vielleicht noch Raucher ist.“
Auch lange Arbeitszeiten können sich negativ auf die Patientenversorgung auswirken, gerade im Krankenhaus. Einer Untersuchung der AMA zufolge steigt bei einem 24-stünigen Bereitschaftsdienst die Zahl der vermeidbaren medizinischen Fehler um das Siebenfache. Das Risiko, eine schwere medizinische Fehleinschätzung zu begehen, ist um 35 Prozent erhöht. Kürzere Arbeits- zeiten dagegen führen laut AMA zu einer besseren Versorgung und einer niedrigeren Sterberate unter Hochrisikopatienten. In Zeiten des Kostendrucks sind verkürzte Arbeitszeiten aber oft eine Utopie.
Das System hilft zu wenig
Der Gesundheitszustand der Ärzte sagt auch etwas über das Gesundheitssystem aus, in dem sie arbeiten, findet Dr. Jane Lemaire, Vizedekanin der Medizinischen Fakultät der Universität Calgary. „Ein Burn-out beeinträchtigt den Arzt. Beeinträchtigt er also nicht auch dessen Arbeitsleistung? Wenn Mediziner krank sind, hat das ernste Konsequenzen für sie, ihre Arbeit und ihre Beziehungen. Aber es hat auch ernste Konsequenzen für das Gesundheitssystem“, so Lemaire gegenüber dem kanadischen Ärzteblatt CMAJ. Sie fordert deshalb schon seit Jahren, die Gesundheit von Ärzten regel-mäßig zu untersuchen und als Indikator in die Qualitätssicherung zu übernehmen.
Europa und speziell Deutschland haben auf dem Gebiet der Ärztegesundheit noch Arbeit vor sich. Es gibt keine umfassenden Studien hierzulande, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern nur Untersuchungen zu Teilaspekten. Weder das Robert Koch- Institut noch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder die Bundesärztekammer verfügen über belastbare Daten.
Mäulen sieht das Hauptproblem der Ärzte im Umgang mit ihrer Gesundheit in der Ausbildung: „Zu lange haben wir uns im Studium fast ausschließlich auf den Patienten beziehungsweise die Krankheit konzentriert. Die Wichtigkeit einer eigenen Balance der Eigenfürsorge blieb sowohl unter den Bedingungen des Studiums als auch der nachuniversitären Sozialisation zurück.“ Allerdings gebe es Fortschritte, das Thema Ärztegesundheit sei immerhin immer wieder Gegenstand von Fortbildungen, Umfragen und Fachartikeln. Mit dem sogenannten „Arztfaktor“ und dessen Einfluss auf die Qualität der Versorgung beschäftigt sich die Bundesärztekammer in einem Forschungsprojekt. In der Zahnmedizin hat der Arztfaktor unter dem Stichwort Ergonomieforschung eine lange Tradition.
In Kanada und in den USA wird noch viel mehr in Sachen „Physician Health“ unternommen, um die Gesundheit der Ärzte zu erhalten und im Fall des Falles wieder her-zustellen. Die kanadische Ärztekammer investierte zusammen mit den Provinzärztekammern (vergleichbar mit den deutschen Landesärztekammern) in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro, um die Gesundheit ihrer Mitglieder zu verbessern. Zur Präventionsarbeit wurde ein eigenes Institut gegründet, das Canadian Physician Health Institute. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen wie die Gesundheitsförderung an und vermittelt medizinische Versorgung und Betreuung von Ärzten.
In den USA stellt das Dentist Peer Assistance Program (DPAP) landesweit Hilfsprogramme speziell für Zahnärzte bereit. Sie umfassen neben allgemeinen Informationsangeboten auch Drogentests, Rechtsberatung und psychologische Unterstützung.
Der Wunsch nach einem gesunden Leben
Niedergelassene Ärzte und Zahnärzte haben andere Erholungsmöglichkeiten und -bedarfe als Klinikärzte. Wo bei einem Onkologen im Krankenhaus die Ablenkung von Leid und Tod im Vordergrund steht, muss sich der niedergelassene Zahnarzt eventuell mehr um seinen belasteten Rücken kümmern. Allen gemeinsam ist aber der Wunsch nach einem gesunden Leben. Wie kann es der Mediziner schaffen, ohne größere Schäden seinen Beruf auszuüben? Ein paar Grundregeln, um die eigene Gesundheit zu erhalten, sind so einfach wie banal und jedem Arzt und Zahnarzt bekannt: gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, wenig Alkohol, nicht rauchen. Das sollte einzuhalten sein.
Komplizierter wird es dagegen bei der von Experten angepriesenen Work-Life-Balance. Neben dem Beruf ein erfülltes Privatleben zu führen, gestaltet sich bei Wochenarbeitszeiten von 50 oder 60 Stunden plus teilweise Not- und Schichtdiensten schwierig. Doch gerade die sogenannte Generation Y, also die nach 1980 Geborenen, definieren sich nicht mehr nur über ihre Arbeit, sondern wollen auch ausreichend Zeit mit Partner, Familie und Freunden verbringen. Hier gilt es, verstärkt Arbeitszeitmodelle anzubieten, damit Berufs- und Privatleben sich ergänzen und nicht das eine das andere auffrisst.
In der IDZ-Untersuchung wurden die Zahnärzte nach ihren Bewältigungsstrategien mit Arbeitsbelastung gefragt, die mit Abstand häufigsten Nennungen bekam „ausreichend Freizeit“ – nach der sie sich auch oft gut erholt fühlten. In der Heidelberger Studie nannten die Mediziner Freizeitaktivitäten (79 Prozent), Kollegialität bewusst suchen und pflegen (53 Prozent) und Investition in und Zuwendung durch Familie/Freundschaften (47 Prozent) am häufigsten. Zudem wurden Mediziner, die sich wegen Burn-out, Depressionen oder Substanz- abhängigkeiten in stationärer Behandlung befanden, nach ihren Empfehlungen für andere Ärzte befragt. Sie sollten private Interessen aufrechterhalten und pflegen, wurde geraten. Zudem sollten die eigenen Grenzen wahrgenommen und geschützt, der kollegiale Austausch gesucht und gepflegt sowie bei Bedarf Hilfe gesucht und auch angenommen werden.
Die Arbeitsbelastung unter Ärzten und Zahnärzten in Deutschland führt dazu, dass die Lebensqualität und -zufriedenheit leidet und oft genug zu gesundheitlichen Problemen führt. Dem muss vom Gesundheitssystem, aber auch von den Ärzten selbst stärker als bisher Rechnung getragen werden. Denn nur ein zufriedener, gesunder Arzt kann auch ein guter Arzt sein.
Info
Wie man Probleme erkennen kann
Dr. Bernhard Mäulen hat eine Systematik entwickelt, mit der sich psychische Probleme bei Ärzten erkennen lassen (veröffentlicht im Sammelband „Arbeitsbedingungen und Befinden von Ärztinnen und Ärzten“, 2010):
• Häufige Fehlzeiten, wiederholtes kurzfristiges Verschwinden vom Arbeitsplatz und starke Stimmungsschwankungen können auf eine Suchtkrankheit hindeuten.
• Eine verminderte Leistungsfähigkeit, vermehrte Müdigkeit und Verschlossenheit können Hinweise für eine Depression oder ein Burn-out-Syndrom sein.
• Eine schlechte Arbeitsmoral, verspätete Dokumentationen und eine niedrige Patientenorientierung können Anzeichen für eine Persönlichkeitsstörung sein.
Info
Work-Life-Balance bei Zahnärzten
Die BZÄK beschäftigt sich in einem Memorandum mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Zahnärzten. Dort heißt es: „Da die zahnärztliche Berufsausübung zahlenmäßig ganz überwiegend und unverändert in selbstständiger Praxisniederlassung erfolgt, sind Unterstützungsangebote für eine familienfreundliche Niederlassung mit flexiblen Berufsausübungsformen für junge Zahnarztfamilien zweifellos prioritär.“
Über die Landeszahnärztekammern können Interessierte Informationen zur Niederlassungsberatung, zu Wiedereingliederungsseminaren, zu flexiblen Teilzeitmodellen, zu familienfreundlichen Notdienstplänen, zu Fortbildungsangeboten zum Thema und (vor allem für Zahnärztinnen) zu genderspezifischen Netzwerken erhalten.