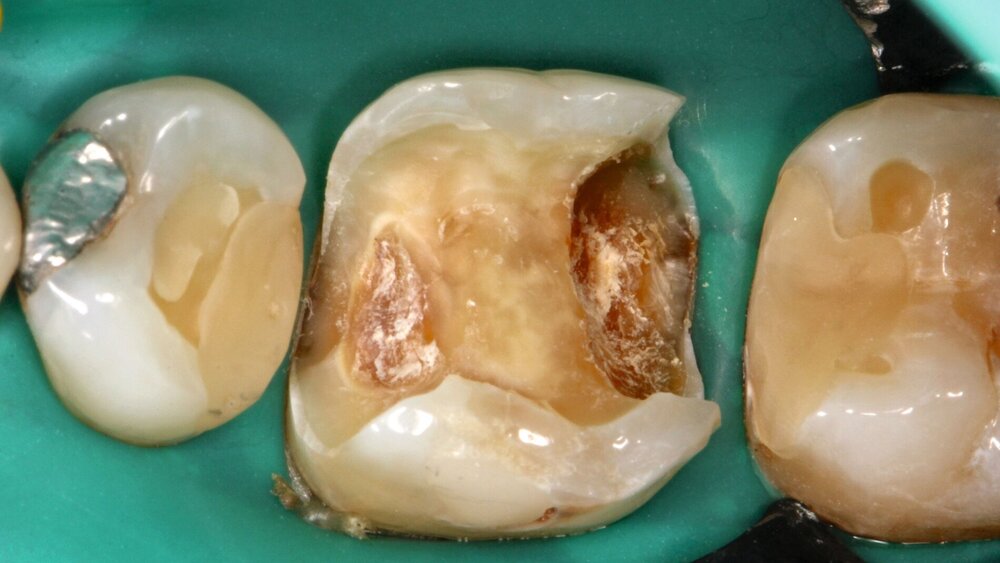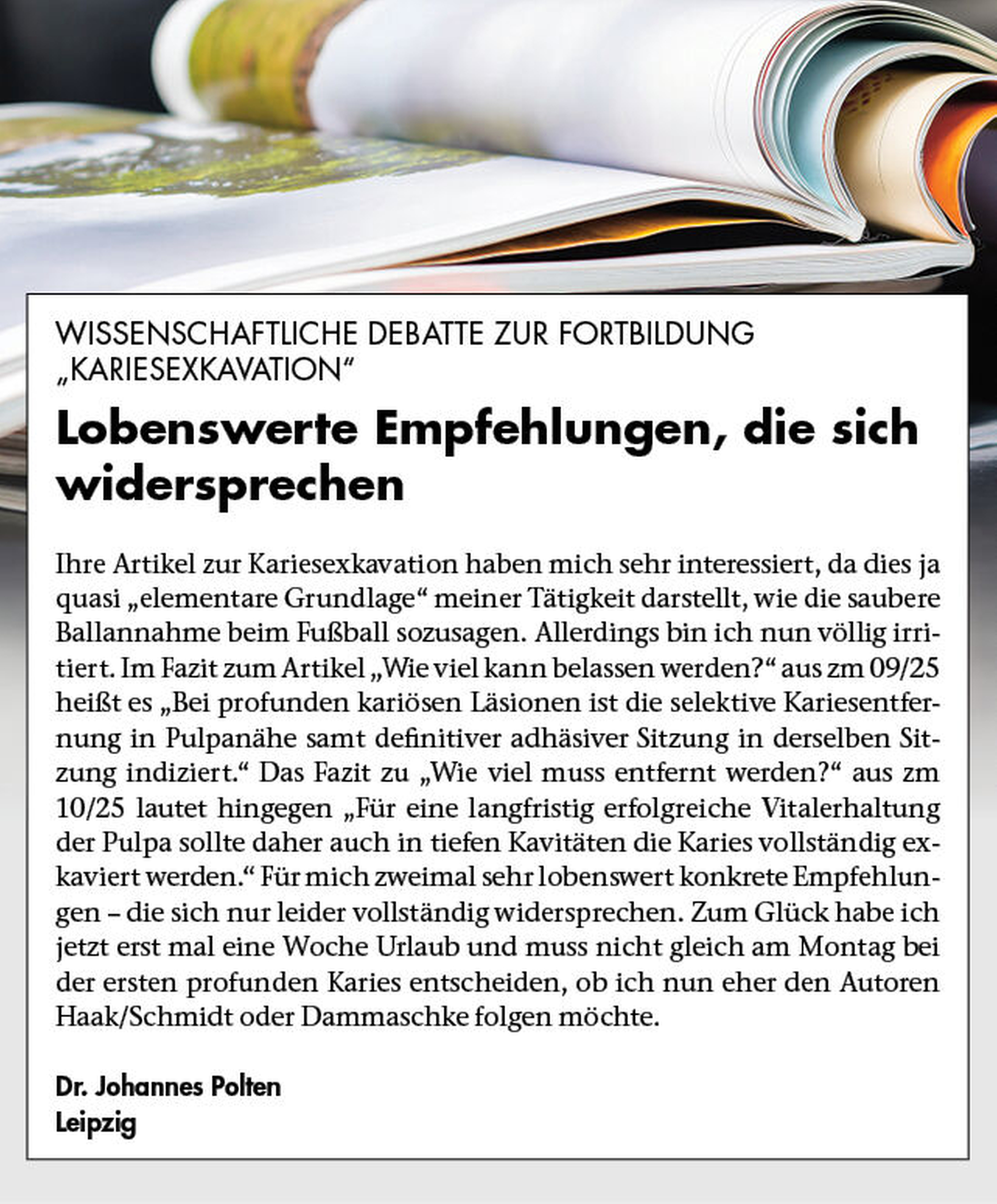„Die Evidenz stützt weniger invasives Vorgehen bei tiefen Läsionen!“
In den letzten beiden Ausgaben der Zahnärztlichen Mitteilungen wurden unterschiedliche Sichtweisen auf den heutigen wissenschaftlichen Stand zur Kariesentfernung dargelegt. Während weitgehend Übereinstimmung in den Empfehlungen zur Behandlung von Läsionen, die nicht bis in Pulpanähe ausgedehnt sind, besteht, beschreiben die Beiträge unterschiedliche Positionen zur Kariesentfernung bei tiefen Läsionen. Gerade der letzte Beitrag von Dammaschke [2025] ist allerdings nur partiell mit der herrschenden Evidenz in Kongruenz zu bringen. Im Folgenden soll kritisch auf diesen Artikel eingegangen werden.
Dammaschkes Argumentation für eine vollständige Exkavation
Prof. Dr. Till Dammaschke plädiert in seinem Beitrag für eine vollständige Exkavation der Karies: Die selektive Kariesexkavation führe „nach der Behandlung vermutlich ‚nur‘ zu einer klinischen Symptomlosigkeit, aber langfristig nicht zu histologisch gesundem Pulpagewebe. Exkaviert man hingegen vollständig, bleibt das Pulpagewebe auch nach direkter Überkappung oder partieller Pulpotomie zu einem hohen Prozentsatz histologisch gesund“, schreibt er und ergänzt: „Da die pulpalen Veränderungen bei Belassen von Karies unter Füllungen in der Regel langsam ablaufen [Langeland, 1981], besteht für die selektive Kariesexkavation möglicherweise dann eine Indikation, wenn die klinische Behandlungssituation schwierig ist und Zähne nur (noch) eine begrenzte Verweildauer im Mund haben, wie zum Beispiel bei sehr jungen Patienten im Milchgebiss oder sehr alten Patienten mit Grunderkrankungen."
Fortbildung Kariesexkavation: Wie viel muss entfernt werden? zm 10/2025
1. Die Darstellung der Evidenz zur selektiven (und auch schrittweisen) Kariesexkavation ist nicht ausgewogen. So wird beschrieben, wie die Erfolgsraten der selektiven Exkavation „im Laufe der Zeit sinken“ - was auf nahezu jede Intervention in der Medizin zutreffen dürfte. Die ausgewählte Darstellung einzelner Studien und das Auslassen jeglicher Vergleichsgruppen zur non-selektiven Exkavation werden genutzt, um ein schiefes Bild zum Erfolg der selektiven Exkavation zu zeichnen. So wird die Studie von Mertz-Fairhurst (1998) als Argument eingesetzt, um die selektive Exkavation zu diskreditieren, da hier für ein weniger invasives Vorgehen vermeintlich geringere Erfolgsraten gezeigt wurden als für die non-selektive Exkavation [Mertz-Fairhurst et al. 1998]. Festzustellen ist aber, dass
(1) in dieser Studie überhaupt nicht selektiv exkaviert wurde, wie dargelegt. Stattdessen wurden kavitierte, nur moderat tiefe Läsionen ohne jegliche vorherige Exkavation mit einem Kunststoffmaterial versiegelt – ein Therapiekonzept, dass so niemand heute propagiert.
(2) Ausgehend von der Tiefe der Kavitäten in dieser Studie bestand in keiner Gruppe (auch nicht in der der non-selektiven Exkavation) das Risiko einer Pulpaexposition – womit diese Studie ungeeignet ist, die Diskussion zum Management tiefer Läsionen zu befruchten.
(3) Die zitierten hohen 10-Jahres Erfolgsraten (98 Prozent) nach non-selektiver Exkavation wurden in dieser Studie mit adhäsiv verankerten Amalgamrestaurationen erzielt, deren Ränder zusätzlich versiegelt wurden. Dies dürfte heute nicht als zeitgemäßes Vorgehen gelten (und durch den Amalgam-Phase-out auch nicht realisierbar sein). Konventionelle Amalgamrestaurationen, die nach non-selektiver Exkavation platziert wurden, zeigten hingegen deutlich niedrigere Erfolgsraten und waren der reinen Versiegelung nicht überlegen. Insgesamt zeigt die Studie von Mertz-Fairhurst vielmehr, dass ein Versiegeln kariöser Läsionen theoretisch möglich ist, aber unter Auslassung jeglicher Entfernung kariösen Dentins zu mechanischen Problemen führen kann.
2. In diesem Zusammenhang wird auch das Frakturrisiko nach selektiver Extraktion als potenzielles Problem dargestellt. Hierzu werden Daten zu niedrigeren Haftwerten an kariös verändertem im Vergleich mit gesundem Dentin zitiert und die In-vitro-Studie von Hevinga et al. 2010 erwähnt, die nach dem Zurücklassen größerer Mengen kariösen Dentins ein hohes Frakturrisiko von okklusalen Restaurationen beschrieben hat {Hevinga et al. 2010]. Unerwähnt bleibt allerdings, dass mehrere andere Studien dieses erhöhte Frakturrisiko nicht aufzeigen – vor allem dann nicht, wenn kariöses Dentin nicht großflächig zurückgelassen wird, sondern (wie auch in den Empfehlungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften dargestellt) nur kleinflächig in pulpanahen Arealen verbleibt [Hoefler et al., 2016; Jardim et al., 2020; Schwendicke et al., 2013a; Schwendicke et al., 2013b; Schwendicke et al., 2021]. Ebenso unerwähnt bleibt, dass das Einbringen von Kalziumhydroxid als Liner, wie in dem Artikel befürwortet, zu keinerlei Haftung an der abgedeckten Dentinfläche führen dürfte. Richtig ist vermutlich, dass jegliche kleinflächige Reduktion der Haftfläche (ob nun durch belassenes kariöses Dentin oder einen Liner) klinisch nur bedingt relevant ist [Miotti et al., 2023].
3. Zusammenfassend formuliert der Autor: „Wissenschaftlich lässt sich zudem eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit der derzeit propagierten selektiven Kariesexkavation gegenüber den vitalerhaltenden Maßnahmen nach Freilegung der Pulpa nicht feststellen [Dammaschke et al., 2019; AAE, 2021].“ Dies ist nur bedingt in Einklang zu bringen mit den Ergebnissen systematischer Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen, unter anderem der Cochrane-Gesellschaft, die in dem Beitrag als evidenzbasiert bezeichnet werden. In einem solchen Cochrane-Review (und auf der Basis von fünf Studien) zeigte die non-selektive (vollständige) Exkavation ein signifikant höheres Risiko für Misserfolg im Vergleich zur schrittweisen und selektiven Exkavation [Schwendicke et al., 2021]. Auch eine neuere Übersichtsarbeit zur Behandlung von bleibenden Zähnen mit tiefen kariösen Läsionen kam zu einem ähnlichen Schluss: Die selektive Kariesentfernung zeigte eine höhere Erfolgsrate und weniger Pulpaexpositionen im Vergleich zur non-selektiven Entfernung, insbesondere bei Nachbeobachtungen bis zu 18 Monaten. Nach fünf Jahren Beobachtungszeit gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen selektiver und non-selektiven Kariesentfernung [Figundio et al., 2023]. Diese Ergebnisse werden durch eine kürzlich veröffentlichte randomisierte klinische Studie gestützt, die die selektive Kariesentfernung in bleibenden Zähnen über einen Zeitraum von 18 Monaten untersuchte und ebenfalls signifikant höhere Erfolgsraten nach selektiver statt non-selektiver Exkavation beschrieb [Barros et al., 2025].
4. Zusätzlich werden die Erfolgsraten der direkten Überkappung nach non-selektiver Exkavation durch zwei ausgewählte Studien beschrieben und daraufhin unterstellt, die direkte Überkappung erziele „höhere klinische Erfolgsquoten“ als die selektive Exkavation. Die große Zahl an Studien, die mäßige bis schlechte Erfolgsraten nach direkter Überkappung belegen [Cushley et al., 2021], werden ignoriert oder als „falsch durchgeführt“ bezeichnet. Diese falsche Durchführung wird unter anderem mit dem nicht erfolgten Einsatz von Vergrößerungshilfen und dem Verzicht auf den Einsatz von Kalziumsilikatzementen zur Überkappung begründet. Außeracht gelassen wird dabei, dass eine solche Behandlung der Standard in den meisten zahnärztlichen Praxen in Deutschland sein dürfte. Zumindest könnte dies erklären, warum Routinedaten deutscher Krankenversicherungen (148.000 Behandlungen) Misserfolgsraten von zirka zehn Prozent pro Jahr nach direkter Überkappung beschreiben [Raedel et al., 2016]. Anders ausgedrückt: Fünf Jahre nach der direkten Überkappung ist jede zweite Pulpa entweder wurzelkanalbehandelt oder der Zahn extrahiert.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die selektive Exkavation ist der non-selektiven Exkavation nicht unterlegen, sondern unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos (inklusive der Gefahr einer Pulpaexposition) überlegen. Entscheidend ist hierbei, dass die selektive Exkavation einfach, ohne zusätzliche Kosten, zusätzliches Equipment, zusätzliches Material und durch den allgemein tätigen Zahnarzt durchzuführen ist [Schwendicke et al., 2013c]. Dass in der Hand von Spezialisten unter Einsatz optimaler Techniken und Materialien höhere Erfolgsraten zur Erhaltung der Pulpavitalität in Zähnen mit tiefen kariösen Läsionen erzielt werden können, bleibt unbestritten.
5. Hauptpfeiler der Argumentation in dem Beitrag ist die histologische Beurteilung von Pulpagewebe nach unterschiedlichen Exkavationsmethoden. Diese histologischen Analysen beziehen sich auf Studien einer einzelnen Autorengruppe, die oftmals kleine Fallzahlen (beispielsweise zwölf Zähne) als Basis ihrer Argumentation nutzt [Ricucci et al., 2020]. Die Zähne wurden unterschiedlichen Exkavationsmethoden unterworfen und dann aus chirurgischen oder kieferorthopädischen Gründen extrahiert. So interessant diese Studien sein mögen, leiden sie jedoch an der geringen Fallzahl und ihrer begrenzten Generalisierbarkeit. Zuvorderst aber ist zu kritisieren, dass die klinische Zahnmedizin doch keine histologischen Schnitte therapiert: Auf der Basis von zwölf untersuchten Zähnen klinische Empfehlungen für zehntausende Behandlungen pro Jahr in Deutschland abgeben zu wollen, mutet – gelinde gesagt – gewagt an, zumal die klinischen Daten auch mehrere Jahre nach der Initialtherapie eine andere Sprache sprechen.
6. Zudem stehen die Ausführungen nicht, wie dargestellt, im Einklang mit den Empfehlungen der deutschen und europäischen Fachgesellschaften. DGZ und ESE werden richtigerweise als Proponenten einer Schonung der Pulpa (unter anderem durch selektive oder schrittweise Exkavation) aufgeführt. Jedoch kommt auch die DGET – anders als dargestellt – zu einer deutlich ausgewogeneren Einschätzung zum Thema – zuletzt in ihren „Empfehlungen zur Vitalerhaltung der Pulpa“ aus dem Jahr 2019 (https://www.dgzmk.de/aktuelle-empfehlungen-zur-vitalerhaltung-der-pulpa). So formuliert der Artikel in den letzten ZM: „Da eine klinische Beurteilung bewiesenermaßen nicht ausreicht, um den Erfolg der selektiven Kariesexkavation zu belegen, erscheint es sinnvoll, die Auswirkung des Belassens von Karies auf die Pulpa histologisch zu untersuchen.“ In den Empfehlungen der DGET hingegen heißt es klar: „Ein klinischer Behandlungserfolg nach vitalerhaltenden Maßnahmen der Pulpa liegt vor, wenn die Zähne als „klinisch unauffällig” einzustufen sind, das heißt wenn diese auf die Sensibilitätsprobe reagieren, kein Spontanschmerz, Schmerzen auf Palpation oder Perkussion auftreten und keine Schwellung zu beobachten ist. Röntgenologisch dürfen keine Veränderungen, wie zum Beispiel periapikale Läsionen, sichtbar sein.“ Richtigerweise hat die DGET die Erfolgsbeurteilung von Exkavationsmethoden auf klinische Parameter gestützt – denn nur diese stehen dem klinisch tätigen Zahnarzt zur Verfügung.
Auch formuliert die DGET hinsichtlich des Erfolgs der verschiedenen Exkavationsmethoden deutlich offener: „Trotz insgesamt günstiger Daten für vitalerhaltende endodontische Maßnahmen nach Pulpaexposition im Rahmen der Kariesexkavation steht mit der selektiven beziehungsweise der zweizeitigen Kariesexkavation eine weitere Behandlungsalternative zur Verfügung, die möglicherweise vergleichbare Erfolge aufweist.“ Dass eine solche selektive oder schrittweise Exkavation nur für bestimmte Gruppen (vulnerable Patienten) oder Zähne (deren langfristiger Erhalt sowieso kompromittiert ist) anwendbar ist, wie in dem ZM-Beitrag skizziert, liest sich in den DGET-Empfehlungen an keiner Stelle.
Zusammenfassend unterstützt die vorhandene Evidenz ein weniger invasives Vorgehen bei tiefen Läsionen sehr wohl. Dass in der Hand des Spezialisten die non-selektive Exkavation und bei Bedarf direkte Pulpaüberkappung mit Kalziumsilikatzementen (oder auch die partielle oder vollständige Pulpotomie) eine Daseinsberechtigung hat, ist fraglos richtig. Auch ist es keine Frage, dass die Evidenz für die selektive und schrittweise Exkavation weiter ausbaufähig bleibt. Ebenso ist denkbar (und sogar wahrscheinlich), dass der Einsatz neuer Materialien und Behandlungsmethoden zu veränderten Ansätzen im Umgang mit der tiefen Karies führen wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind nahezu immer mit Unsicherheit behaftet – Empfehlungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften kommen daher selten mit einem „muss“, sondern häufig mit einem „kann“. Eine balancierte und reflektierte Argumentation, die die vorhandene, teils lückenhafte oder widersprüchliche Evidenz berücksichtigt und diese für verschiedene Zielgruppen (allgemein tätige Zahnärzte, Spezialisten) einordnet, ist daher umso wünschenswerter.
Die Beiträge im Fortbildungsteil:
Haak R, Schmidt J: Fortbildung Kariesexkavation. Kariesentfernung – Wie viel kann belassen werden? Zahnärztliche Mitteilungen (zm), 09/2025, S. 50-57. Dammaschke T: Fortbildung Kariesexkavation. Wie viel muss entfernt werden? Zahnärztliche Mitteilungen (zm), 10/2025, S. 40-46.
Literaturliste
Barros M, de Araújo Sales EM, Vieira P, de Araújo MS, Muniz F, Rodrigues LKA. 2025. Selective removal of dental caries in permanent teeth: An 18-month clinical trial. Clin Oral Investig. 29(5):239.
Cushley S, Duncan HF, Lappin MJ, Chua P, Elamin AD, Clarke M, El-Karim IA. 2021. Efficacy of direct pulp capping for management of cariously exposed pulps in permanent teeth: A systematic review and meta-analysis. Int Endod J. 54(4):556-571.
Figundio N, Lopes P, Tedesco TK, Fernandes JCH, Fernandes GVO, Mello-Moura ACV. 2023. Deep carious lesions management with stepwise, selective, or non-selective removal in permanent dentition: A systematic review of randomized clinical trials. Healthcare (Basel). 11(16).
Hevinga MA, Opdam NJ, Frencken JE, Truin GJ, Huysmans MCDNJM. 2010. Does incomplete caries removal reduce strength of restored teeth? Journal of Dental Research. 89(11):1270-1275.
Hoefler V, Nagaoka H, Miller CS. 2016. Long-term survival and vitality outcomes of permanent teeth following deep caries treatment with step-wise and partial-caries-removal: A systematic review. J Dent. 54:25-32.
Jardim JJ, Mestrinho HD, Koppe B, de Paula LM, Alves LS, Yamaguti PM, Almeida JCF, Maltz M. 2020. Restorations after selective caries removal: 5-year randomized trial. J Dent. 99:103416.
Mertz-Fairhurst EJ, Curtis JW, Ergle JW, Rueggeberg FA, Adair SM. 1998. Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: Results at year 10. The Journal of the American Dental Association. 129(1):55-66.
Miotti LL, Vissotto C, De Nardin L, de Andrades Manjabosco B, Tuchtenhagen S, Münchow EA, Emmanuelli B. 2023. Does the liner material influence pulpal vitality in deep carious cavities submitted to selective caries removal? A network meta-analysis review. Clin Oral Investig. 27(12):7143-7156.
Raedel M, Hartmann A, Bohm S, Konstantinidis I, Priess HW, Walter MH. 2016. Outcomes of direct pulp capping: Interrogating an insurance database. Int Endod J. 49(11):1040-1047.
Ricucci D, Siqueira JF, Jr., Rôças IN, Lipski M, Shiban A, Tay FR. 2020. Pulp and dentine responses to selective caries excavation: A histological and histobacteriological human study. J Dent.103430.
Schwendicke F, Kern M, Meyer-Lueckel H, Boels A, Doerfer C, Paris S. 2013a. Fracture resistance and cuspal deflection of incompletely excavated teeth J Dentistry. 42(2):107-113.
Schwendicke F, Meyer-Lückel H, Dorfer C, Paris S. 2013b. Failure of incompletely excavated teeth - a systematic review. Journal of Dentistry. 41(7):569-580.
Schwendicke F, Stolpe M, Meyer-Lueckel H, Paris S, Dörfer CE. 2013c. Cost-effectiveness of one- and two-step incomplete and complete excavations. Journal of Dental Research. 90(10):880-887.
Schwendicke F, Walsh T, Lamont T, Al-Yaseen W, Bjørndal L, Clarkson JE, Fontana M, Gomez Rossi J, Göstemeyer G, Levey C et al. 2021. Interventions for treating cavitated or dentine carious lesions. Cochrane Database Syst Rev. 7(7):Cd013039.